Der Vorzug von Dialogen, die einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden, liegt darin, dass die Zuhörerin oder die Leserin aus dem Spiel der Argumente und Gegenargumente sich einen eigenen Standpunkt erarbeiten kann. Philosophischer Meister darin war Platon (5./4. Jahrhundert v.u.Z.), der freilich kunstvoll konstruierte Dialoge vorlegte.
Auch wenn in Talkshows oder Podiumdiskussionen durch Fragen der Moderatoren oder vorige Absprachen eine gewisse Form in das Gespräch gebracht wird, fehlen hier indes oft analoge gedankliche Tiefe und Teleologie, die Ausrichtung auf ein Ziel.
Ehrlich gesagt finde ich persönlich diese Form des Infotainments ermüdend bis peinlich: Einerseits werden altbekannte Informationen wieder und wieder wiederholt, andererseits ist zuviel des Fremdschämens dabei, wenn die Diskutant*innen wechselseitig allzu oft allzu dumme Dinge sagen.
Mit dem Gespräch von Christoph Butterwegge und Richard David Precht habe ich mich dennoch befasst; nicht weil ich Sympathien für einen der beiden hegen würde, sind sie doch Paradebeispiele für Interview- und Talkshow-Lieblinge, die komplexe Themen versimplizifieren ‒ ohne dass jemand kritisch nachfragt oder auf den jeweiligen Überbau aufmerksam macht.
Die folgende Auseinandersetzung mit dem Gespräch, das kurioserweise trotz seines unphilosophischen Anspruchs im aktuellen Philosophie Magazin auch in gedruckter Form vorliegt, scheint mir vielmehr daher nötig, weil in den sozialen Medien zu Recht über eine Aussage des Gesprächs eine große Aufregung herrscht, was dem emanzipatorischen Diskurs aber mehr schadet denn nützt.
I.
Gleich zu Beginn des Gesprächs stimmt Butterwegge in die industriekapitalistische Liturgie ein, dass jede technologische Revolution auch neue Arbeitsplätze schaffe und die technologische Befreiung von Arbeitsplätzen (er selbst spricht freilich von Vernichtung) ein Mythos sei: „Genau dasselbe wurde auch schon mit Blick auf die Mechanisierung, die Elektrifizierung und die Motorisierung behauptet, ist aber nie eingetreten.“1
In diesem Satz stecken nun gleich mehrere Unscharfheiten resp. Irrtümer:
1) Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Motorisierung entstanden zwar nach einem (manchmal quälend langen) Tief durchaus neue Arbeitsplätze, doch sagt das nichts über Qualität und Sinnhaftigkeit dieser Jobs aus.
2) Es werden hier Zeiten als Analogie herangezogen, in denen eine annähernde Vollbeschäftigung nur deshalb auf dem Papier möglich war, weil nur die Beschäftigung von Männern gezählt wurde.
3) Sind die Maschinen des Industriekapitalismus’ nicht mit den künstlichen Intelligenzen des Informationszeitalters vergleichbar, können letztere doch eben intelligent agieren und so z.B. für die Konstruktion einer nächsten Genration ihrer selbst (für ‘neue Jobs’) herangezogen werden. Der Qualitätssprung und der höhere Mehrwert einer KI sind exponentiell, so dass sie sich dem linearen Vergleich mit Qualitativität & Mehrwert eines Bio-Arbeitnehmers völlig entziehen. So kann z.B. ein Algorithmus mit chirurgischer Profession global beliebig oft eingesetzt werden, um Mechaniken zu bedienen, die (nebenbei ohne menschlich-ärztliche Kunstfehler) Operationen durchführen.
Zudem argumentiert Butterwegge in dem Gespräch wie gewohnt als Verfechter eines Nationalstaates mit sozialen Komponenten, so etwa im Sinne einer Sahra Wagenknecht, die Fürsprachen für ihn hält,2 mit der und deren Ehemann zusammen er als Dream-Team auftritt,3 deren gepredigter nationalen Abschottung er ‘argumentativ’ damit begegnet, dass es ein AfD-Wähler*innen-Abwerben nur in der CSU gäbe,4 in deren Sinne er Geflüchtete als Bedrohung der deutschen Gesellschaft zeichnet.5
Diese Reaktionarität Butterwegges wird eminent, wenn er sich in dem Gespräch wiederholt für einen ‘Sozialstaat’ ausspricht und damit die unwiederbringbare Vergangenheit des westdeutschen Sozialstaates im rheinischen Kapitalismus’ meint. Die historisch einmalige Konstellation (US-amerikanische Investition ins deutsche sog. ‘Wirtschaftswunder’ plus die Konkurrenz zum Sozialsystem der DDR) wird sich indes mit Sicherheit nicht wiederholen. Temporär konstruierbar wäre heute ein solcher ‘starker Sozialstaat’ nur mit einer ebenso starken Nationalstaatlichkeit und einer Ausgrenzung von z.B. Migrant*innen und Geflüchteten, auf dass die erwählten ‘Bio-Deutschen’ staatlich sozial versorgt werden. Selbst dann wäre es freilich fraglich, ob der abgekapselte Staat an der Weltökonomie partizipieren, geschweige denn, dass sich ein emanzipatorischer Kosmopolitismus in nächster Zukunft realisieren könnte.
Noch dazu gibt Butterwegge vor, es gäbe einen erhaltenswerten Sozialstaat („Ich teile ihre Schlussfolgerung allerdings nicht, dass wir den Sozialstaat völlig umkrempeln [...] müssen.“; „Sicher, auch der alte Sozialstaat realisiert die Bedarfsgerechtigkeit nicht in idealer Form. [...] versucht er wenigstens mit dem Wohngeld demjenigen, der ein kleines Einkommen, aber eine hohe Miete hat, gerecht zu werden.“; „[...] fürchte ich eher, dass der bestehende Sozialstaat auf der Strecke bleibt.“6), was nicht nur für jene, die zu wenig zum Leben bekommen, äußerst kontrovers sein dürfte.
Ebenso kontrovers ist es, wenn unter völliger Verkennung des gesellschaftlichen Zwangs zur Lohnabhängigkeit allein aus arbeitsideologischer Motivation gesagt wird: „Arbeiten wollen die Menschen, um etwas Sinnvolles zu tun, um sich für die Gesellschaft nützlich zu machen und um nicht dem Müßiggang zu erliegen.“7
Abgesehen davon, dass gerade die Arbeitsgesellschaft die Geburtsstätte von Langeweile (viel schlimmer als entspannter ‘Müßiggang’) ist: Die wenigstens Jobs transportieren Sinn oder Nützlichkeit für die Gesellschaft (allenfalls für das System). Die Menschen arbeiten freilich deshalb, weil sie Geld brauchen. Der Satz ist so entlarvend, dass es Butterwegge allein um den Erhalt der Arbeitsideologie geht, dass es nichts hilft, wenn er an anderer Stelle so tut, als würde ihm ein Ende der Lohnabhängigkeit (von ihm in ferne Zukunft projiziert) letztlich auch zusagen.8
Wenn dem Menschen Subsistenzmittel an die Hand gegeben würden (in Form eines BGE), würden Sinnhaftigkeit, gesellschaftliche Nützlichkeit und ein Ende der Langeweile in Jobs ja gerade erst entstehen können.
Gleichsam verkennt Butterwegge die systemtransformierende Kraft, die mit der Einführung eines Grundeinkommens in Gang gesetzt würde (wirkliches ‘Umkrempeln’ will er ja aber auch gar nicht, s.o.), ebenso wie er mit gesellschaftspolitischen Zukunftskonzepten sehr, sehr unvertraut ist. So kommt es, ausgehend von der richtig gestellten Frage, zu dem kuriosen Satz: „Deshalb stellt sich für mich in erster Linie die Frage, warum die Roboter nicht uns allen gehören und ob deren Vergesellschaftung nicht eine bessere Antwort auf den technologischen Umbruch namens Digitalisierung ist.“9
Vergesellschaftung ist ja nun gerade das Ziel aller emanzipatorischen Grundeinkommensideen. Ich wiederhole folgenden Absatz aus meinem Wider das Arbeitsethos 1:
Der Grundgedanke des linken BGE ist dabei aber weder eine bloße Reichtumsumverteilung, noch eine bloße Maßnahme zur Stimulation der Wirtschaft, denn seine Politik ist mehr als bloß reformistisch: „[...] die wahre Bedeutung eines bedingungslosen Grundeinkommens zeigt sich an der Art, wie es die Machtasymmetrie zerstört, die heute zwischen Kapital und Arbeit besteht. [...] Ein Grundeinkommen verändert diese Situation grundlegend, denn es gibt dem Proletariat unabhängig von einer Beschäftigung Subsistenzmittel an die Hand, Proletarier entscheiden dann selbst, ob sie ein Arbeitsverhältnis eingehen oder nicht. [...] Ein bedingungsloses Grundeinkommen befreit vom Zwang zur Lohnarbeit, dekommodifiziert in gewisser Weise die Arbeit und verändert so das politische Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit grundlegend.“ 10 Denn nunmehr ist das Individuum die maßgebliche Macht auf dem Arbeitsmarkt, es selbst entscheidet, ob der Arbeitsmarkt durch es eine biomenschliche Komponente bekommt oder nicht. Mit dem Individuumsbegriff wird deutlich, dass das ‘Ende der Arbeit’ radikal demokratisch und emanzipatorisch sein kann, was auch teilweise den Widerstand einer reaktionären und autoritären (z.B. marxistischen) Linken erklärt.
Butterwegge würde ich uneingeschränkt der letzten Gruppierung zurechnen.
II.
Mit der von Scnicek/Williams beschriebene Dynamik geht auch Precht kaum einig, immerhin weist er Butterwegge aber darauf hin, dass Grundeinkommen und Vergesellschaftung einander nicht widersprechen, ebenso wie er ‒ Precht ‒ das Gespräch mit den Worten beendet: „Deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass die Produktionsverhältnisse an sich so verändern, dass möglichst viele Menschen profitieren.“11
Nun ist Precht sicher niemand, dem im intellektuellen Diskurs Beachtung widerfährt. Auch wenn man hin und wieder einige schlüssige Sätze von im liest und aufgreift, habe ich selbst ihn eigentlich schon vor einem Jahrzehnt nach der haarsträubenden Lektüre von Wer bin ich ‒ und wenn ja wie viele (2007) als maßgeblichen intertextuellen Referenzpunkt abgehakt und in ihm vor allem einen Popularisierer von anspruchsvolleren Themen verstanden. Im Gespräch mit Butterwegge wird aber auf neue Abgründe aufmerksam gemacht. Abgesehen davon, dass man mit etwas Kenntnis der Materie oft weiterführendere Entgegnungen gegenüber Butterwegge hätte als Precht das tut.
Dennoch ist es recht süffisant, wenn Precht z.B. Butterwegge auf seine vermeintlich ‘gerechtere' Sozialstaat-Apologie kontert: „Sie haben eine geradezu holzhackerische Vorstellung davon, was Gerechtigkeit ist.“12
Genaugenommen ist das nicht nur süffisant, sondern inhaltlich auch richtig. Zum Gerechtigkeitsgedanken bemerkte ich schon anlässlich der gegenwärtigen Sonderausgabe von Hohe Luft mit Thomas Vašek :13
Ungerecht soll das BGE manchen auch deshalb erscheinen, weil am Ende doch nicht jede*r das Gleiche hat, wenn man die Gleichung 'BGE + existierendes Vermögen + Nebenverdienst durch „Arbeit“' aufstellt. Zum Einen wäre selbst bei einer simplen Gültigkeit der Gleichung immer noch ein Gerechtigkeitszuwachs zum bisherigen System auszumachen, welches manchen nur etwas unter dem Existenzminimum gibt. Zum Anderen wird die systemumwälzende Grundmotivation des emanzipatorischen Grundeinkommens verkannt, es finanziert sich ja gerade von den oberen Zehntausend her (sei es durch eine angemessene Vermögens-, Grund-, Maschinen- oder Finanztransaktionssteuer).
Statt den schnöden Zahlen verweist Vašek hier aber auf einen inhaltlich bedeutsamen Punkt: „Die Frage ist allerdings, ob wir Fragen der ökonomischen Gleichheit nicht überbewerten. „Unter moralischen Gesichtspunkten ist es nicht wichtig, dass jeder das Gleiche hat“, schreibt der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt in seinem provokanten Essay „Ungleichheit“: „Wichtig ist, dass jeder genug hat.“14
Auch Precht verweist in dem Gespräch mit Butterwege auf die Zunahme von Gerechtigkeit, nämlich, dass ein Mensch mit BGE nicht wie bei den heutigen Arbeitslosengeldbestimmungen Zusatzverdienste verrechnen/abgeben müsste.15
Insgesamt ist Precht aber (trotz der oben genannten Einlassungen zu Vergesellschaftung und Produktionsverhältnissen) vor allem irgendwo zwischen Neoliberalismus, Zynismus und auch Konservativismus gepolt, wenn er berechnet, dass ein Paar bei einem BGE von 1.500,- ja zusammen 3.000,- hätte und die Versorgung von Kindern damit zu tragen sei (den Elternteilen steht zudem ja frei, mit einem Job mehr zu verdienen).
Alleinerziehende mit mehreren Kindern aber spricht Precht gewissermaßen die Existenzberechtigung ab, wenn er sagt: „Ich möchte nicht, dass jemand, der 1500 Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen.“16 Und ja, so steht es Schwarz auf Weiß und es gibt auch keinen größeren Kontext, der das erklären würde. Die Skandalisierung in den sozialen Medien ist durchaus gerechtfertigt, wenn sie auch nicht immer die Reflektion in Sachen unserer Zukunft fördert.
Wenn jemand tatsächlich nur des Geldes wegen Kinder in die Welt setzen würde, könnte man das durchaus als unethisch beurteilen. Aber selbst wenn ein solcher Fall realiter vorkommen sollte, ist er für das Allgemeine irrelevant und es ist eine bösartige Unterstellung, die dann inkommensurabelerweise doch verallgemeinert, das Kindergeld sei eine häufige Motivation von sozial Schwachen. Tatsächlich haben Alleinerziehende, Geschiedene, Invalide, stetig Arbeitssuchende (und die werden in Zeiten der Digitalisierung bekanntlich aller Voraussicht mehr werden) einfach zuweilen Kinder und die haben in der Precht’schen Ich-möchte-nicht-Welt ein gewaltiges Problem. Man kann von Glück sprechen, dass individuelle Lebensentwürfe diesen Mann weder etwas angehen, noch dass er irgendeinen politischen Einfluss darauf hat.
Wie ich einleitend geschrieben habe: Der emanzipatorische Diskurs leidet, wenn der reaktionäre Butterwegge und der (nunmehr zynische) Hallodri Precht aufeinandertreffen. Beeinflusst werden kann der Diskurs durch diesen Precht’schen Totalausfall aber nur insofern, dass er ‒ der emanzipatorische Diskurs ‒ sich konkretisiert, differenziert, reflektiert und abgrenzt von jenen, die eben nicht eine sozial gerechte Versorgung der Multitude im Blick haben. Seriöse Verfechter*innen einer grundlegenden Existenzsicherung haben wohl auch bisher nur peripher auf Precht verwiesen.
Selbstverständlich lehnt die Mehrheit der Grundeinkommensdenker*innen die Versorgung von Kindern nicht ab. Pauschal lässt sich hier z.B. die Formel vom ‘halben BGE’ für Minderjährige nennen. Auch fordern nicht alle BGE’ler*innen ein grundsätzliches Streichen aller Bedarfszahlungen (z.B. an Invalide). Emanzipatorischer Argumentator*innen aber gibt es genug und (das sei auch den Arbeitsideolog*innen ans Herz gelegt):
Um die Aufgabe, dass wir selbst entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen, kommt niemand herum. Das mag das autoritäre Lager irritieren, weil es das kommunikative Aushandeln und Selbstdenken nicht gewohnt ist und sich lieber auf einen Marx beruft, aber es gibt nicht den fumdamentalistischenfixen Zukunftsentwurf, nicht das in Stein gemeißelte Grundeinkommenskonzept zur Versorgung der Multitude. Die Vorstellungen für unsere Zukunft muss sich ein*e Jede*r schon selbst erarbeiten und kommunizieren.
Wer nun sich nicht gleich in alle unten aufgelisteten Literaturempfehlungen vertiefen will, findet vielleicht in einem meiner Wider das Arbeitsethos-Aufsätze einen Einstieg:
Wider das Arbeitsethos 1: Während nach wie vor die Narrative des Arbeitsethos’ vielerorts propagiert werden, ist das Ende der Arbeitsgesellschaft unausweichlich. Ansätze für eine gerechtere postkapitalistische Zukunft jenseits der Arbeit sind aufzuzeigen und brauchbarere Erzählungen entgegenzusetzen. [https://www.freitag.de/autoren/rwagner/erzaehlungen-aus-der-zukunft-ii]
Wider das Arbeitsethos 2: Mit freigeistigen Denkern des 19. und 20. Jahrhunderts (Lafargue, Nietzsche, Read, Vaneigem ) wird aufgezeigt, wie der lutherisch-marxistische Arbeitsethos, der heute einer emanzipatorischen Politik im Wege steht, schon ab dem 19. Jahrhundert seine Gegenbewegten kannte, und das sogar in der sog. Arbeiterbewegung selbst. [https://www.freitag.de/autoren/rwagner/erzaehlungen-aus-der-zukunft-iii]
Wider das Arbeitsethos 3: Drei Denker*innen des 20. Jahrhunderts (Bogdanow, Arendt, Gorz), die Marx zu Gunsten einer sozialen und gerechten Post-Work-Gesellschaft überwinden und gleichsam die fauligen Stellen der Arbeitsideologie aufzeigen [https://www.freitag.de/autoren/rwagner/erzaehlungen-aus-der-zukunft-iv]
Das Philosophie Magazin enttäuscht freilich, wo es reaktionären bis menschenverachtenden Aussagen ein Forum gibt. Die Hoffnung stirbt aber zuletzt und sie wird von mir als nächstes (auf-)gelesen werden:
Schon auf dem Cover kündet ein Interview mit Antoni Negri und dessen Forderung nach einer neuen Revolution.
Literaturempfehlungen:
Nils Adamo, ‘Bedingungsloses Grundeinkommen. Sozialromantik oder Zukunft des Sozialstaates?’, Darmstadt 2012.
Hannah Arendt, ‘Vita activa oder Vom tätigen Leben’ (1958), München/Berlin/Zürich 2016.
Rutger Bregman, ‘Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen’, Reinbek bei Hamburg 2017.
Dietmar Dath, ‘Maschinenwinter. Wissen, Technik, Sozialismus. Eine Streitschrift’, Frankfurt am Main 2008.
André Gorz, ‘Wege ins Paradies. Thesen zur Krise, Automation und Zukunft der Arbeit’, Berlin 1983.
André Gorz, ‘Arbeit zwischen Misere und Utopie’ (1997), Frankfurt am Main 2000.
André Gorz, ‘Kritik der ökonomischen Vernunft. Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft’, Berlin 1989.
Michael Hardt/Antonio Negri, ‘Common Wealth. Das Ende des Eigentums’, Frankfurt am Main 2010.
Paul Lafargue, ‘Das Recht auf Faulheit’ (1883), Frankfurt am Main 2010.
Paul Mason, ‘Postkapitalismus. Grundrisse einer kommenden Ökonomie’, Berlin 2016.
Nick Srnicek/Alex Williams, ‘Die Zukunft erfinden. Postkapitalismus und die Welt ohne Arbeit’, Berlin 2016.
McKenzie Wark, ‘Molokulares Rot. Theorie für das Anthropozän’, Berlin 2017.
Anmerkungen
1 Zit. nach: ‘Muße als Möglichkeit’, S. 56-61; in: Philosophie Magazin, Nr. 05/2018, S. 57.
2 Vgl. http://www.taz.de/!5359036/
3 https://www.sahra-wagenknecht.de/de/topic/35.termine.htmlTermine?id=1069.
4 Vgl. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/christoph-butterwegge-bundespraesidentenkandidat-die-linke-bundeswehreinsaetze/seite-2.
5 Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/christoph-butterwegge-die-fluechtlingskrise-droht-die-armut.694.de.html?dram:article_id=340776
6 Zit nach: Muße als Möglichkeit, S. 58, S. 58f. u. S. 59.
7 Zit. nach: ebdd., S. 59.
8 Vgl. ebd., S: 60.
9 Zit. nach: ebd., S. 60.
10 Zit. nach: Nick Srnicek/Alex Williams, ‘Die Zukunft erfinden. Postkapitalismus und die Welt ohne Arbeit’, Berlin 2016, S. 198.
11 Zit. nach: Muße als Möglichkeit, S. 61.
12 Zit. nach: ebd., S. 59.
13 Vgl. https://www.freitag.de/autoren/rwagner/erzaehlungen-aus-der-zukunft-v.
14 Zit. nach: Thomas Vašek, ‘Befreit die Arbeit!’, S. 50-56; in: Hohe Luft kompakt, Sonderheft 1/2018, S. 55.
15 Muße als Möglichkeit, S. 58.
16 Zit. nach: ebd., S. 61.
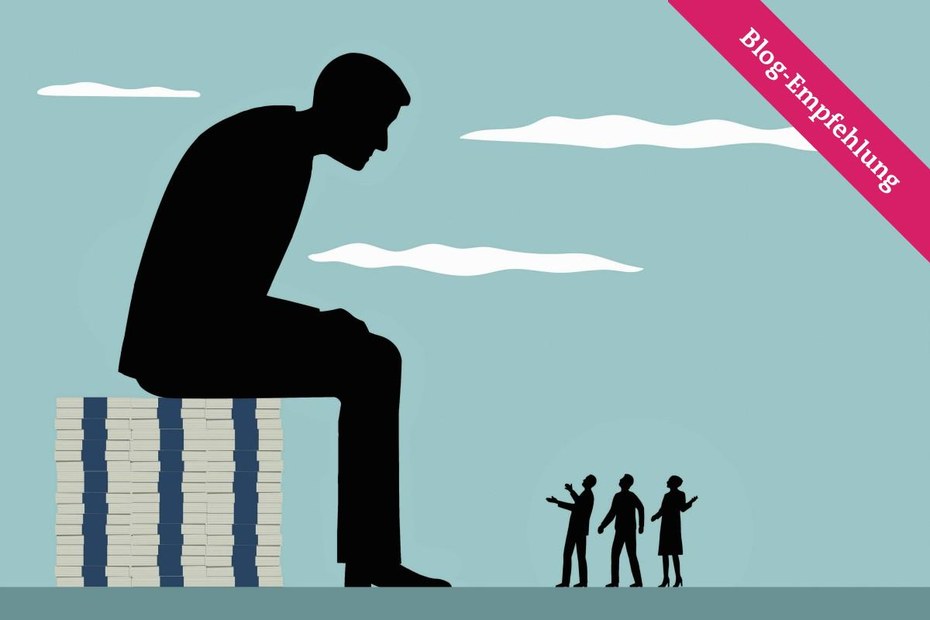





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.