Vor nicht allzu langer Zeit gestand Sean Parker, der 38-jährige Gründungspräsident von Facebook, in einem noch nie dagewesenen Anfall von Offenheit, dass das soziale Netzwerk nicht gegründet wurde, um uns zusammenzubringen, sondern um uns zu zerstreuen. "Der Gedankengang war: ‘Wie können wir möglichst viel von eurer Zeit und eurer bewussten Aufmerksamkeit binden und verbrauchen?'", erzählte er vergangenen November auf einer Konferenz in Philadelphia. Um dieses Ziel zu erreichen, machten Facebooks Architekten sich einen "wunden Punkt in der menschlichen Psychologie" zunutze, erklärte Parker, der 2005 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Jedes Mal, wenn jemand einen Post oder ein Foto like oder kommentiere, sagte er, "geben wir euch einen klein
Es lockt die Belohnung
Soziale Medien Die großen Tech-Konzerne des Silicon Valley sind eifrig dabei, uns von Apps und sozialen Medien abhängig zu machen. Dabei bauen sie auf die Hilfe eines Neurotransmitters
Exklusiv für Abonnent:innen
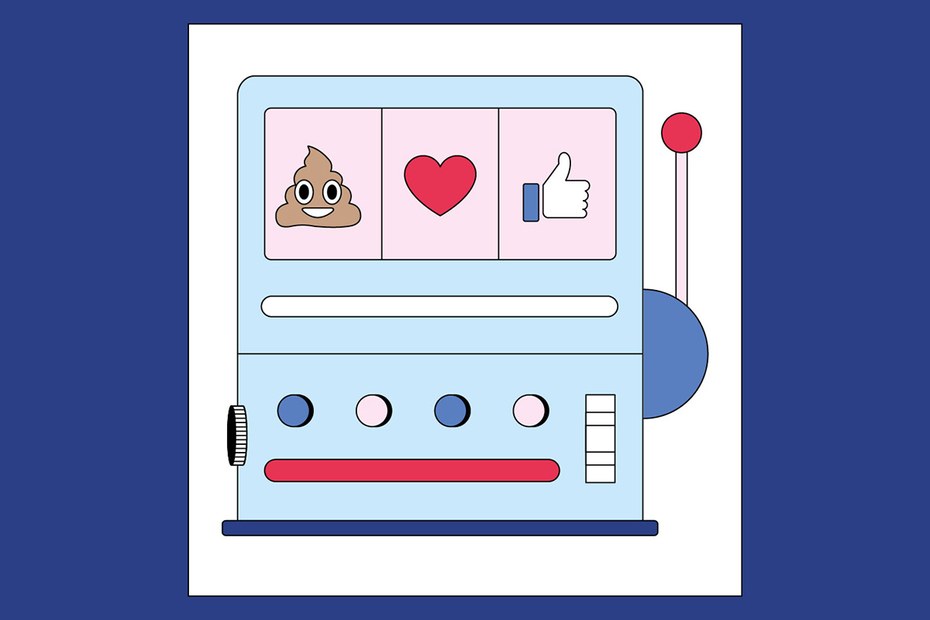
Ob Spielautomaten oder Soziale Medien – beide arbeiten mit unregelmäßigen Belohnungen
Illustration: Susann Massute für der Freitag
e er, "geben wir euch einen kleinen Dopamin-Stoß". Wurde das Facebook-Imperium also auf einem Molekül errichtet?Das 1957 entdeckte Dopamin ist einer von ungefähr 20 wichtigen Neurotransmittern, die wie sich durch den Verkehr schlängelnde Fahrradkuriere dringende Botschaften zwischen Neuronen, Nerven und anderen Zellen im Körper hin- und hertransportieren. Diese Neurotransmitter stellen sicher, dass unser Herz immer weiterschlägt, unsere Lungen immer weiteratmen und wir – im Falle von Dopamin – wissen, dass wir ein Glas Wasser brauchen, wenn wir Durst haben, oder versuchen uns fortzupflanzen, damit unsere Gene unseren Tod überleben.In den 1950er Jahren wurde Dopamin in erster Linie mit körperlicher Bewegung in Verbindung gebracht, nachdem eine Studie gezeigt hatte, dass Parkinson (eine Gruppe neurologischer Erkrankungen, zu deren Symptomen auch Zittern, verlangsamte Bewegungen und Versteifungen gehören) durch Dopaminmangel verursacht wird. Nachdem Wolfram Schultz, der heute Professor für Neurowissenschaften an der University of Cambridge ist, eine Reihe von Experimenten mit Ratten durchgeführt hatte, wurde man in den 1980er Jahren auf eine andere Funktion des Moleküls aufmerksam. Die Experimente zeigten, dass Dopamin im Mittelhirn mit der Belohnung für eine bestimmte Verhaltensweise oder Handlung zusammenhängt. Dopamin, so schien es, hatte etwas mit Verlangen, Ehrgeiz, Sucht und Sexualtrieb zu tun.Schultz und seine Forscherkolleginnen platzierten Apfelstücke hinter einem Bildschirm und sahen sofort eine starke Dopaminreaktion, als die Ratte in die Nahrung biss. Dieser Vorgang, der vor allem bei Insekten und Säugetieren beobachtet werden könne, stelle die Grundlage des Lernens dar, so Schultz. Bei dem Prozess werde die Belohnung für eine Handlung anizipiert. Der Vorgang ermögliche, dass das Verhalten, wenn die Belohnung erhalten wurde, zu einer Gewohnheit oder, falls nötig, gegebenenfalls angepasst wird. (Die Kapsel für die Spülmaschine mag zwar auf den ersten Blick aussehen wie eine köstliche Süßigkeit, doch der erste Biss wird zugleich der letzte sein.) Ob Dopamin ein angenehmes Gefühl erzeuge, sei unklar, so Schultz. Seinem Ruf als Glücklichmacher hat allerdings nicht geschadet.Placeholder infobox-1Dopamin regt uns zu Handlungen an, mit denen wir unsere Bedürfnisse und Wünsche befriedigen – vom Einschalten der Heizung bis hin zum Drehen eines Roulettrads – indem es vorwegnimmt, wie wir uns fühlen, nachdem wir das Verlangen gestillt haben. Pinterest, eine Onlineplattform, auf der die User inspirierende Bilder hochladen, enthält endlose Galerien von Tattoos mit der chemischen Formel von Dopamin, während sich Amazons virtuelle Regale unter dem Gewicht von Diätbüchern biegen, die den Dopaminspiegel erhöhen und die psychische Gesundheit steigern sollen. "Wir haben im Gehirn ein Signal gefunden, das unsere grundlegendsten Verhaltensweisen erklärt, die jeder von uns permanent an den Tag legt", sagt Neurowissenschaftler Schultz. "Mir ist klar, warum die Öffentlichkeit sich dafür interessiert."Modewort im Silicon ValleySo ist Dopamin – anders als seine weniger bekannten Mitarbeiter Norepinephrin und Asparagin – berühmt geworden. Vaughan Bell, ein klinischer Psychologe aus Großbritannien, hat Dopamin einmal als "die Kim Kardashian der Moleküle" beschrieben und die Regenbogenpresse kann gar nicht genug von dem Stoff kriegen. "Machen Cupcakes ebenso süchtig wie Kokain?", lautete etwa eine Schlagzeile in der britischen Sun. Der dazugehörige Artikel zitierte eine Studie, die zeigte, dass bei Probanden, denen Bilder ihres Lieblingsessens gezeigt wurden, Dopamin im orbitalen Frontalkortex freigesetzt wird – „derselbe Bereich, der aktiviert wird, wenn Kokain-Abhängigen ein Tütchen mit erstklassigem Stoff gezeigt wird" . Doch nirgends wird der Begriff Dopamin so inflationär verwendet wie im Silicon Valley, wo der Stoff als die geheime Macht gepriesen wird, die eine App, ein Game oder eine soziale Plattform "sticky" macht – was im Investorensprech soviel wie "potenziell profitabel" bedeutet. "Bereits ein Jahr bevor die Szene der sogenannten persuasiven Technik größer wurde, besaß Dopamin ein gewisses Sex-Appeal und entsprach voll dem Zeitgeist," erklärt Ramsay Brown. Der 28-Jährige ist Mitbegründer von Dopamine Labs, einem umstrittenen kalifornischen Start-up, das verspricht, die Intensität, mit der Menschen Lauf-, Diät- oder Spiele-Apps nutzen, signifikant zu erhöhen. "Es ist das "Sex, Drugs and Rock’n’Roll"-Molekül. Während es viele wichtige und faszinierende Fragen gibt, die diesem Molekül zugrunde liegen, horchen die Leute, wenn man Dopamin sagt, auf eine Art und Weise auf, wie das bei ‘Encephalin’ oder ‘Glutamat’ nicht der Fall ist. Man weiß, dass das der Transmitter ist, der Spaß macht."Im Bann der WillkürSpaß, vielleicht, aber wie Kim Kardashian hat Dopamin nicht immer nur beste Presse. In einem Artikel mit der Überschrift "How evil is tech?" aus dem Jahr 2017 schrieb der New York Times-Kolumnist David Brooks: "Technikunternehmen wissen, was den Anstieg von Dopamin im Gehirn auslöst, und sie statten ihre Produkte mit technischen Eigenschaften aus, die uns an die Produkte binden und ‘zwanghafte Schleifen’ entstehen lassen." Die meisten Social-Media-Seiten würden unregelmäßige Belohnungen ausgeben, schrieb Brooks – eine Technik, die schon lange von den Entwicklern von Spielautomaten angewendet wird, und die auf den Arbeiten des amerikanischen Psychologen BF Skinner basiert. Dieser fand heraus, dass die nachhaltigste Methode, bei Ratten ein erlerntes Verhalten zu verfestigen, darin besteht, es auf einer willkürlichen Basis zu belohnen. "Wenn ein Spieler das Gefühl hat, das Glück sei ihm hold, wird Dopamin freigesetzt", sagt Natasha Schüll, Professorin an der New York University und Autorin des Buches "Addiction By Design: Machine Gambling in Las Vegas". Hier liegt das Geheimnis von Facebooks epochenprägendem Erfolg: Wir checken die Seite zwanghaft, weil wir nie wissen, wann das köstliche Klingeln der sozialen Bestätigung das nächste Mal ertönen wird.Zufall und Willkür stehen daher auch beim Service von Dopamine Labs im Mittelpunkt – einem System, das in jede App integriert werden kann, die dafür entwickelt wurde, ein bestimmtes Verhalten zur Gewohnheit werden zu lassen. Bei einer Lauf-App bedeutet das beispielsweise, dass nur in unregelmäßigen Abständen Ermunterung – in Form eines High-five-Badges oder eines digitalen Konfettiregens – erfolgt, und nicht jedes Mal, wenn der Läufer oder die Läuferin eine Runde gedreht hat. "Wenn der Läufer seinen Lauf beendet hat, kommuniziert die App mit unserem System und fragt, ob es überraschend für ihn wäre, wenn wir ihm ein wenig enthusiastischer gratulieren würden", erklärt Brown. Die firmeneigene künstliche Intelligenz von Dopamine Labs fertigt einen Plan an, nach dem der Einzelne Belohnungen erhält. "Sie könnte zum Beispiel sagen: Jetzt gerade wäre es für ihn ziemlich erwartbar, also gib es ihm nicht. Oder sie sagt: Ab dafür!"Auch wenn das lächerlich wenig erscheinen mag (bei einem Spielautomaten besteht die Belohnung immerhin aus Geld – ein weitaus größerer Anreiz als irgendeine Belohnung in Form eines digitalen Signals), verzeichnet das Unternehmen, das die Lauf-App vertreibt, Brown zufolge bereits erhebliche positive Ergebnisse. "Wenn man das gründlich macht, verbessert sich die Häufigkeit, mit der jemand laufen geht, durchschnittlich um 30 Prozent." Dopamine Labs, das gegenwärtig zehn Kunden betreut, kennt ähnlich positive Resultate von anderen Arten von Apps. Bei einem Diät-Service, der einen dazu anhält, seine Mahlzeiten zu dokumentieren, konnte ein Anstieg um 111 Prozent erreicht werden, nachdem es das System von Dopamine Labs integriert hatte. Ein Kleinkredit-Service verzeichnete eine Verbesserung um 14% – von den Kreditnehmern zahlten mithilfe der App 14 Prozent mehr ihren Kredit rechtzeitig oder vorzeitig zurück. "Eine App gegen Cybermobbing verzeichnete eine Verbesserung um 167 Prozent hinsichtlich der Häufigkeit, mit der junge Leute sich gegenseitig ermutigende Mitteilungen schickten, indem sie kontrollierte, wann und wie oft wir ihnen eine Belohnung in Gestalt eines animierten Gifs zuschickten", behauptet Brown."Wir missbrauchen ein nützliches und notwendiges System"Wir beginnen gerade erst zu verstehen, welche Fähigkeit die sogenannte „persuasive Technologie“ hat, unser Verhalten in dieser Weise zu beeinflussen. Bei Drogenabhängigen und Raucherinnen ist die Macht des Dopamin-Systems, Gewohnheiten zu verändern, allerdings seit langem bekannt. Jede suchterzeugende Substanz, von Amphetamin bis Kokain, von Nikotin bis Alkohol, beeinflusst das Dopamin-System, indem es ein Vielfaches an Dopamin verteilt als gewöhnlich. Der Gebrauch dieser Drogen überflutet die Nervenbahnen, die das Belohnungssystem mit dem präfrontalen Cortex verbinden. Letzterer hilft einem, Impulse zu zügeln. Je mehr ein Süchtiger eine Substanz konsumiert, desto schwerer fällt es ihm daher, wieder damit aufzuhören.„Diese unnatürlich großen Belohnungen werden im Gehirn nicht gefiltert – sie gehen direkt ins Gehirn und sorgen für einer Überstimulierung, die zu einer Abhängigkeit führen kann“, erklärt Wolfram Schultz von der University of Cambridge. „Wenn das passiert, verlieren wir unsere Willenskraft. Die Evolution hat unsere Gehirne nicht auf diese Drogen vorbereitet, so dass sie überwältigt und verdorben werden. Wir missbrauchen ein nützliches und notwendiges System. Wir sollten das nicht tun, auch wenn wir es können.“ Die Macht von Dopamin, ein Leben negativ zu beeinflussen, kann gut an den Auswirkungen mancher Parkinson-Medikamente abgelesen werden, die nachweislich fast zehn Prozent der Patienten zu Spielsüchtigen gemacht haben, indem sie das Gehirn mit Dopamin überfluten.Eine ethische HerausforderungRamsay Brown und seinen Kollegen bei Dopamine Labs ist bewusst, dass sie mit dem Feuer spielen. Sie behaupten, sie hätten einen feste ethische Rahmenbedingungen für die Art von Unternehmen und App-Herstellern entwickelt, mit denen sie zusammenarbeiten. „Wir haben Zeit mit ihnen verbracht, verstehen, was sie entwickeln und warum“, sagt er. „Der Ethik-Test sieht in etwa so aus: Soll diese App das menschliche Verhalten verändern? Fördert diese App, dass die Menschen, die sie benutzen, sich zu ihrem eigenen Nutzen verändern? Wenn nicht, verschlechtert sie ihren Zustand wenigstens nicht?“ Dopamine Labs habe bereits Wettunternehmen und die Entwickler kostenloser Videospiele abgewiesen, die die Dienste des Unternehmens nutzen wollten, um bestimmte Gewohnheiten bei ihren Spielern zu entwickeln.Gut gemeinte Strategien haben häufig ungewollte Folgen. „Ich weiß nicht, ob diese App jemanden süchtig machen kann“, sagt Neurowissenschaftler Schultz, der für die Entdeckung der Auswirkungen von Dopamin 2017 zusammen mit zwei anderen Forschern den mit einer Million Euro dotierten Brain Price erhalten hat. „Doch die Idee hinter der Verhaltensökonomie, dass wir das Verhalten anderer nicht mithilfe von Drogen oder Schlägen auf den Hinterkopf ändern können, sondern indem wir sie in bestimmte Situationen bringen, ist umstritten. Wir sagen anderen, was gut für sie ist. Das birgt Risiken. Menschen über Systeme so zu trainieren, dass für bestimmte Handlungen Dopamin freigesetzt wird, könnte sogar Situationen verursachen, in denen die Leute nicht mehr von dem System loskommen. Ich sage nicht, dass Technikunternehmen etwas Schlechtes machen. Vielleicht helfen sie ja. Aber ich wäre vorsichtig.“Für Ramsay Brown hingegen besteht der sicherste und logischste Weg, den menschlichen Verstand weiterzuentwickeln, darin, dieses natürliche Molekül für die Entwicklung positiver Gewohnheiten zu nutzen. „Wir können die Lücke zwischen gewünschtem und tatsächlichem Verhalten schließen und Systeme erstellen, die den Zustand der Menschen verbessern und ihr Wohlergehen fördern“, sagt er. „Unser Produkt ist ein Spielautomat, der für Sie spielt.“
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.