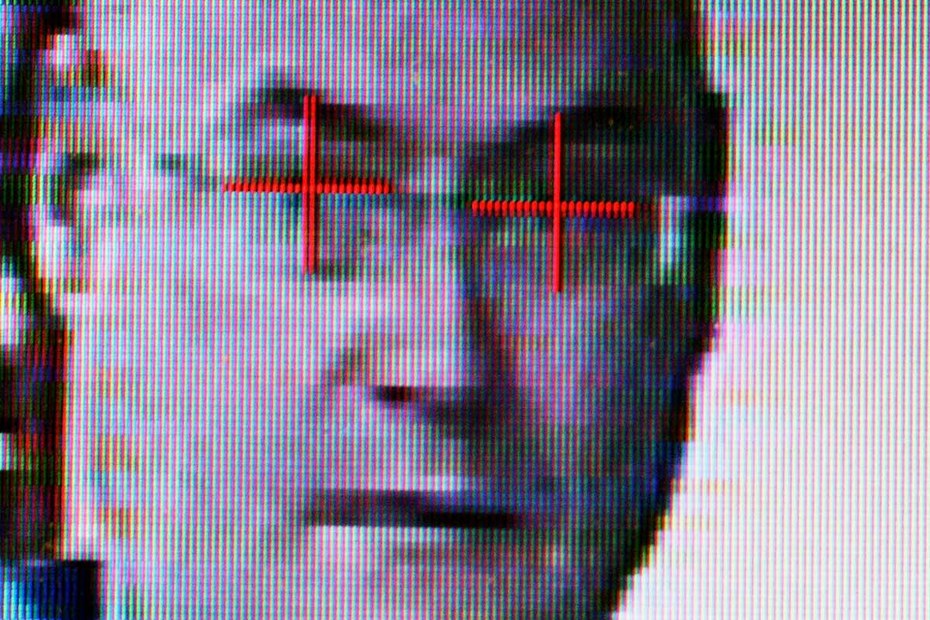Nach Jahren, in denen Regierungen weltweit sich von den Vorzügen von Big Tech blenden ließen, erkennen sie endlich auch die Probleme, die damit einhergehen. In Indien, Australien, Frankreich, den USA und jetzt auch in Großbritannien beschäftigen sich Politiker damit, welcher Umgang mit der Bedrohung durch die größten Technologieplattformen geboten sei. Dabei scheinen sie alle auf die gleiche Antwort zu verfallen: Mehr Wettbewerb ist demnach der Zaubertrick, mit dessen Hilfe die digitalen Riesen gezähmt werden sollen, Innovation vorangetrieben und unsere digitale Welt wieder in Ordnung gebracht werden soll.
Aber was, wenn Wettbewerb das Problem und nicht die Lösung ist? Immerhin ist es der Wettbewerb – nicht die Größe der Unternehmen
rnehmen –, der immer mehr Daten, mehr Aufmerksamkeit, mehr Kundenbindung und mehr Profit um jeden Preis fordert. Es ist der Wettbewerb, der Google, Facebook und Amazon dazu zwingt, zu expandieren. Und schließlich ist es der Wettbewerb um Werbeeinnahmen, der die Tech-Giganten dazu bringt, Fragen der Privatsphäre zu ignorieren und immer mehr Daten zu sammeln. Um die Vorherrschaft über Sprachschnittstellen und Smart-Home-Daten zu erlangen, drängen Google und Amazon aggressiv Überwachungsgeräte in unsere Wohnungen.Deswegen statten Apps und Plattformen ihre Produkte mit größtmöglichem Suchtpotenzial aus. Der Wettbewerb um Nutzer und Nutzerbindung ist auch der Grund, dass Twitter, Facebook und andere bei Missbrauch, Fake News und rechtsextremer Radikalisierung ein Auge zudrücken. Der Wettbewerb darum, wer der vorherrschende Anbieter für künstliche Intelligenz sein wird, treibt die Tech-Giganten dazu, sich immer neue Datenquellen einzuverleiben. Wenn also Regierungen noch mehr Wettbewerb befördern, dann werden sie nichts anderes erreichen, als dass sich diese Probleme verschärfen.Wenn aber mehr Wettbewerb die großen Internetfirmen nicht im Zaum halten kann, was dann? Allzu häufig geht es bei dieser Frage darum, was Regierungen tun sollen und was Verbraucher tun könnten. Die Rolle der Arbeitskräfte wird vernachlässigt. Das aber ist ein Fehler: Größere und stärkere Gewerkschaften in der Digitalindustrie können ein wichtiges Gegengewicht zur Macht von Big Tech sein. Denn ein Bereich, in dem mangelnder Wettbewerb wirklich ausschlaggebend ist, ist das Lohn- und Gehaltsniveau: Studien belegen: Je größer und dominierender die Unternehmen in einer bestimmten Industrie sind, desto stärker werden die Löhne gedrückt.Es wäre also sinnvoll, Beschäftigte im Digitalsektor in Gewerkschaften zu organisieren. Obwohl sie noch in den Kinderschuhen stecken, haben solche Gewerkschaften bereits deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Weigerung, mit dem Überwachungsstaat zusammenarbeiten, erreicht. Auch was die Offenlegung des latenten Sexismus und Rassismus der Internetindustrie angeht, können sie Erfolge vorweisen. In Großbritannien etwa hat die Independent Workers Union bereits einiges für die grundlegenden Rechte der Solo-Selbstständigen der sogenannten „Gig Economy“ getan.Die doppelte EisenbahnEin zweiter Schritt bestünde darin, soziale Medien als eben die öffentlichen Einrichtungen zu regulieren, die sie sind. In der Vergangenheit zögerten Regierungen nicht, natürliche Monopole zu regulieren, wenn es um Dienstleistungen ging, die öffentliche Güter darstellten. So war es etwa nicht sinnvoll, zwei Paar Eisenbahnschienen nebeneinander zu verlegen, nur um des Wettbewerbs willen. In solchen Fällen waren Monopole unvermeidlich, weshalb sie strengen Regulierungen unterworfen wurden, um sicherzustellen, dass sie dem Gemeinwohl dienten und nicht nur privatem Profit.Derartige Regulierungen könnten heute auf einige der von Digitalfirmen angebotenen Dienstleistungen angewendet werden. Es könnte etwa geregelt werden, wie diese Unternehmen persönliche Daten sammeln und nutzen dürfen. Ebenso könnten Voraussetzungen definiert werden, um Urheber- und Patentlizenzen kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Das hat etwa die US-Senatorin Elizabeth Warren kürzlich zum Umgang mit den großen Technologieunternehmen vorgeschlagen.Wir könnten aber auch weiter gehen und die Plattformen verstaatlichen, anstatt sie in privater Hand zu lassen. Damit würde man Eigentum und Kontrolle in die Hände der Beschäftigten, der Nutzer und Bürger geben. Ein Beispiel: Es ist bekannt, dass private Fahrdienst-Apps wie Uber negative soziale Kosten erzeugen, Verkehrsbelastung und Luftverschmutzung etwa. Wäre eine derartige Plattform im Besitz der öffentlichen Hand, dann könnte sie ihre Ziele viel breiter stecken, als nur mehr Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Öffentliche Nahverkehrsanbieter könnten eine Fahrten-Sharing-App aufbauen und unterhalten, die Mobilität mit niedrigem Emissionsausstoß ermöglicht. Die Daten dieser Plattform könnten dann mit anderen öffentlichen Einrichtungen geteilt werden, was Möglichkeiten für eine bessere Planung von Wohnraum und Transport eröffnen würde.Genauso könnten wir entscheiden, die Kontrolle über Cloud-Dienste aus den Händen von Amazon, Google und Microsoft zu befreien. Wir könnten den Zugang zu Computern und dem Internet als Grundversorgungsdienstleistung des 21. Jahrhunderts denken. Es gibt keinen Grund, warum Regierungen ihren Bürgern keinen freien Zugang zu einer öffentlichen Cloud ermöglichen sollten, die persönlichen Datenschutz, Sicherheit, Energieeffizienz und gleichen Zugang für alle gewährleistet.Wir müssen dringend handeln, wenn wir die wachsende ökonomische und politische Macht der großen Digitalfirmen eindämmen wollen. Mehr Wettbewerb wird die Probleme eher verschärfen denn lösen.Placeholder authorbio-1