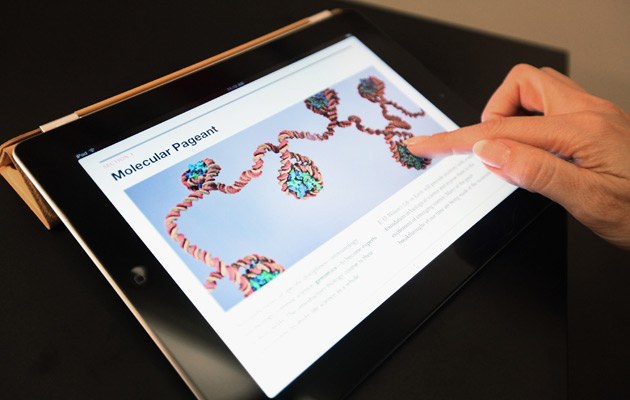Die Gewinner der massiven Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben, die während der vergangenen drei Jahrzehnte in den USA und vielen anderen reichen Ländern stattgefunden hat, machen für diese Entwicklung gerne die technologische Entwicklung verantwortlich, weil diese sich weitgehend unserer Kontrolle entzieht und man so leider nichts an der wachsenden Ungleichheit ändern kann. Pech gehabt.
Denn es gibt niemanden, der darüber entscheidet, in welche Richtung die Innovationen in Computertechnik, Automation oder Medizin sich entwickeln werden. Wissenschaftler und Ingenieure, die auf diesen Gebieten arbeiten, verfolgen jede Spur, die sich ihnen bietet und schaffen Innovationen, wo sie nur können. Wenn das Resultat dieser Innovationen in ei
n, verfolgen jede Spur, die sich ihnen bietet und schaffen Innovationen, wo sie nur können. Wenn das Resultat dieser Innovationen in eine ungleichere Gesellschaft mündet, ist das bedauerlich, aber man kann der Technologie schließlich nicht böse sein. Oder?Man kann auch eine andere Geschichte erzählen. Nach ihr war die Umverteilung von Einkommen von unten nach oben eine bewusste Entscheidung der politisch Handelnden und Mächtigen. Sie weist auf eine Reihe verschiedener Maßnahmen: Setzt man die im produzierenden Gewerbe beschäftigten Arbeiter der Konkurrenz von Niedriglöhnern in Entwicklungs- und Schwellenländern aus, während man gut Ausgebildete (wie Ärzte oder Anwälte) beschützt, so sollte es einen nicht wundern, wenn dies die Löhne der Arbeiter im produzierenden Gewerbe ebenso drückt wie die derjenigen, die mit den freigesetzten Arbeitern um einen anderen Arbeitsplatz konkurrieren.Zentralbanken, die einer niedrigen Inflationsrate verpflichtet sind, selbst wenn dies auf Kosten einer höheren Arbeitslosenquote geht, tragen ebenso zur Vergrößerung der Ungleichheit bei. Wenn eine Zentralbank wie die Fed die Zinssätze erhöht, um das Wirtschaftswachstum zu bremsen und die Inflationsgefahr zu reduzieren, dann sind es Fabrikarbeiter und Beschäftigte im Einzelhandel, die ihre Jobs verlieren, nicht Ärzte und Anwälte. Selbst ein Wirtschaftswissenschaftler kann sich ausrechnen, dass dies die Löhne der ersteren zugunsten der letzteren drücken wird.Und wenn eine Regierung sich mit einem einseitigen Ansatz der Durchsetzung arbeitsrechtlicher Bestimmungen nähert, so dass die Gerichte zugunsten des Managements einschreiten und die Position der Gewerkschaften schwächen, verringert das die Verhandlungsmacht der Belegschaft. Das resultiert in geringeren Löhnen für gewöhnliche Arbeiter und höheren Unternehmensprofite und Vergütungen für die Manager an der Spitze.Diese und andere politische Veränderungen der vergangenen drei Jahrzehnte können die massive Umverteilung von Einkommen während dieser Phase erklären. Sie wurden von Menschen ins Werk gesetzt und tragen überall die Fingerabdrücke der oberen ein Prozent der Gesellschaft, auch wenn diese von vielen oft nicht erkannt werden.In diesem Kontext müssen wir den Ungleicheitsbericht sehen, den die OECD Ende vergangenen Jahres herausgab. Er enthielt zwar viele interessante Daten und nützliche Analysen – der entscheidende Bösewicht in der Geschichte, die er von der Ungleichheit erzählte, war allerdings auch hier die Technologie.Dies führte zu dem freudigen Schluss, dass die, die das Sagen haben, keine Verantwortung an der Ungleichheit tragen. Als anständige menschliche Wesen machten sie zwar Vorschläge, wie man dem Schaden begegnen könnte, den die Techologie angerichtet hat, aber das taten sie nur, weil sie eben gute Menschen sind. Damit, das rückgängig zu machen, was eine zielgerichtete Poltik verursacht hatte, hatte das nichts zu tun.Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Technologie-Geschichte der OECD allerdings als falsch. Mein Kollege am Center for Economic and Policy Research, David Rosnick hat die Studie kritisch überprüft und ist auf einige Unstimmigkeiten und Fehler gestoßen. Es wurden unter anderem Variablen die Technologietrends und -zyklen betreffend miteinander vertauscht.Im Grunde zeigen ihre Resultate (wie die unsrigen), dass die Ausgaben für technologische Erneuerungen einen Einfluss auf die Ungleichheit über den Lauf eines Konjunkturzyklus haben können, dass aber die erhöhten Ausgaben in diesem Bereich über den Zeitraum der vergangenen drei Jahrzehnte hinweg keinen Einfluss auf die Entwicklung der Ungleichheit in der Gesellschaft hatten.Die Analyse der OECD kommt zu dem Schluss, dass ein geringerer Grad gewerkschaftlicher Organisierung und geringere Rechte der abhängig Beschäftigten zum Anstieg der Ungleichheit beigetragen haben, obwohl dieser Anstieg durch die höhere Qualifikation der Arbeitskräfte ausgeglichen wurde. Unterm Strich konnte ihre Analyse den von ihr festgestellten Zuwachs an Ungleichheit in keinem Punkt erklären.Der Anstieg der Vergütungen bei den Finanzdienstleistern hatte unseren Untersuchungen zufolge (im OECD-Bericht spielt dies gar keine Rolle) wenig überraschend großen Anteil am Anstieg der Ungleichheit. Schließlich müssen die schweren Gehaltschecks der Wall Street-Crew ja von irgendwoher kommen. Und unserer Analyse zufolge kamen sie von denjenigen, die in der Einkommensverteilung unter dem 90ten Perzentilwert liegen.Kurz gesagt hat die OECD versucht, einen Band herauszubringen, der die Geschichte stützt, die Ungleichheit im Einkommensniveau sei auf die Technologie zurückzuführen. Wenn sie exakt arbeiten, stüzt ihre Analyse diese These aber keineswegs. Wenn man ihre Analyse so verändert, wie wir dies getan haben, rückt auf einmal die Finanzindustrie als ein Hauptverantwortlicher in der Ungleichheitsgeschichte in den Fokus.Falls wir also ernsthaft die Ungleichheit abbauen wollten, müsste die Regulierung des Finanzsektors dabei eine hervorgehobene Rolle spielen. Eine Steuer auf Finanzspekulationen zum Beipsiel wäre ein guter Anfang.