Wenn das aus Bill Clintons Wahlkampf bekannte Diktum „It’s the economy, stupid!“ auch 2012 gilt, dann hat Barack Obama die Präsidentschaftswahl schon verloren. Denn in den USA liegt die Arbeitslosigkeit derzeit bei acht Prozent. Der Republikaner Mitt Romney kann die Wahl eigentlich nur noch selbst verlieren. Mit der Nominierung des konservativen Hardliners Paul Ryan zum Kandidaten für die Vizepräsidentschaft ist allerdings eine Richtungswahl wahrscheinlicher geworden. Die Abstimmung über die Wirtschaftslage und Obamas Leistung tritt dagegen in den Hintergrund. Sollte sich an der gleichgültigen oder gar ablehenden Wahrnehmung Romneys nichts ändern, trotz der Millionen von Dollar, die derzeit von seinen Wahlkämpfern dafür eingesetzt w
No, you can’t
Wahl 2012 Die Demokraten haben in allen großen Fragen den Republikanern das Feld überlassen müssen. Da ist es fast schon egal, ob Barack Obama noch einmal Präsident wird
Exklusiv für Abonnent:innen
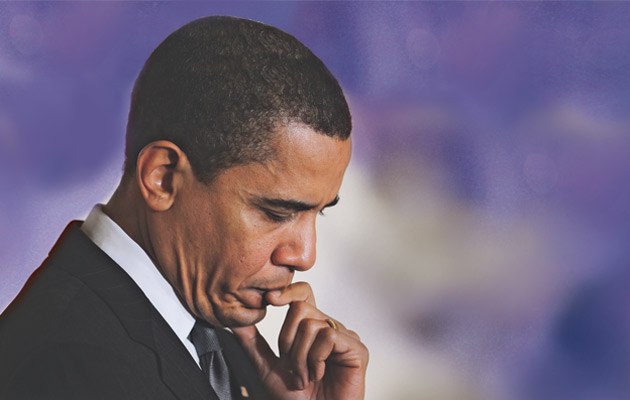
Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images
t werden, sein Image zu verbessern, wird Obama die Wahl wohl knapp gewinnen. Was würde Obama mit einer zweiten Amtszeit anfangen?Eines ist sicher: Es wird keine weitere Enttäuschungsfalle geben. Obamas Anhänger sind ernüchtert, insbesondere diejenigen, die ihn für einen Linken oder gar einen Heilsbringer gehalten haben. Es hat sich gezeigt, dass die von Obama aufgebaute Grassroots-Organisation nicht als Unterbau für den versprochenen gesellschaftlichen Wandel gedacht war, sondern für die Wiederwahl. Und trotz Friedensnobelpreis ist Obama eben Präsident einer Weltmacht, Drohnenangriffe inklusive.Der politische Gegner sieht in Obama gleichwohl unverdrossen einen Extremisten. Die Polarisierung der US-Gesellschaft hat sich durch Obamas historischen Wahlsieg 2008 noch verschärft. Nicht weil der Präsident es inhaltlich oder im Stil darauf angelegt hätte, sondern weil er verkörpert, womit die Republikaner seit den späten sechziger Jahren ihre Politik der Angst machen: Die Ansprüche von Minderheiten auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Teilhabe – und ihre wachsende Bedeutung im Land. Für 2050 wird prognostiziert, dass die Summe der Minderheiten die Zahl der weißen Amerikaner übersteigt. Der Aufruf der konservativen Tea-Party-Anhänger lautet schon jetzt: „Wir wollen unser Land zurück.“Verdrängte DemokratenDie Polarisierung des Landes beruht letztlich nicht auf starken programmatischen Kontrasten zwischen den Parteien. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer hegemonialen Spaltungsstrategie der Republikaner und der gleichzeitigen strategischen und programmatischen Schwäche der Demokraten. Während Letztere sich auf Wahlsiege und die Verteidigung von Resten des Wohlfahrtsstaats verlegten, bauten die Republikaner gezielt eine landesweite Infrastruktur von Stiftungen, Think Tanks und anderen Instituten auf, um die Hegemonie des verhassten New Deals zu überwinden. Geld floss und fließt reichlich von denen, die an niedrigen Steuern und geringer staatlicher Regulierung interessiert sind. Doch die nötigen Wählerstimmen konnten letztlich nur durch den Aufruf von Vorbehalten der weißen (Noch-)Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Ansprüchen von Minderheiten gewonnen werden, zunächst im Süden der USA, dann in den Vorstädten, nun überall.Heute hat sich diese rechtspopulistische Strategie so verselbstständigt, dass die Republikaner von den Stimmen gerade der weißen Arbeiter- und unteren Mittelschichten (also denen ohne College-Abschluss und mit Jahreshaushaltseinkommen zwischen 30.000 und 100.000 Dollar), die von der Wirtschafts-, Sozial- und vor allem Steuerpolitik der Demokraten profitieren würden, abhängig sind. Die USA steuern damit auf ein ethnisch polarisiertes Zweiparteiensystem zu, wenn es den Demokraten nicht gelingt, die weißen Arbeiter- und untere Mittelschichten jenseits der gewerkschaftlich organisierten Wähler wirtschafts- und sozialpolitisch stärker anzusprechen.Die erste Amtszeit Barack Obamas zeigte ebenso eindrücklich die Hegemonie der Republikaner wie die strategische Schwäche der Demokraten. Trotz anfänglich klarer Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses, die jegliche Blockadeversuche der Republikaner im Senat hätten zunichtemachen können, fehlte den Demokraten ebenso die Geschlossenheit wie eine gemeinsame Agenda. Sie verfügten auch nicht über ein wirkliches Mandat der Wähler. Denn diese hatten unter dem Eindruck der Finanzkrise vor allem die desaströse Regierung von George W. Bush abgestraft. Trotzdem war aber die Gelegenheit da, bespielsweise mit einer Reform des Arbeitsrechts, die Kräfteverhältnisse zugunsten der Gewerkschaften, ohne die die Demokraten kaum eine Wahl gewinnen könnten, zu verschieben und damit auch die extrem wachsende soziale Ungleichheit zu bändigen. Doch es reichte schon der Widerstand einer einzigen demokratischen Senatorin aus Arkansas, dem Hauptsitz des gewerkschaftsfeindlichen Konzerns WalMart, um das Vorhaben zu verhindern.Aber was ist mit der Gesundheitsreform, war das nicht eine historische Leistung? Tatsächlich ist die Reform das beste (wenn auch paradoxe) Beispiel für die Hegemonie der Republikaner: Die Verpflichtung für jeden, eine Krankenversicherung abzuschließen, war ursprünglich, wie fast das gesamte Reformkonzept, eine Idee der konservativen Heritage Foundation. Ziel war, die von den Demokraten geforderte Verpflichtung für alle Arbeitgeber, ihren Beschäftigten eine Krankenversicherung anzubieten, politisch abzuwehren. In den achtziger Jahren opponierten die Demokraten gegen die Pläne der Republikaner. Noch im Vorwahlkampf 2008 lehnte Obama das Konzept ab, änderte seine Haltung aber, nachdem man ihm vorrechnete, dass es anders nicht ginge. Nun, da die Gesundheitsreform beschlossen worden ist, bringt sie den privaten Versicherungsunternehmen – Klientel der Republikaner – Millionen neuer Kunden. Die Ausdehnung von Medicare oder eine andere Form einer gesetzlichen Gesundheitsvorsorge wurde dagegen noch nicht einmal diskutiert. Die Republikaner haben in wesentlichen Fragen der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik die politischen und intellektuellen Auseinandersetzungen gewonnen. Amerikanische Politik findet inzwischen auf ihrem diskursiven Terrain statt.In manchen Politikbereichen müssen die Republikaner nur warten: Selbst wenn sie die Privatisierungen von Social Security und Medicare kurzfristig nicht durchsetzen können: Solange die Finanzierungsgrundlagen nicht an veränderte Einkommensbedingungen und demografische Verhältnisse angepasst werden, laufen die altehrwürdigen Programme unaufhaltsam auf ihre eigene Finanzierungskrise zu – und damit auf ihr Scheitern.Trotz dieser republikanischen Hegemonie in zentralen Politikbereichen gibt es wichtige Unterschiede zwischen den Parteien und den Kandidaten, die für viele Bürger der USA (gerade für diejenigen, die tendenziell gegen ihre ökonomischen Interessen abstimmen werden) wichtig sind, und die auch weltpolitisch relevant sind. Was will, was kann Obama mit einer zweiten Amtszeit anfangen?Da die Republikaner ihre Mehrheit im US-Repräsentantenhaus fast sicher verteidigen und auch die Tea-Party-Anhänger gestärkt sein werden, wird sich die Blockade in Washington fortsetzen. Die größere Kompromisslosigkeit und klarere Richtung, die Obama im Wahlkampf zeigt, würde also möglicherweise zu wenig führen, selbst wenn er diesen Kurs nach der Wahl fortsetzte. In einem System, welches institutionell darauf ausgerichtet ist, das Regieren zu erschweren, dazu noch im Kontext einer von Staatsskepsis geprägten politischen Kultur, kann die Kompromissunfähigkeit der gewählten Repräsentanten das Land schnell in eine Situation der Unregierbarkeit bringen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in der Haushaltsdebatte 2013 wieder Präsident, Demokraten und kompromissbereite Republikaner – und mit ihnen das Land und seine Kreditwürdigkeit – von den von der Tea Party unterstützten Volksvertretern sowie von den radikalen Feinden jeglicher Steuererhöhung in ideologische Geiselhaft genommen werden.Kleinteilige ReformenInstitutionelle Reformen helfen hier nicht. Es bedarf vielmehr einer grundsätzlichen Debatte über die gemeinsamen kulturellen Grundlagen und Werte der amerikanischen Demokratie. Ihr großes tragisches Thema, der Rassismus, darf dabei nicht ausgespart werden. Barack Obama hat die Chance bisher verpasst, diese Debatte zu führen. Vielleicht wird er, von der Last einer erneuten Wiederwahl befreit, diese Tür aufstoßen. Aber es bleibt abzuwarten, ob ihm überhaupt jemand zuhören würde.Das Urteil des Supreme Court zur Gesundheitsreform hat den Präsidenten gestärkt, sein wichtigstes Projekt der ersten Amtszeit hat überlebt. Allerdings steckt der Teufel im Detail der Urteilsbegründung. Und es gibt durchaus weitere Blockademöglichkeiten in den einzelnen Bundesstaaten. Immerhin setzen auch einige Gouverneure der Republikaner die Reform pragmatisch um, wenn auch wohl nur, um nicht am Ende vom Bund vorgeschrieben zu bekommen, was sie zu tun haben. Die großen Sozialprogramme (und insgesamt der Bundeshaushalt) brauchen aber Einnahmereformen. Diese sind derzeit aber nicht durchsetzbar. Obama blieben – wie Clinton in seiner zweiten Amtszeit – nur kleinteilige Reformen.Obwohl Obama sich eine gewisse Freiheit von der Wall Street erarbeitet hat, hat er ihren Vertretern die Krisenlösung weitgehend überlassen. Dies wird sich nur unter gesellschaftlichem Druck ändern. Es muss aber bezweifelt werden, ob die Occupy-Bewegung dazu in der Lage ist. Sie wirkt zu richtungslos und hält sich Wahlkampf 2012 sehr stark zurück. Obama hat mit der Rettung der Autoindustrie gepunktet, und da das verarbeitende Gewerbe derzeit ein kleines Comeback erlebt (auch wegen steigender Transportkosten und Löhne in China), kann er hier möglicherweise gestaltend eingreifen. Grundsätzliche Fragen wie die skandalöse Ungleichheit und die gestiegene Armut werden weiterhin schwer zu fassen sein, weil sie genau an der Schnittstelle der polarisierten Parteipolitik liegen. Dazu gehören die kodierten Vorbehalte von Teilen der weißen Bevölkerung gegenüber den „anderen“ – und damit denjenigen, welche die Hilfe der Gesellschaft nicht verdient haben.Obama wird kaum mehr tun können, als (endlich) eine breite gesellschaftliche Debatte zu eröffnen. Wirklicher Wandel kann nur durch Druck von unten erzwungen werden, aber die Gewerkschaften und andere Organisationen sind derzeit zu schwach, diesen zu erzeugen.
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.