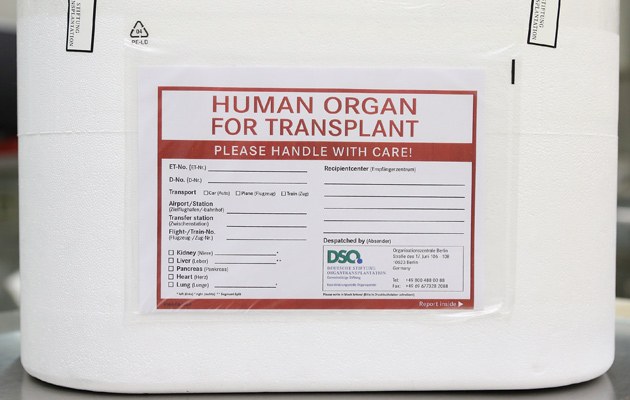Zuerst der Krankenwagen. Dann die Intensivstation. Und schließlich der Schock für die Angehörigen, denen ein Arzt erklären muss: Tut mir leid, wir können nichts mehr tun. Höchstens für andere. Existiert ein Organspendeausweis? Wären Sie einverstanden, wenn wir Organe entnehmen? Überforderung auf beiden Seiten. Für den Arzt, derartige Fragen zu stellen, für die Angehörigen die Zumutung, eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen.
So oder ähnlich muss man sich im Klinikalltag die Entscheidung für oder wider eine Organspende vorstellen. Um den Druck aus der Situation zu nehmen und das Organaufkommen zu erhöhen, wurden bereits verschiedene Wege diskutiert: Die Widerspruchsregelung, die in Österreich oder Fran
oder Frankreich gilt und alle Patienten, die nicht ausdrücklich widersprechen, zu potentiellen Organspendern erklärt, fand im Deutschen Bundestag keine Mehrheit.Die Alternative: Spenden bei Herztod?Dafür werden die Bürger neuerdings von den Krankenkassen per Brief aufgefordert, sich pro oder contra Organspende zu entscheiden. Doch selbst wenn alle hirntoten Patienten ihre Organe spenden würden, könnte das den Bedarf nicht decken. Deshalb wird darüber nachgedacht, den Kreis der potentiellen Organspender zu vergrößern. Eine Möglichkeit wäre die Rückkehr zur Organspende nach klassischem Herz-Kreislaufversagen. Bislang kommen lediglich hirntote Patienten als Spender in Betracht – meist Unfallopfer oder Komapatienten.In anderen Ländern Europas wird bereits mit Non-Heart-Beating-Donors experimentiert, nachdem die Organvermittlungszentrale Eurotransplant 1988 mitteilte, dass der Herzstillstand nach zehn Minuten dem Hirntod als sicheres Todeszeichen gleichzusetzen sei. Nach Angaben des Schweizer Bundesamts für Gesundheit stammen in Großbritannien, wo die Organentnahme nach endgültigem Kreislaufversagen praktiziert wird, gut zehn Prozent aller Organspenden von Non-Heart-Beating-Donors. In den Niederlanden sind es um die fünfzig Prozent.Tod nach zwei MinutenIm März 1995 organisierte der niederländische Transplantationschirurg Gauke Kootstra in Maastricht eine Konferenz, die Organentnahme bei Herztod hoffähig machen sollte. Streit gab es unter den Fachmedizinern vor allem über die Wartezeit. Wie lange es dauert, bis ein Mensch, dessen Herz aufgehört hat zu schlagen, tatsächlich tot ist, lässt sich nämlich, wie man aus der Reanimationsmedizin weiß, nicht genau sagen: nur zwei Minuten, wie die Pittsburgher Leber- und Nierentransplanteure bei ihren Experimenten annahmen? Oder soll man doch lieber zehn Minuten warten, wie die Maastrichter Versammlung schließlich gegen den Widerstand der Bauchchirurgen durchsetzten?Ungeachtet dieser Diskussion ist der nur Dritten nützende Zugriff auf die Organe von Menschen, die noch leben, höchst umstritten. Organerhaltende Maßnahmen vor dem Tod werden als „massive Grenzverschiebung“ gewertet, die die Würde des sterbenden Menschen mit Füßen tritt. „Der öffentlichen Erwartung auf verwertbare Organe soll der Vorrang eingeräumt werden vor anders lautenden privaten Zielen“, kritisiert der in München lehrende Bioethiker Arne Manzeschke diese Praxis.Inzwischen sind viele Mediziner und Bioethiker der Meinung, dass sich auch der Hirntod als entscheidendes Todeskriterium nicht halten lässt, weil es nicht berücksichtigt, dass der Organismus des Menschen mehr ist als sein Gehirn. Sollte sich diese Meinung durchsetzen, käme die Transplantationschirurgie in die Bredouille. Wenn der Hirntod nämlich kein „adäquates Kriterium für den Tod ist“, wie der Philosoph Dieter Birnbacher meint, der Herztod als Kriterium für eine Organentnahme wiederum mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden ist (bis hin zur Angst von Patienten, sie würden im Fall der Fälle als potenzielle Organspender nicht angemessen reanimiert), dann steht das gesamte System der Organtransplantation zur Disposition.Abenteuerliche KonstruktionUm es zu retten, müssen ihre Verfechter, wie etwa der Rechtsphilosoph Paolo Becchi in einem Debattenbeitrag in der Neuen Zürcher Zeitung, zu abenteuerlichen Konstruktionen greifen: Er konstatiert mit dankenswerter Offenheit, dass der Patient durch die Organentnahme unter künstlicher Beatmung in gewisser Weise zwar „verdinglicht“ werde, rechtfertigt dies aber mit dem guten Zweck: Die „entfremdende Situation“ würde durch die Organspende in „eine Geste höchsten Edelmuts“ verwandelt werden. Die Organspende vor dem Tod ließe sich deshalb zu einer „Art solidarischer Sterbehilfe“ erklären.Aber selbst in einem Land, in dem mit Sterbehilfe so großzügig verfahren wird wie in der Schweiz, braucht es dann doch eine Entlastung, um Ärzte nicht dem Verdacht auszusetzen, Hand an den Patienten zu legen: Deshalb, so Becchi, sei der Gesetzgeber aufgefordert, das „höchst bedenkliche Machtvakuum zu füllen“, das eine nicht fundierte Todesdefinition hinterlässt.Vorstoß von ÄrzteseiteIn Deutschland hat die Bundesärztekammer 2007 unmissverständlich festgeschrieben, dass der Herzstillstand als uns geläufiges „intuitives“ Todeszeichen wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält. Nur mit einer „eindeutigen“ Todesfeststellung“, so Ethikrat-Mitglied Eckhard Nagel, sei das System zu legitimieren. Er reagierte damit auf einen im Mai 2011 an das Gesundheitsministerium gerichteten Vorstoß der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), die Organspende auf das Kriterium Herztod zu erweitern, um dem „eklatanten Organmangel“ zu begegnen.Einer der fünf Unterzeichner ist der Münchner Oberarzt Helmut Arbogast. Er ist derzeit als Nachfolger von Günter Kirste als Vorsitzender der Deutschen Stiftung Organtransplantation im Gespräch. Bei der Neuverhandlung des Transplantationsgesetzes hatte Helmut Arbogast auch für die Widerspruchslösung optiert, um so, wie er gegenüber der Berliner taz zu Protokoll gab, möglichst viele Menschen als Organspender in die Intensivstationen zu bekommen. Und er bedauert es, dass dies „in Deutschland nicht durchsetzbar ist.“