Sie spielen sich treffsicher die Bälle zu. Kumpeln im „schönsten Land der Welt“ (Söder). Und sonnen sich im oberen Zehntel der politischen Beliebtheitsskala. Die Rufe nach dem Duo Söder/Spahn aus den eigenen Reihen werden lauter. Die Berliner CDU hat schon ihren Segen gegeben, auch wenn der Macher aus Bayern im alten Preußen wohl kaum mehrheitsfähig wäre und der andere ja noch mit Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der momentan lieber seinen Sozialminister an die Front schickt, liiert ist. Doch Markus Söder, dem ultimativen Corona-Macher, will Jens Spahn nicht hinterherhecheln. Deshalb ordnet er, unterstützt von Virologen, den verpflichtenden Corona-Test für all jene an, die sich den Einflüsterungen über das Reisen
Riskante Willkür
Zweite Welle Flugreisende müssen zum Test, Bahnreisende nicht. Schulen öffnen wieder, Universitäten nicht. Der Umgang mit dem Corona-Risiko ist paradox
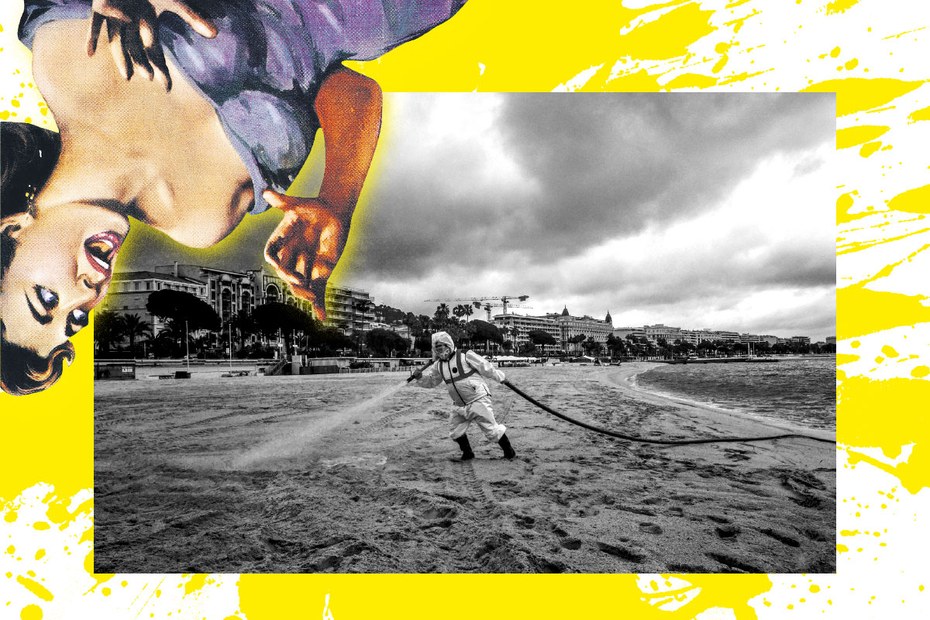
Strandreinigung bei Cannes
Foto: Valery Hache/Getty Images
sen im neu zu entdeckenden Deutschland entzogen haben und ins Risiko geflüchtet sind.Nun endet bald die Urlaubszeit, und manch ein Rückkehrer aus einem sogenannten Risikogebiet hat möglicherweise ein unliebsames Reiseandenken im Gepäck. Es könnte, an die Allgemeinheit verteilt, der sich schon länger ankündigenden „zweiten Welle“ einen heftigen Schub versetzen. Die Schlagzeilen und Berichte von der mallorquinischen Sauf- und Fressmeile oder von der bulgarischen Goldküste, wo maskenmüde Jungmänner die Sau rauslassen, haben das Publikum eingestimmt auf den nächsten Schnitt in die Freiheitsrechte. Die allmählich wieder steigenden Infektionszahlen scheinen dem Gesundheitsminister recht zu geben, und die WHO warnt, dass das, was im Sommer nicht verhindert wird, im Herbst und Winter dramatisch zurückschlagen kann. Die Angst vor einem neuerlichen harten Lockdown beflügelt fraktionsübergreifend die präventive Energie.Grundlage für die auf dem Verordnungsweg erlassenen Maßnahmen ist das im Mai im parlamentarischen Schweinsgalopp verabschiedete Infektionsschutzgesetz (IfSG), dem das „zupackende“ bayrische vorausgegangen war. Letzteres legitimiert die Zwangsverpflichtung von medizinischem Personal und die Beschlagnahme von Ausrüstung und war schon damals vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags als nicht rechtmäßig beurteilt worden. Mit seiner ebenfalls weit ausgreifenden Vorlage für ein Bundesgesetz scheiterte Spahn dann an den Abgeordneten, doch es räumt immer noch weitgehende Eingriffsrechte ein. So können bei einer „epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite“ etwa auch Zwangstests angeordnet und damit das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt werden. Maßgeblich sind die Eingriffstiefe und die Verhältnismäßigkeit.Ein löchriges VirusrasterDemnach müssen die Gefahren, die von Reiserückkehrern ausgehen, mittels Test reduziert werden können und milder sein gegenüber anderen Maßnahmen. In diesem Fall ist das die Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne, die, wie Kanzleramtsminister Helge Braun betonte, ohnehin fortbestehe. Auf Grundlage dieser Bundesverordnung erlassen die Landesregierungen eigene Rechtsverordnungen mit Befugnissen für die Polizei. Die Entscheidung über die Risikominimierung ist also eine grundsätzlich anfechtbare Abwägungs- und nie eine Glaubensfrage, auch wenn sie manchmal so auftritt. Müssen wir uns nun darauf einstellen, dass Reisende am Flughafen von der Polizei gegen ihren Willen zum Test geschleppt werden? Nach der neuen Regelung kontrollieren die Gesundheitsbehörden zwar, ob sich Rückkehrer aus Risikogebieten haben testen lassen, und belegen ein Versäumnis mit Geldbuße – auf Zwangstests aber soll verzichtet werden.Im Unterschied zu einem auffällig gewordenen Autofahrer, der zu einem behördlich verordneten Alkoholtest verdonnert wird, genügt bei den Urlaubsrückkehrern der reine Verdacht, um die medizinische Überwachung zu rechtfertigen. Grundsätzlich kann man sich ja überall anstecken, auch in den als risikoarm erachteten Ländern der EU. Und die Empirie bestätigt, dass die derzeit neu infiziert nach Deutschland einreisenden Personen tatsächlich seltener aus den 130 als Risikoländer ausgewiesenen Gebieten kommen als aus dem europäischen Ausland, weil dort einfach viel mehr Menschen Urlaub machen. Der erste Corona-Hotspot lag bekanntlich in einem österreichischen Skiort.Konsequenterweise müssten also nicht nur auf Flughäfen, sondern auch an den deutschen Außengrenzen und an Bahnhöfen Teststationen eingerichtet werden, wie es etwa Bayern umsetzt. Das ist allerdings mit einem mehr oder minder reibungslosen Reiseverkehr nicht zu vereinbaren. Wenig plausibel ist auch, warum eine bestimmte Gruppe von Reisenden unter die Testpflicht fällt, für medizinisches Personal wie Hebammen oder Physiotherapeuten aber immer noch keine Corona-Tests zur Verfügung stehen. Das aufgebaute Virusraster ist also extrem löchrig. Und vieles spricht dafür, dass mit dem reisegruppenspezifischen Testfall die Politik sich und die Bevölkerung beruhigen will.Trotz gegenteiliger Vermutungen zeigt sich Letztere mit den AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – immer noch sehr einverstanden, wie eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beweist. Dabei halten sich allerdings Jüngere seltener an die Maskenpflicht als Ältere (81,4 Prozent der 18- bis 19-Jährigen gegenüber 96,4 Prozent der über 65-Jährigen) und Frauen eher als Männer. Dennoch gewöhnen wir uns daran, mit dem Corona-Risiko zu leben, und schlagen gerade auch im Urlaub mal über die Stränge. Der ausgebliebene Corona-GAU in Deutschland lässt manchen an den Maßnahmen zweifeln, weil ihr Nutzen nicht so offensichtlich ist und das Verhinderte nicht unmittelbar spürbar wird. Dieses in den 1980er Jahren von Geoffrey Rose als „Präventionsparadox“ bezeichnete Phänomen dürfte auch bei den neuerlichen Verordnungen wirksam werden. Warum soll ich mich zugunsten der Allgemeinheit den misslichen Umständen aussetzen, nach einem anstrengenden Langstreckenflug eine Teststation in einem Airport-Winkel zu suchen und mir in Mund und Nase herumbohren zu lassen? Die Bereitschaft, sich freiwillig testen zu lassen, die Verbraucherschützer lieber sähen, wird von der Politik offenbar als gering eingeschätzt.Placeholder image-1Was wir derzeit erleben, ist ein Paradigmenwechsel in der Prävention. Hatte der neoliberale Kapitalismus der vergangenen Jahrzehnte die Pflicht zur Selbstentfaltung großgeschrieben, mitsamt der egozentrisch-präventiven Sorge um sich selbst, wird den Menschen nun die Pflicht auferlegt, auf andere zu achten. „Die spätmoderne Gesellschaft“, erklärte der Soziologe Andreas Reckwitz zu Beginn der Pandemie in einem Interview in der taz, „ist auf die Anforderungen eines kollektiven Risikomanagements nicht gut vorbereitet.“ Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen, sei ungewohnt und falle vielen schwer. Allerdings, räumt er ein, seien urbane jüngere Menschen auch so flexibel, dass sie sich schnell auf ungewohnte Situationen einstellen könnten.Wer bezahlt die Tests?Ein Indiz für diesen Paradigmenwechsel ist, dass die staatlichen Maßnahmen inzwischen selbst von antiregulatorischen Geistern wie dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner unterstützt werden, der ebenfalls eine Testpflicht für heimkehrende Urlauber forderte und damit die Phalanx auf der Politikbühne schloss. Es gab vor der Entscheidung kaum mehr politische Debatte über das Ob als über das Wie, insbesondere im Hinblick auf die Kostenübernahme für den Test. „Wer sich in ein Risiko freiwillig begibt als Tourist“, sagte Lindner stellvertretend, „der wird in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt.“ Das erinnert an eine Debatte vor 20 Jahren, als Lindners Vorgänger im Vorsitz, Wolfgang Gerhardt – übrigens im Schulterschluss mit SPD-Politikerinnen wie Heide Simonis, damals noch Chefin in Schleswig-Holstein –, forderte, Risikosportarten aus dem Versicherungsschutz der gesetzlichen Krankenversicherung auszuschließen und privat zu versichern.Nach groben Schätzungen werden für die angeordneten Tests 50,5 Millionen Euro fällig. Sie werden den Anbietern der derzeit brachliegenden rund 500.000 täglich grundsätzlich durchführbaren Tests zugutekommen. Könnte schon sein, dass Lindner mit seinem Statement weniger den Gesundheits- als den Unternehmerschutz – auch den der Luftfahrt – im Sinn hatte. Einzelne Unternehmen wie Centogene, berichtet der Tagesspiegel, sind schon unterwegs, um mobile Testzentren aufzubauen. Luftfahrt-Präsident Peter Gerber sieht in der Testpflicht die Chance, den Flugverkehr wiederzubeleben. Die Kosten werden nun Bund und Länder übernehmen, durch einen Zuschuss an die Krankenkassen. Ursprünglich sollte ein weiteres Mal der schrumpfende Gesundheitsfonds angezapft werden.Die Diskussion über die Risikofreude von Urlaubern wird damit kaum beendet sein. Es sind ja nicht nur politische Selbstberuhigungen, die sie ins Raster geschoben haben. Als Gruppe stehen sie im Fokus, weil sie sich lustvoll einem Risiko aussetzen, das sich die Mehrheitsgesellschaft verkneift. In einem schönen Essay bei Zeit Online hat das die Literaturwissenschaftlerin Bernadette Grubner ausgeführt. Die im zivilisatorischen Prozess antrainierte Affektkontrolle, die in Zeiten von Corona mit vielfältigem Verzicht einhergeht, bricht sich Bahn in der ferienseligen, lustvollen Normüberschreitung. Man spottet der Direktiven des Gesundheitserhalts, wenn man in normalen Zeiten raucht und in der Pandemie-Ära keine Maske trägt, Partys feiert oder sich am Ballermann traut, was zu Hause sanktioniert wird.Und sie zitiert den Schriftsteller Ronald M. Schernikau, der im November 1984 , mitten in der Aids-Hysterie, in dem queeren Berliner Stadtmagazin Siegessäule schrieb: „Fickt weiter!“, um zum Ausdruck zu bringen, „dass man die Ansteckung nicht zum Regulativ unserer intimen Beziehungen machen sollte“, so Bernadette Grubner. Die mit Sex assoziierte Angst sei aber viel plastischer als die mit dem Virus verbundene.Wie wird der Spagat zwischen internalisierter Selbstdisziplinierung und antiautoritärer Selbstentgrenzung enden? Wir wissen nicht, prophezeite der Philosoph Stefan Gosepath im Mai, „ob es nicht noch eine zweite Welle gibt, und dann werden die Maßnahmen noch einmal schärfer greifen müssen, und es wird auch viel Widerstand geben“. Jetzt sind wir womöglich in der zweiten Welle angekommen. Dass sich der „Widerstand“ hauptsächlich in ideologisch-verschwörerisch aufgeladenen Demonstrationen Bahn bricht, ist kein gutes Zeichen.Wir gehen im anstehenden Herbst in den präsenten Regelbetrieb an den Schulen und in ein weiteres Digitalsemester an den Universitäten, obwohl dort das vernünftigere Bildungscluster vermutet werden dürfte. Der Umgang mit dem Risiko ist willkürlich, weil das Risiko höchstens in Annäherungen umkreist werden kann. Die ausgebeuteten osteuropäischen Fleischarbeiter bei Tönnies, die als Risikogruppe ausgegrenzt und lange Zeit ohne rechtliche Grundlage in Quarantäne gehalten wurden, haben das schmerzlich erfahren.
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.