Es graust Ihnen bei einem Satz wie – sagen wir – „Jungen Französ*innen der 1960er-Jahre lag das Ideal des*r engagierten Philosoph*in noch nahe“? Ich kann das mittlerweile nachfühlen. Wie übrigens auch jener sozialwissenschaftliche Fachverlag, bei dem ich einmal einen langen Text veröffentlichte. (An alle anderen: Ärgern Sie sich jetzt noch nicht!)
Auf die Frage, wie Geschlecht zu schreiben sei, beschied beim Verlag die Betreuerin: bevorzugt ganz traditionell, wobei eine Vorbemerkung klarstellen solle, dass alle gemeint seien. Reiche mir das nicht, solle ich – die Episode spielt vor der jüngsten Duden-Inklusionsoffensive – zur „Schrägstrich-Bindestrich-Form“ greifen. Aber „bitte grammatikalisch korrekt“!
In diesem speziellen Text verbot sich das „Mitmeinen“ schon thematisch. Und auch generell geht das nicht mehr. Es lässt sich sicher stimmig zeigen, dass im grammatikalischen Sinn das generische Maskulinum nicht tatsächliche Geschlechtlichkeit beschreibt. Doch ist die Forderung nach einer inklusiven Schreibweise eine Tatsache. Wer sie schlicht ignoriert, steht symbolisch auf einer falschen Seite, denn Unterlassungen sind Handlungen. (Publikum eins: Erwägen Sie, weiterzulesen. Es kommt noch was.)
Beim Editieren warf ich also Suchen/Ersetzen an. Ich hatte mich nämlich auf das Binnen-I eingeschossen. Das entsprach meinen 1990er-Lesegewohnheiten. Und mir ist bis heute nicht klar, inwiefern Unterstrich, Sternchen oder Doppelpunkt inklusiver sein sollen als der deplatzierte Großbuchstabe: All diese Formen transportieren das Männliche wie Weibliche – und weisen durch den irritierenden „Regelbruch“ auf weitere Möglichkeiten hin.
Ob die Verlagsfrau mit Absicht handelte? Jedenfalls wirkte ihre Anforderung nachhaltig. Denn „FranzösInnen“ waren mir bis dato nicht aufgestoßen. Aber „Französ/-innen“? Indem diese Schreibweise die Worte zerlegt, weckte sie den Grammatik-Fuchs: Das Maskulinum heißt nicht „Französen“. Vielleicht sollten sich Männer nicht so anstellen, wenn zur Abwechslung sie gelegentlich verschwinden. Doch werde ich seither den Reflex nicht los: „Teilnehmer/-innen“ etwa gibt es im Nominativ, Genitiv und Akkusativ Plural. Im Dativ aber stutzt man vor „Teilnehmern/-innen“. Und „Philosoph*innen“ lassen sich so nur im Nominativ Singular korrekt ansprechen.
Wurden die Regeln inzwischen geändert? Sind „Philosoph*innen“ grammatikalisch jetzt „Philosoph/-inn/-en“? Ich weiß es nicht einmal. Doch um zu behaupten, dass „im jungen Frankreich der 1960er-Jahre Idealvorstellungen einer engagierten Philosophie verbreitet“ gewesen seien, ist das auch unerheblich.
Die intellektuelle Energie, die viele Männer und einige Frauen auf die Abwehr von Sternchen verwenden, lässt sich im Rahmen einer kreativen Vermeidungsstrategie auch dazu nutzen, zumindest in der Schriftsprache das eigene Ausdrucksvermögen zu trainieren. Das geht immer, auch ohne „Teilnehmende“ und „Philosophierende“. Was mit der Irritation um jenen Text begann, ist seit gut zwei Jahren mein Verfahren. Korrigieren Sie eventuelle Fehltritte! Und probieren Sie es einmal aus. Der Abschied vom Substantiv-Stil, der damit verbunden ist, tut Texten oft gut. Nach schwerem Anfang kommt Routine – und irgendwann sogar der Spaß. Und die Bemühung zeigt Respekt für jene sprachpolitischen Wünsche.
Oder doch nicht? Jüngst bekam ich zu hören, meine vermeintliche Lösung sei mindestens „postpatriarchal“. Wie es ja heute nicht mehr genug sei, sich etwa vom Rassismus bloß passiv fernzuhalten, so reiche auch meine Vermeidung des generischen Maskulinums nicht aus. Um Teil der Lösung zu werden, müsse ich die Inklusionszeichen „proaktiv“ benutzen, also möglichst oft. Auch erweise sich meine Methode der Problemvermeidung als praktisch höchst lückenhaft: So sei doch zum Beispiel die Bezeichnung „Kommiliton*in“ unvermeidbar, wenn ein aus Uni-Zeiten bekanntes Gegenüber aufgrund fluider Geschlechtlichkeit die Gretchenfrage nach den Pronomen nicht abschließend beantworten wolle oder könne?
Ersteres muss ich einstweilen stehen lassen. Das Zweite aber lässt sich kontern: „Hörsaalbekanntschaft“. Das hatte diese Person nun davon.
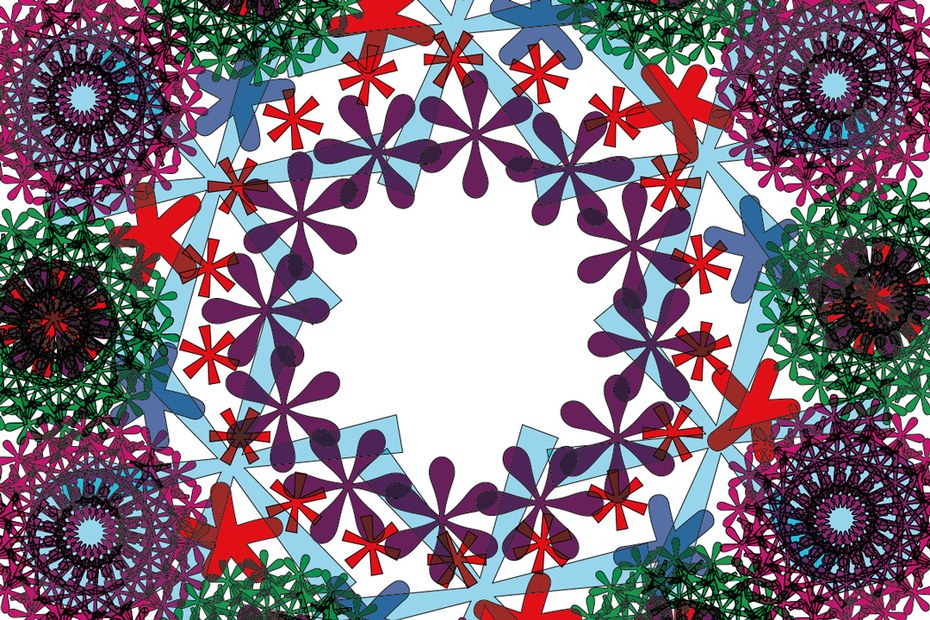






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.