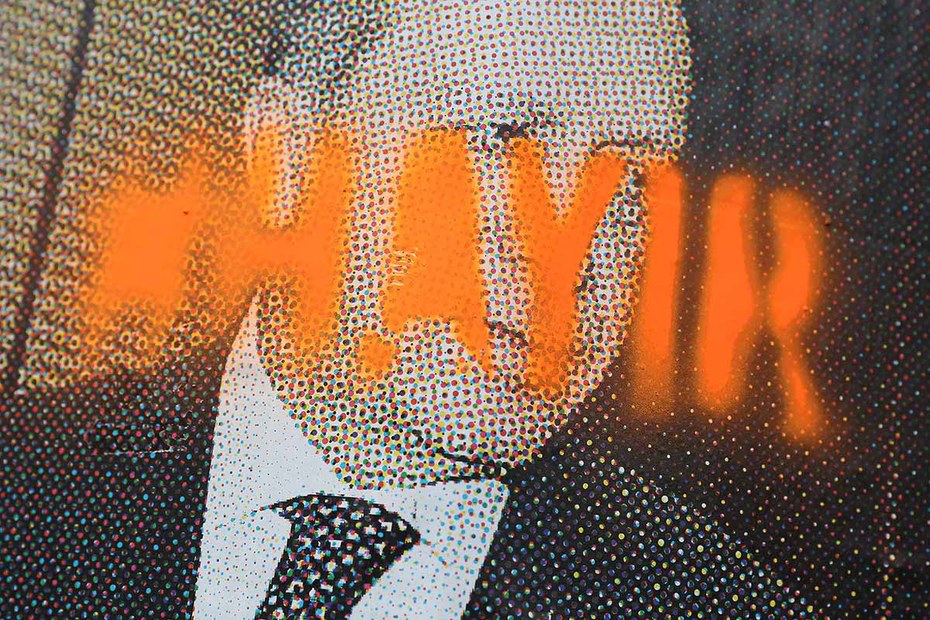Seit dem 27. März können 1,2 Millionen wahlberechtigte Deutsch-türken in den Generalkonsulaten der Türkei über die von Präsident Erdoğan erstrebte Verfassungsänderung abstimmen. Obwohl sie nur zwei Prozent aller Wahlberechtigten ausmachen – in der Türkei sind am 16. April gut 55 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen –, könnten sie dennoch einen entscheidenden Part übernehmen. Eben deshalb haben türkische Kabinettsmitglieder und die der Regierungspartei AKP nahestehende Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) mit ihren Meetings auch in Deutschland um Ja-Stimmen geworben. Die Opposition aus der sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei (CHP) oder der prokurdischen HDP hielt mit Info-St&
Ständen dagegen, um über mögliche Folgen dieses Referendums aufzuklären und für ein Nein zu plädieren.In der Türkei selbst lässt sich schwerlich von einer fairen Debatte reden. Erdoğan Gegner fanden in den Mainstream-Medien wie in öffentlichen Fernsehkanälen kein Gehör. Ohnehin herrschte wegen des Ausnahmezustandes eine Atmosphäre der Angst und Selbstzensur, die Meinungsvielfalt wie sachliche Diskussionen im Keime erstickt hat. Ein transparenter Diskurs über die Verfassungskorrekturen war schon vor der Abstimmung im Parlament am 21. Januar unterblieben, als 339 Abgeordnete, neun mehr als für die Dreifünftelmehrheit benötigt, in zweiter Lesung der neuen Magna Charta zustimmten. Ein Quorum, das nicht nur der AKP, sondern ebenso der ultranationalistischen Oppositionspartei MHP zu verdanken war. Bei jenem Votum, begleitet von Handgreiflichkeiten im Plenarsaal, hatte eine verzweifelte Opposition vergeblich vor einem endgültigen Weg in eine Diktatur und dem Ausverkauf von Volkssouveränität und Gewaltenteilung gewarnt. Die Regierung von Premier Yıldırım und Staatschef Erdoğan versprach hingegen mehr Führungseffizienz, die dem Land Stabilität und Wirtschaftsdynamik beschere. Dem sollen die Änderungen bei 18 Artikeln der bisherigen Verfassung dienen.Ohne Checks and BalancesVorgesehen ist etwa ein von 21 auf 18 Jahre herabgesetztes passives Wahlrecht. Die Zahl der Parlamentssitze steigt von 550 auf 600, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen künftig stets am gleichen Tag und alle fünf Jahre stattfinden. Im Zentrum der Verfassungsrevision steht freilich die Einführung eines Präsidialsystems, das ohne Kabinett und ohne Ministerpräsidenten auskommt, den ein Vizepräsident ersetzt. Die Konsequenz: Fortan dominiert allein der Staatspräsident die Exekutive. Er wird vom Volk direkt gewählt und ernennt ohne Teilhabe des Parlaments seine Minister, die er jederzeit wieder des Amtes entheben kann. Dieser Staatschef darf zugleich hohe Regierungsbeamte berufen, vom Dienst suspendieren oder befördern – ebenfalls ohne Beteiligung der Legislative.Parlamentsfraktionen wird es außerdem versagt sein, ein Misstrauensvotum gegen die Regierung einzubringen, was weiteren Kompetenzverlust festschreibt. Gegen den Präsidenten, Vizepräsidenten und die Minister sind lediglich bei Amtsvergehen parlamentarische Untersuchungen und Strafverfahren – jedoch nur durch Beschluss einer Zweidrittelmehrheit – möglich.Werden Parlaments- und Präsidentschaftswahl gleichzeitig abgehalten, heißt das auch: Es sind keine Zwischenwahlen vorgesehen, die eine ausgleichende Wirkung wie in den USA entfalten können. Dieser Synchronisation liegt offenbar das Motiv zugrunde, die Wähler mehrheitlich auf die Partei des Staatspräsidenten zu lenken, dem es zugleich erlaubt ist, für diese Partei den Vorsitz innezuhaben. Da wirkt es fast selbstverständlich, wenn ein mit solchen Vollmachten versehener Machthaber darüber entscheiden darf, wie sich Parlamentsausschüsse zusammensetzen und welchen Gesetzesvorlagen sie sich widmen – statt Gewaltenteilung also Gewaltenverschränkung.Als vorteilhaft ließe sich bewerten, dass dieser omnipotente Präsident fortan juristische Verantwortung für sein Amtshandeln übernehmen wird und bei Amtsvergehen belangt werden kann. Bloß was bedeutet das, wenn der präsidiale Einfluss auf die Besetzung des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte wie des Verfassungsgerichts signifikant ausgebaut wird, wodurch sich die Exekutive klar über die Judikative stellt?Keine Frage, mit dieser Konstitution wird das Land einem permanenten Ausnahmezustand ausgeliefert sein. Umso mehr wäre es geboten, die Bevölkerung über die Artikel des Änderungspakets gründlich zu informieren, was natürlich vermieden wird. Stattdessen erinnern Erdoğan und Premier Yıldırım an mutmaßliche Großtaten, die sie bei Infrastrukturprojekten wie Autobahnen, Pisten und Brücken vollbracht haben. Gleichwohl ist die Stimmung gedämpft, was die oppositionelle CHP in der Überzeugung bestärkt, dass ihre Kampagne Wirkung hinterlässt. Laut Umfragen gibt es keine klare Mehrheit für ein zustimmendes Votum. Wenngleich die diplomatischen Spannungen mit den Niederlanden und Deutschland Erdoğan zugutekamen, sorgt die Reserviertheit einiger AKP-Größen wie Ex-Premier Davutoğlu oder Ex-Präsident Gül für vernehmbaren Gegenwind. Der legt sich auch dann nicht, wenn die Regierung insistiert, mit welchem Mandat sie die territoriale Integrität des Landes und dessen innere Stabilität sichern könne, hänge von diesem Verfassungsreferendum ab. Was sie nicht sagt: Um Sicherheit und Wirtschaftsdynamik zu erreichen, braucht die Türkei statt einer übermächtigen Exekutive mehr Demokratie, vor allem Reformen. Vonnöten wäre mehr politische Partizipation für alle Bürger, auch die Kurden. Nur als Rechtsstaat wird dieses Land wieder für ausländische Investoren attraktiv.Unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung stehen turbulente Zeiten bevor. Kommt die Verfassungsänderung nicht durch, wird das die Opposition als ein Misstrauensvotum gegen Staatschef Erdoğan deuten und die Legitimität der Regierung in Frage stellen. Gibt es hingegen ein klares Ja, ist mit heftigeren Repressionen gegenüber Erdoğan-Gegnern zu rechnen, die sich schon jetzt darauf einstellen, indem sie ihrerseits erwägen, die Abstimmung anzufechten.Placeholder link-1