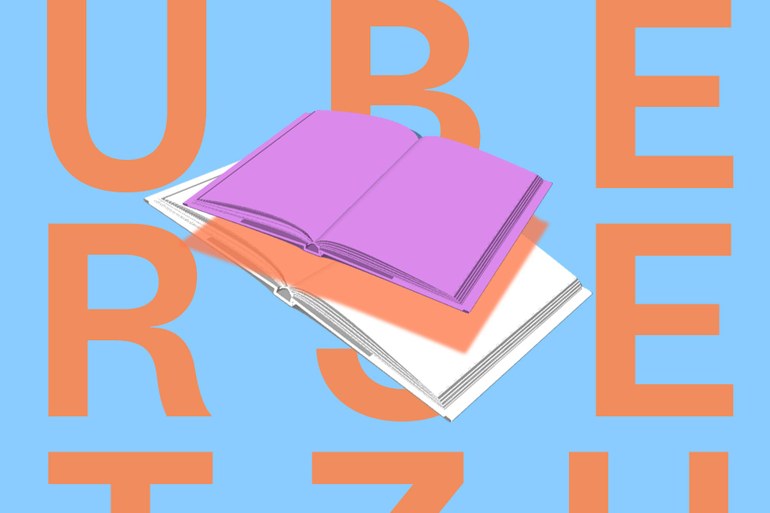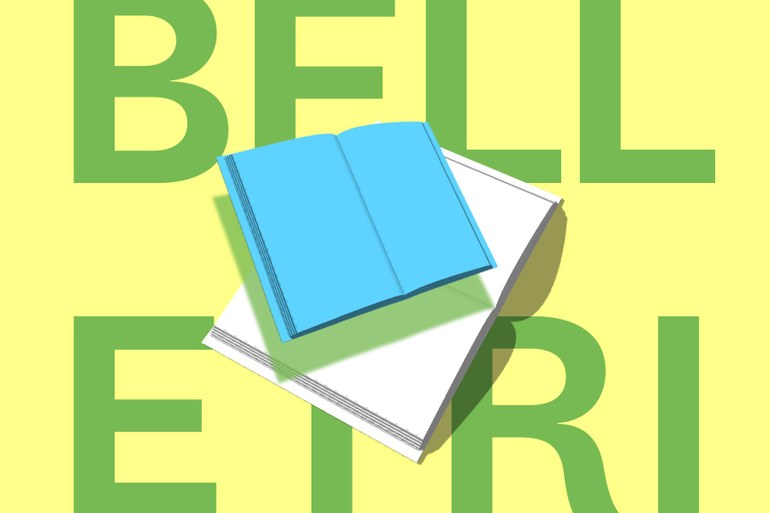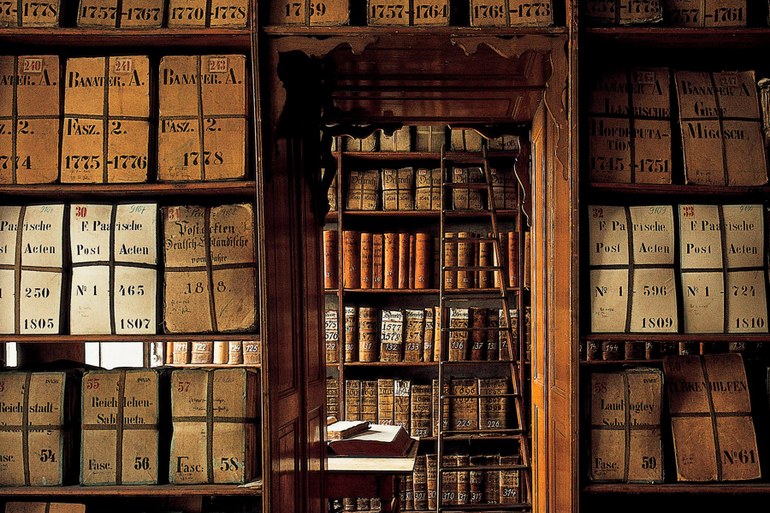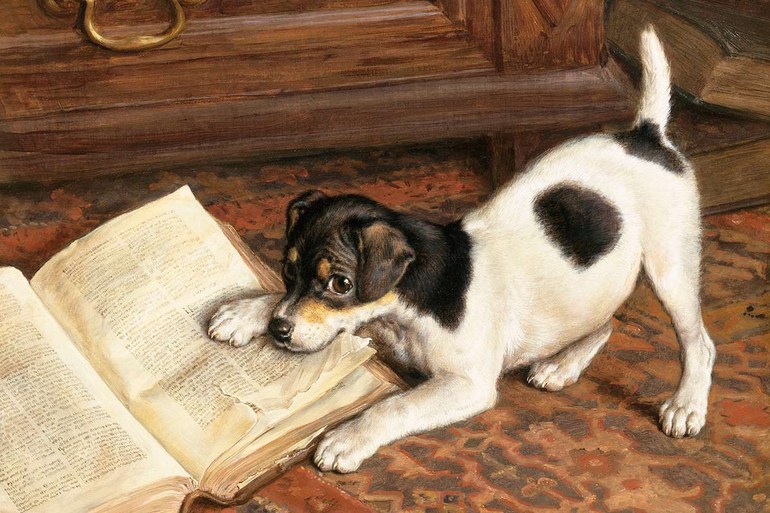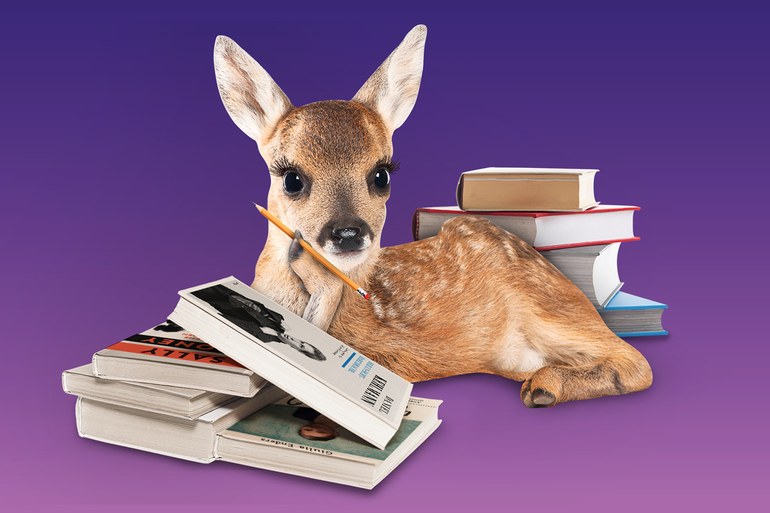Literaturkritik
Leipziger Buchmesse: Die Nominierten im Bereich Übersetzung
Literatur Seit 2005 werden auf der Leipziger Buchmesse große Stimmen der Gegenwartsliteratur ausgezeichnet. Neben Autor:innen aus Belletristik und Sachbuch/Essayistik, auch Übersetzer:innen
Leipziger Buchmesse: Die Nominierten im Bereich Belletristik
Literatur Nobilitiert wird eine vernachlässigte Textsorte – „Genosse Kuckuck“ ist ein Comic. Björn Hayer über die Belletristik-Bestenliste der Leipziger Buchmesse
Debütroman von Valery Tscheplanowa: Träume unter dem Staub der Zeit
Herkunft Valery Tscheplanowa sucht nach ihren russischen Wurzeln und erzählt in „Das Pferd im Brunnen“ von Frauen, die die Ärmel hochkrempeln. Eine starke Erzählung, die Banales leuchten lässt und damit Lust macht auf mehr Bücher von der Autorin
„Die Frauen von Shonagachi“ von Rijula Das: Gewalt und Perversität im Palast des Maharaj
Bordell „Die Frauen von Shonagachi“ von der Schriftstellerin und Übersetzerin Rijula Das spielt in Kalkutta und verspricht, ein Krimi aus der Wirklichkeit zu sein. Ute Evers hat ihn gelesen
Andreas Pflügers „Wie Sterben geht“: Die Glienicker Brücke fliegt gleich in die Luft
Moskau/Pullach Virtuos und actionreich nimmt uns der Autor Andreas Pflüger mit seinem neuen Krimi „Wie Sterben geht“ mit in die alte Welt der Spionage – mit erstaunlichen Parallelen zu heute
„Eingefroren“ von Doug Johnstone: Alle haben Leichen im Keller
Edinburgh Doug Johnstones Krimi „Eingefroren“ ist ein Schmöker, der an den Kultfilm „Trainspotting“ erinnert und an die gute alte berühmte Miss Marple – allerdings mit einer Assistentin der Generation Z. Ein Lesevergnügen
„Chor der Erinnyen“ von Marion Poschmann: Die Tabuisierung des Unheimlichen
Weiblichkeit In „Chor der Erinnyen“ fragt Marion Poschmann nach den unterdrückten, gezähmten Kräften von Frauen
Intimes Porträt einer Frau, die nochmal von vorn beginnt: Doris Knechts neuer Roman
Erzählung Autorin Doris Knecht erzählt in ihrem neuesten Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ mit Humor und Tiefgang von einer Frau am Wendepunkt ihres Lebens
„Sie mussten sich von einem ganzen Kontinent schlechter Literatur absetzen“
Interview Literaturszene Österreich: Klaus Kastberger über die Lage der österreichischen Literatur, die Werkstatt als Ort von Auflösung und die Frage, warum man seine kritische Haltung nicht an der Seminartür abgeben sollte
Literaturstreit
A–Z Zum Ärger vieler ordnete Denis Scheck kürzlich Christa Wolf in seinen „Anti-Kanon“ ein. Aber gehört der Eklat nicht zur Literatur wie Marcel Reich-Ranicki zum „Quartett“?
Denis Schecks miese Pointe
Literaturkritik Denis Scheck präsentiert bei SWR2 in Götterpose seinen Anti-Kanon der Literatur. Bei der Verbannung von Christa Wolfs „Kassandra“ vergaloppiert sich der Kritiker
Lebenslügen
Genre Autofiktion wird selten kritisiert. Warum? Über Alem Grabovac’ „Das achte Kind“
Wir brauchen Literaturkritik!
Radio Der WDR will Buchrezensionen aus seiner Morgensendung streichen. Viele sind empört. Michael Maar macht sich ein paar grundlegende Gedanken
Bücher besprechen
Quiz Literaturkritik hat es im Radio immer schwerer. Gut, in der DDR gab es sie ja auch nicht. Hätten Sie’s gewusst?
Ab in die Tonne, TV-Kritikus!
Literaturkanon Denis Scheck empfiehlt 100 beste Bücher. Emanzipatorische Werke kommen eher nicht vor, aber ein paar Frauen
Kriterienkrise
Roman „Miroloi“ von Karen Köhler soll Symptom einer immer schlechteren Literatur sein, ist aber für den Buchpreis nominiert
Lies mich, Baby!
Debatte Literaturkritik sei frauenfeindlich, meint der Hashtag #dichterdran und kontert. Aber ist nicht oft schon die Autoreninszenierung sexistisch?
Gefecht des Grauens
Literarisches Quartett Katharina Schmitz sorgte sich, ob das Literarische Quartett Joachim Meyerhoff kapiert. Und was „die Dorn“ sagt. Jan C. Behmann sah mit dem Zweiten irgendwie nicht besser
Hier irrte MRR
Marcel Reich-Ranicki Wie der deutsche Verriss-Spezialist einmal an Jurek Becker scheiterte
Der Lumpenhund
Literatur Marcel Reich-Ranicki galt als knurriger Großkritiker. Ein neuer Sammelband zeigt auch andere Seiten
Bachmannpreis
A–Z Haben Sie gewusst, dass Rainald Goetz 1983 trotz blutiger Stirn keinen Preis bekommen hat? Und was macht der Sieger von 2009, Jens Petersen? Das Lexikon von Jan Drees
Blogs statt Literarisches Quartett
Debatte In der professionellen Literaturkritik ist kaum noch Geld zu verdienen. Sind privat betriebene Buchblogs die Lösung?
Furios in den Untergang
Literaturkritik Wie beim Zeitungssterben verschwinden die klassischen Literaturkritiken. Das hat teils ökonomische Gründe. Aber was ist bloß mit der literaturpolitischen Einstellung los?