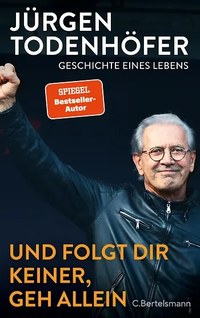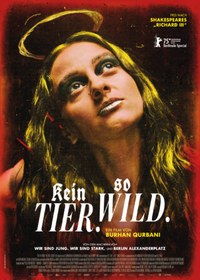Ein Thema im französischen Präsidentschaftswahlkampf werden die Rechte der Bürger im Netz sein - auch wegen Libyen
HADOPI klingt dank der Vokale sympathisch. Die „Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur l’Internet“ ist es nicht. Diese Hohe Behörde für die Verbreitung von Werken und dem Schutz von Rechten im Internet ist die größte und bislang wirksamste staatliche Datenkrake, die außerhalb von Geheimdiensten auf europäischem Boden installiert worden ist. Ihr Sitz: 4, rue du Texel, Paris. Eine Adresse, die letzten Veröffentlichungen zufolge einer halben Million Franzosen ziemlich geläufig ist.
Einer von ihnen ist Robert Tollot, 54, Gymnasiallehrer für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Departement Loire. Innerhalb von neun Monaten hat er drei Schreiben von Hadopi erhalten, das letzte hat ihn für den 23. September nach Paris zu einer förmlichen Anhörung zitiert. Ihm drohen schlimmstenfalls ein Strafverfahren und die Sperrung seines Internet-Anschlusses für ein Jahr, wenn er sich in der Anhörung nicht von dem Verdacht befreien kann, illegal Dateien aus dem Internet heruntergeladen oder dies zugelassen zu haben.
Lehrreiches MusterDrei Schreiben, das ist die Umsetzung des Prinzips der „three-strikes“ (dt.: „abgestufte Erwiderung“), wonach Verdächtige zunächst per einfachem Brief oder Email abgemahnt werden, im Wiederholungsfall die Abmahnung per Zustellung erfolgt und zuletzt zu Sanktionen ausgeholt wird. Nach Meinung von Marie-Françoise Marais, Präsidentin von Hadopi, ein vor allem belehrender Vorgang. In einer Fernsehdiskussion Anfang Juni sagte sie in Richtung ihrer Kritiker: „Hören Sie doch auf, uns mit dem Image von Gendarmen ans Zeug zu flicken. Selbst die abgestufte Erwiderung ist im Grunde pädagogisch. Was wir versuchen, ist zu sensibilisieren, zu informieren, dem Nutzer Verantwortung beizubringen.“ Wie sehr, gab ihre Behörde einen Monat später in einer Pressekonferenz erstmals bekannt.
Seit Aufnahme der Tätigkeit im Januar 2010 wurden Hadopi über 18 Millionen Vorgänge nebst den IP-Adressen gemeldet, von denen Rechteverletzungen ausgegangen seien. Hieraus hat sie 1.000.000 konkrete Identifikationsaufträge an Internetdienstanbieter erteilt, um der Anschlussinhaber habhaft zu werden. Mehr, so der Tenor in der Aussendung, sei wegen „noch fehlender Ausstattung“ nicht möglich gewesen. Auf der Grundlage von 900.000 Anschlüssen, die Personen zugeordnet werden konnten (rund 100.000 fielen wegen dynamischer IP-Vergaben weg oder waren unklar übermittelt), wurden sodann 480.000 erste Abmahnschreiben versandt, denen 21.000 zweite Aufforderungen zum Wohlverhalten folgten. Aus diesen schließlich wurden einige Fälle „sorgfältig ausgewählt“, die wie der von Lehrer Tollot konkreten Sanktionen zugeführt werden sollen.
Auch wenn die Anzahl der nun bekannt werdenden Einzelschicksale -es werden zwischen zehn und ein paar Dutzend kolportiert- nicht beeindruckend sein mag, die Diskussion um die Legitimität der Einrichtung ist in Frankreich wieder voll entbrannt.
Rasterfahndung in privater HandUmstritten ist vor allem die Quelle der Daten. Denn die angeblichen Rechtsverstöße werden nicht von der Behörde selbst festgestellt, sondern von fünf Verwertungsgesellschaften, die in Frankreich ähnliche Aufgaben erfüllen wie in Deutschland etwa GEMA oder VG Wort. Diese Sociétés Ayant Droit genannten Rechteinhaber erhielten von der Datenschutzbehörde Frankreichs (CNIL) 2010 die exklusive Erlaubnis, das Netz nach Urheberrechtsverstößen zu crawlen. Diese wiederum bedienen sich dazu der Trident Media Guard (TMG) mit Sitz in Nantes, ein auf P2P-Kommunikation spezialisiertes Unternehmen, das die technische Seite der gigantischen Datenkollekte und Weiterleitung an Hadopi abwickelt. Hauptaktionär von TMG ist neben Einzelpersonen der anonyme französische Finanzinvestor Ouest Venture.
Der darin ohnehin zum Ausdruck kommende schwach entwickelte Sinn für Datenschutz wird derzeit einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Vergangenen Mai waren im Netz Dateien aufgetaucht, die konkrete Rückschlüsse auf Rechner und damit Personen zuließen, die ins Visier von TGM geraten waren. Das Unternehmen hatte einen seiner Server offen wie ein Scheunentor gelassen, so dass sich dort jeder frei bedienen konnte.
Die Datenschutzbehörde, die noch ein Jahr vorher den Technikern einen Persilschein zur größten und privatimsten Rasterfahndung in der Geschichte Frankreichs erteilt hatte, reagierte nervös. Sie beauftragte zunächst eine ebenfalls private Prüfungsgesellschaft, das Gebaren von TGM zu untersuchen, um kurz darauf die Notbremse zu ziehen. Von den Seiten ihrer Internet-Präsenz gab CNIL den Beteiligten einschließlich der Verwertungsgesellschaften eine Frist bis 16. September, um Mängel abzustellen – unter anderem Ersatz veralteten Equipments, Schließung physischer Sicherheitslücken und Installation von formellen Prozeduren, die den Datenschutz garantierten.
CNIL hat sich freilich nicht zu eventuellen Sanktionen geäußert. Auch Hadopi hat auf Anfrage von Numerama, neben PCInpact das engagierteste online-Magazin zum Thema, zu den möglichen Konsequenzen die Auskunft verweigert. Eine verständliche Reaktion, denn letztlich stellt die Sorglosigkeit im Umgang mit Daten, die als Beweis für Strafverfahren dienen sollen, nur ein weiteres Symptom einer Malaise dar. Und die ist bei den Verwertungsgesellschaften selbst angesiedelt.
Undurchsichtige QuerverbindungenIn ihrem Bericht vom Mai 2011 hat die zuständige Kontrollkommission des französischen Rechnungshofes festgestellt, dass seit 1985 die Anzahl der Verwertungsgesellschaften von 3 auf 25 gestiegen ist. Die dabei anzutreffenden sächlichen und personellen Verflechtungen „erreichen die Grenzen des Erträglichen“, wie es ein Mitglied der Kommission ausgedrückt hat. Mit der Zahl der Interessenswahrnehmer seien auch deren Einnahmen aus Abgaben (etwa auf CD-Rohlinge, USB-Sticks oder Theateraufführungen) sprunghaft gestiegen. Sie beliefen sich für 2008 auf 1,25 Milliarden Euro, 2010 waren es bereits 1,5 Milliarden.
Aber nur knapp die Hälfte komme dann tatsächlich bei Autoren und sonstigen unmittelbar Kulturschaffenden an. Der überwiegende Anteil der Einnahmen versickere in Verwaltungskosten, oft auch nur in Sitzungsgeldern. Wie etwa bei SDRM, der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Rechten bei mechanischen Reproduktionen. Sie leistet sich einen Verwaltungsrat von 14 Personen, für die tatsächliche Arbeit dagegen einen Generaldirektor und eine Generalsekretärin. Der Bericht der Kontrollkommission dazu: SDRM spiele eine paradoxe Rolle im System der Rechteverwaltung – einerseits zentral als Zwischenstation mehrerer bedeutender Rechteverwerter, andererseits „eine Gesellschaft, die im Laufe von 35 Jahren all ihrer eigenen Mittel entkleidet worden ist, mit Ausnahme von zwei bezahlten Führungskräften“, von denen eine das zweithöchste Gehalt in der Branche verdiene. Es gebe „keinen vernünftigen Grund für ihre Existenz.“
Gleichwohl ist SDRM einer der fünf Verwerter, die zur Datenkollekte bei Hadopi zugelassen worden sind. Ein Grund oder Kriterien für die Auswahl sind nie öffentlich gemacht worden.
Politische Ansätze: Hadopi muss wegAutoren selbst sind in der Sache gespalten. Auf der einen Seite etwa der Regisseur und Produzent Luc Besson („das 5. Element“), der File-Sharing-Plattformen schon mal mit „Drogendealern“ verglichen hat. Anders Jean-Luc Godard (u.a. „Passion“) – der Altmeister der Nouvelle Vague ist ganz selbstverständlich gegen Hadopi. „Es gibt kein intellektuelles Eigentum“ und: „Ich bin gegen das Vererben. Ich finde es nicht zwangsläufig, dass die Erben von Ravel heute noch Rechte aus dem Bolero ziehen.“ Der bekannte Journalist Christophe Hondelatte hat soeben sein erstes musikalisches Album vollständig und gratis ins Netz gestellt. Hadopi sei „nur ein Lockvogel“, meint er; mehr als 10.000 würde er ohnehin nicht verkaufen. Aber vielleicht bekomme die Audience auf die Weise Lust, ihn live im Konzert zu erleben, teilt er seinem potentiellen Publikum mit.
„Die Behörde in ihrer heutigen Form und mit ihren heutigen Aufgaben kann nicht anders als abgeschafft werden, zu sehr ist die Unterdrückung in ihr Genom eingeschrieben.“ In einem Interview vom 25. August mit Numerama spricht Ludovic Pénet Klartext. Auch wenn er betont, sich als Privatperson zu äußern, seine Stimme ist die des sozialistischen Abgeordneten Christian Paul, dessen Berater in Sachen neue Medien er seit 10 Jahren ist. Und Paul leitet den sozialistischen Thinktank „Laboratoire des Idées“.
Statt immer neue Gebühren und zu deren Absicherung repressive Methoden zu schaffen, müsse eine Grundversorgung auch im Netz installiert werden. Damit meint er auch Qualität: „Das Fehlen von Mehrwert in bestimmten offiziellen Medien gegenüber gewissen spezialisierten Blogs schockiert mich immer wieder.“ Finanziert werden könne dies über einen Beitrag zusammen mit den Zugangsgebühren zum Netz, die an die Stelle vergleichbarer Abgaben treten und von der ein Anteil den Autoren zufließen würde. Was es auch ermöglichen würde, die Höhe der Beträge sozial ausgewogen zu gestalten. „Wir kommen nicht um eine Gestattung oder Toleranz eines Grundaustausches herum, der für alle Werke gilt, ob musikalisch, audiovisuell oder anderer Art.“ Daneben gäbe es genug Platz auch für die privaten Anbieter, „sofern sie Interessanteres bieten als nur eine P2P-Plattform“.
Konvergierende InteressenOb mit dem kommenden 22. April 2012 diese Pläne konkrete Formen werden annehmen können, hängt nicht nur von dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab. Die Beharrungskräfte sind enorm.
Sie sind nicht nur bei den Verwertungsgesellschaften anzusiedeln, die mehr oder weniger verbunden mit Großverlagen zur medialen Landschaftspflege Frankreichs intensiv beigetragen haben. Die Disziplinierung des Netzes, harmlos als pädagogisches Projekt deklariert, ist ein politisches Anliegen.
Wie sehr, das hat das Wall Street Journal am vergangenen Dienstag aufgedeckt („Firms Aided Libyan Spies”). Vor allem Amesys, nach Recherchen des Blattes eine Unterabteilung des französischen Computerherstellers Bull S.A., habe dem libyschen Machthaber Gaddafi Technologie geliefert, um den gesamten Verkehr im Netz zu überwachen. Die Akteure in Chats und sozialen Netzwerken, Email-Inhalte, Skype-Verbindungen und Video-Plattformen seien dank „Deep Packet Inspection“ offen gelegt und protokolliert worden, „das Regime konnte sich besser auf die Gefahren einstellen, die vom Aktivismus im Internet ausgingen“.
Dazu passt die Vorlage, die der UMP-Abgeordnete Bruno Bourg-Broc, eine Woche zuvor geliefert hatte. In einer schriftlichen Anfrage vom 23. August an das Ministerium für Kultur und Kommunikation begehrte er zu wissen, „ob die Rolle der Überwachung und Vorbeugung der Agentur Hadopi übertragen werden könnte“. Die Fürsorge des Abgeordneten gilt „sozialen Netzwerken, die das Leben von bestimmten Personen zerstören“ würden, die „von jungen Menschen gelesen werden, die leicht zu manipulieren“ seien und die „zu Konflikten aufrufen, die dann auf den Straßen landen“. Bourg-Broc ist Mitglied der „gemeinsamen Erhebungsmission des Abgeordnetenhauses zur Lage der Rechte des Individuums in der informationellen Revolution“.
Zwar reagierte die UMP unverzüglich. Der für Neue Technologien zuständige Sprecher der Partei twitterte: „Habe mit dem Kollegen Abgeordneten telefoniert #résauxsociaux … Er hat nur eine Frage an den Minister gestellt. Will ganz klar nicht weiter gehen. #Affaireclose.“ Letzteres bedeutet: Die Affäre ist damit abgeschlossen.
Arabische VerhältnisseEin Ordre Mufti, dem die Ankündigungen von Hadopi aber entgegenstehen. Im Juni wurde in Aussicht gestellt, die Behörde werde sich demnächst nicht mehr nur auf Identifikationen im P2P-Verkehr beschränken. Sobald die technischen und gesetzlichen Voraussetzungen gegeben seien, würde auch anderer Datenaustausch im Netz nach Rechtsverletzungen durchsucht werden. Der Rahmen von täglich 125.000 Meldungen an Hadopi sei noch lange nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig werden Überlegungen angestellt, wie angebliche Delinquenten an den Kosten von Hadopi beteiligt werden könnten. Ein Gesetz, das den Rechteverwertern Schadensersatzansprüche aufgrund von Verletzungen einräumt, die von Hadopi festgestellt worden sind, ist Anfang Juli verabschiedet worden.
Die Gemengelage hat den sozialistischen Abgeordneten Christian Paul veranlasst, seinerseits am 1. September eine schriftliche Anfrage an die Regierung zu richten. Er will wissen, ob die Regierung den Export der Technologie erlaubt hat, die es dem libyschen Regime ermöglicht hat, das Netz zu überwachen. Denn: „Das Recht auf eine Verbindung für alle und die digitalen Freiheiten sind heute Teil der Prinzipien, die unsere Republik ohne weiteres zu verteidigen hat.“ Das Wahlkampfthema der bürgerlichen Freiheiten im Netz ist damit eröffnet.
Für Robert Tollot ist das alles noch wenig tröstlich. Ihm wird vorgeworfen, Musik und zwei Filme aus dem Netz illegal heruntergeladen zu haben, auch wenn er, wie er Hadopi wissen ließ, „gar nicht weiß, wie das geht“ und „zum Zeitpunkt eines Downloads in einem Klassenzimmer war, um Unterricht zu geben.“ Indiskretionen weisen darauf hin, dass die Behörde deswegen auf eine andere Linie schwenken will. Dem Lehrer soll nun vorgeworfen werden, er habe seinen Anschluss nicht genug gegen Fremdzugriff gesichert. Auf diesem Umweg soll exemplarisch das Prinzip eines „Begehens durch Unterlasssen“ durchdekliniert – und der einzelne Nutzer zum Counterfighter gegen angebliche Netzpiraterie aufgebaut werden.
Sorgfältig ausgewählte Fälle unter pädagogischem Profil wird es noch viele geben. Nicht nur in Frankreich. e2m