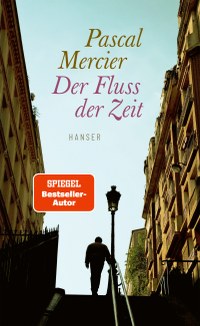Die „Programmreform“ des Kulturkanals WDR 3 unter Ägide der Intendantin Monika Piel wurde durchgewinkt – mit großer Mehrheit, wie es hieß. Dieser Majorität schien es zu aufreibend, sich eingehend mit den Argumenten der Radioretter – Initiative für Kultur im Rundfunk zu befassen. Sie wollte wohl auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich der Protestwelle am Ende fast 19.000 Hörer, WDR-Mitarbeiter, Autoren, Wissenschaftler und Künstler angeschlossen hatten. Das Aufbegehren, so scheint es, ist erstickt.
Ein Blick in die Stellungnahme des Aufsichtsgremiums zeigt, dass man gegenüber dem Widerstand der Öffentlichkeit und der eigenen Mitarbeiter verbale Konzessionen machen musste. „Erkennbar“, so heißt es da, seien Anregungen aus der Diskussion in das Konzept der Hörfunkdirektion eingeflossen. Gelobt wird z.B., dass die „Resonanzen“, hauptsächlich ein Sendeplatz für Wiederholungen, künftig einen „pointierten Kultur-Kommentar enthalten“ sollen; ebenso, dass das einstündige Musikfeature „im Grundsatz erhalten“ bleibt. Zur „Profilschärfung“ soll ein wöchentlicher Radio-Essay beitragen, auch der Literatur wird redaktionelle „Stärkung“ versprochen. Der Rundfunkrat empfiehlt seinem Sender sogar eine „veränderte Kommunikationsstrategie“ im Umgang mit der Öffentlichkeit und wünscht sich eine „Zukunftswerkstatt“ für die „Entwicklung neuer Sendeformate“.
Kultur-Info-Schiene
Die „Radioretter“, darunter zahlreiche betroffene Redakteure, weisen in ihrer Erwiderung allerdings nach, dass WDR-Leitung und Rundfunkrat vielfach als Neuheit ausgeben, was ein alter Hut ist: So gab es in den „Resonanzen“ schon immer einen Kultur-Kommentar – nur wird der nun nach der neuen Planung um etliche Minuten gekürzt. Das Angebot einer „Zukunftswerkstatt“ empfinden die Kritiker als Hohn: Nachdem über die Zukunft bereits entschieden wurde und der Boden, bildlich gesprochen, mit Pestiziden verseucht sei, richte man nun eine Umweltgruppe ein.
Dass erstmals eine gemeinsame Initiative von Radiomitarbeitern und -hörern sich so deutlich Gehör verschafft und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an seine Aufgaben erinnert hat, wird freilich nicht ohne Folgen bleiben. Zwar wird die alte Garde im WDR die seit zehn Jahren praktizierte Politik der kulturellen Verarmung vorerst fortsetzen und die Probleme in der ARD vermehren. Die Alternative zu einer „durchhörbaren“ Kultur-Info-Schiene ist indessen klar umrissen: ein Kulturradio, das dem Anspruch seiner Hörer auf Qualität, Kritik und Reflexion gerecht wird und sich zugleich die Vielfalt neuer Formate und Kommunikationsformen, einer neuen Radiopraxis im digitalen Zeitalter erschließt.
Klaus Kreimeier
Klaus Kreimeier ist Publizist. Von 1997 bis 2004 war er Professor für Medienwissenschaft an der Universität Siegen