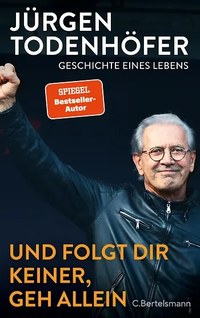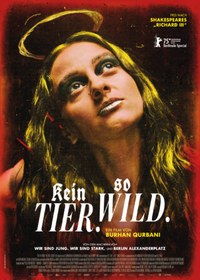Über Nacht wieder neue beängstigende Nachrichten aus Japan: Inzwischen geht die dortige Regierung von einer weiteren Kernschmelze in einem zweiten beschädigten Reaktor aus; in vier weiteren Meilern ist die Kühlung nach dem schweren Erdbeben ausgefallen. Ausgetretene Radioaktivität, Strahlenopfer, staatliche Jod-Ausgabe, Massenevakuierungen – die Zeitungen schreiben von einem Wettlauf gegen die Zeit, und auch ein anderer Wettlauf hat längst begonnen, ein Rennen gegen profitgetriebene Unvernunft, technologische Hybris und die Wiederholung politischer Fehler.
Wird „die Politik“ jetzt die Lehre aus Fukushima und Tschernobyl ziehen? Sie zieht Schlussfolgerungen und passt ihre kurzfristigen Strategien an, aber das ist ja nicht dasselbe. „Ich glaube, dass das heute nicht der Tag für politische – geschweige denn parteipolitische – Debatten ist“, hat Umweltminister Norbert Röttgen am Samstag erklärt. Und jeder fragt sich, wann eigentlich ein besserer Tag wäre, die Fehlentscheidungen der Vergangenheit einzuräumen und für einen Neuanfang zu plädieren. Kanzlerin Angela Merkel flüchtete sich in einen schon grotesk anmutende Erklärung, die den GAU in Fukushima in ein Zeichen verwandelte, „dass es Kräfte der Natur gibt, vor denen wir machtlos stehen und die von uns immer wieder ein Stück Demut erfordern“. Ganz so, als ob die ganze Atomkraft vom Himmel gefallen und nun der Laune eines transzendenten Prinzips unterworfen ist: „Wir wissen, dass wir auch ein Stück weit in Gottes Hand sind.“
Das mag als Privatansicht noch durchgehen, als Denkvoraussetzung für eine Regierung wäre es gefährlicher Unfug. Und das so einen Satz eine Physikerin ausspricht, macht die Sache nicht besser. Wahr ist ohnehin: Merkel spannt sich hier einen Schirm auf, der sie vor dem politischen Fallout schützen soll. Es folgen jetzt zwei Wochenenden mit Landtagswahlen, in denen sich viel entscheiden kann (auch wenn das, was da entschieden wird, im Vergleich zu der Aufgabe eher gering ist, die Fukushima ins Gedächtnis ruft). Die Atomparteien Union und FDP haben ein Problem, die Grünen können abermals hoffen, SPD und Linke müssen fürchten, bei all dem nicht die Rolle zu spielen, die sie sich selbst gern zuweisen. Die Debatte um die Laufzeitverlängerung im Herbst hat gezeigt, dass das Atomthema mehr als viele andere mobilisierungsfähig ist.
Und genau deshalb wird jetzt mächtig auf die Bremse getreten. Zuallererst von Union und FDP. Auch Guido Westerwelle versuchte umgehend, der Diskussion sie Spitze zu nehmen. „Der Parteienstreit kann warten“, sagt der Außenminister als ob das in einem Konflikt zueinander stünde, „die Hilfe für die Menschen in Japan nicht.“ Diese Rhetorik, die vor allem eines ist, nämlich parteipolitisch, hat auch der SPD-Vorsitzende übernommen. „Wir sollten das Leid der Japaner“, sagt Sigmar Gabriel, „nicht für unseren innenpolitischen Streit instrumentalisieren.“ Zum Glück entscheiden diese Leute nicht allein, was innenpolitisch zur Streitfrage wird. Man hat es an den Mahnwachen des Samstagabend gesehen, an der kleinen Berliner Demonstration, am unerwarteten Zulauf bei der Menschenkette im Südwesten. Man wird es – die Wahlforschung weiß über den oft entscheidenden Effekt der letzten Wochen vor einem Urnengang – wohl auch in Sachsen-Anhalt, mehr noch aber in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Ergebnissen ablesen können. „In den kommenden Wochen müssen wir auch in Deutschland die Atomfrage erneut auf die Tagesordnung setzen“, hat wie viele jetzt der SPD-Umweltpolitiker Michael Miersch gefordert. Wir müssen, fordert die Spitze der Linkspartei, „zu einer Politik der systematischen Reaktorabschaltung kommen, unverzüglich und unumkehrbar“.
Der vielleicht entscheidende Punkt wird sein, ob und wie sich die Spannung der Aktualität, die von den Bildern aus Japan und der naiven Klarheit des unmittelbaren, nicht von realpolitischen Zwängen schon eingefangenen Gedankens getragen ist, in das politische Geschehen der nächsten Monate übertragen lässt. Am Atomkraftwerk Fukushima ist mit Borsäure und Meerwasser vielleicht nichts mehr zu gewinnen. Hinter dem strahlenden Schrecken verbirgt sich aber eine viel weiter reichende Frage, eine, die jetzt auch schon mit Hoffnung verbunden wird. Fukushima läute „das Ende des Atomzeitalters“ ein, titelt der Spiegel (jedenfalls online), und viele hoffen ausnahmsweise, das Blatt möge einmal Recht behalten. Eine Parallele drängt sich auf, die zur Reaktorkatastrophe von 1986, die doch schon hätte Grund genug sein müssen, den atomaren Energiekurs zu verlassen. In der Bundesrepublik (West) ist seither kein Meiler mehr gebaut worden, der ab 1998 eingeschlagene Weg zum Ausstieg aber führte in einen viel zu langen Umweg, und inzwischen hat die schwarz-gelbe Koalition ja auch diesen wieder verlassen. Wie viel GAU ist eigentlich nötig, damit Gesellschaften ein Ereignis als letztgültigen Beweis ansehen, als Wendepunkt?
Die Frage richtet sich übrigens nicht nur an die Parteien, und auch nicht nur an die der schwarz-gelben Regierungskoalition. Dass SPD und Grüne 2001 nur einen schwachen, einen gefährlichen Kompromiss mit den Energiekonzernen aushandelten, lässt sich nicht – wie es jetzt gern noch einmal in Erinnerung gerufen wird – allein mit politischem Opportunismus oder bösem Willen der Akteure erklären. Es fehlte auch der gesellschaftliche Druck, weil viele glaubten, mit der Wahl einer rot-grünen Regierung schon das Nötige getan zu haben. Mehr noch, es fehlte an einer Wechselstimmung, die über die Farben der Koalition und die Wahl des Stromanbieters hinausweist, die das Soziale in der Energiefrage aufgreift, das Öffentliche an den Netzen, das Ökologische an der Erzeugung, das Ökonomische an den globalen Bedingungen der Produktion. Und die das alles verbindet zu der Einsicht, dass man dafür vielleicht auch sein ganz eigenes Leben wird ändern müssen, dass man nötigenfalls dafür jeden Tag auf die Straße geht und nicht nur ab und an zur Wahl, dass sehr schwierige Entscheidungen nötig werden, weil man das Erbe von einem halben Jahrhundert atomaren Irrsinn nicht einfach ausschlagen kann.
auch erschienen auf lafontaines-linke.de