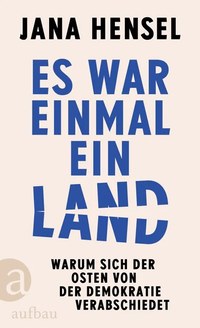Und folgt dir keiner, geh allein!
Wer konsequent für die Wahrheit eintritt, ist oft allein. Unbequeme Wahrheiten haben keine Mehrheiten hinter sich. Ich war in meinem Leben viel allein. Manchmal dachte ich dann an Mahatma Gandhi, den großen Kämpfer für Frieden und Gewaltlosigkeit. Jahrelang wurde er verhöhnt, verspottet. In den Stunden totaler Einsamkeit sang er ein altes indisches Volkslied, das, frei übersetzt und gekürzt, lautet:
Fürchte die Einsamkeit nicht, wenn du die Wahrheit kennst! Geh allein! Gib nicht auf, wenn niemand deine Meinung achtet!
Auf deinem Weg wird es Stürme und Hindernisse geben. Halte an deinem Glauben fest. Eines Tages werden sie auf dich hören und deinen Ratschlägen folgen.
Warum ich tue, was ich tue
Das werde ich seit Jahrzehnten gefragt. Vor allem, wenn ich wieder einmal den Mainstream, die Diktatur der herrschenden Meinung, gegen mich habe. Und deshalb ausgelacht, beschimpft und manchmal auch ausgegrenzt werde. Merke ich denn nicht, dass ich mir damit vieles verbaue? Dass mein ganzes politisches Leben anders verlaufen wäre, wenn ich häufiger zu politischen Fehlentwicklungen geschwiegen hätte? Oder war ich wirklich ein unbelehrbarer, eitel-naiver Besserwisser, ein Israelfeind, ein Terroristen- und Diktatorenfreund, ein »Gutmensch« oder ein Populist? Konnte ich mich nicht wenigstens ab und zu taktisch klüger verhalten?
Musste ich wirklich – zusammen mit einem jungen Palästinenser – Strafanzeige gegen die deutsche Bundesregierung erstatten, als diese im Gazakrieg Waffen für den längst völkerrechtswidrigen Krieg Israels lieferte? Machte ich mich durch derartige Aktionen nicht automatisch zu einem Außenseiter, dem Anhänger des Mainstreams öffentlich gar nicht zustimmen konnten? Selbst dann nicht, wenn sie ähnlich dachten wie ich? Machte ich es meinen Freunden und Anhängern nicht verdammt schwer?
Warum setze ich mich überhaupt so heftig gegen Kriege und Waffenlieferungen ein, selbst wenn die herrschende Meinung des Westens wieder einmal erklärt, wenigstens dieses eine Mal noch müsse ein Krieg ausnahmsweise sein! Werde ich von fremden Mächten finanziert? Warum trete ich gegen den wachsenden islamophoben Rassismus selbst dann ein, wenn ein junger Migrant gerade wieder einmal eine besonders widerliche Gewalttat begangen hat? Bin ich heimlich zum Islam konvertiert?
Warum verschenkte ich den größten Teil meines Vermögens an vereinsamte alte Menschen, an Schwerstkranke oder an Kriegsopfer im Mittleren Osten und auch in Afrika? War das möglicherweise einfach ein geniales Finanzmodell? »Was ist Ihr steuerlicher Trick?«, fragte mich ein wohlmeinender Journalist. »Rechnet sich das?« Manche Gegner sprechen verschwörerisch vom »Modell Todenhöfer«, wenn sie erfahren, dass ich auch das Honorar meiner Bücher an Menschen in Not spende. Sie denken, ich würde durch das Verschenken meines Einkommens und meines Vermögens reich. Doch inzwischen besitze ich keine fünf Prozent mehr von dem, was ich einst besaß. Weil ich viel mehr verschenkt habe, als man in den Augen unserer Finanzbehörden verschenken sollte. Warum mache ich das alles? Warum lasse ich mich für all das auch noch öffentlich beschimpfen? Warum riskiere ich dafür immer wieder sogar mein Leben? Etwa in den achtziger Jahren gegenüber den sowjetischen Besatzern in Afghanistan. Bis heute erinnert mich der Splitter einer Kalaschnikowpatrone im linken Knie an die Beschießung in den Bergen des Hindukusch. Ähnliches passierte mir auch durch befreundete westliche Staaten. 2019 schossen mir im Gazastreifen israelische Sicherheitskräfte mit einem Hartplastikgeschoss in den Rücken, als ich dort gewaltfrei und respektvoll für ein besseres Miteinander von Israelis und Palästinensern demonstrierte. Für die goldene Regel westlicher, östlicher und auch israelischer Ethik, andere Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Drei schwere Schulteroperationen hat mir diese Beschießung durch israelische Scharfschützen eingebracht. Schulterschmerzen bis an mein Lebensende. Zwei Fälle von mehreren. Ich stand auf den Todeslisten der RAF und stehe auf der Abschussliste des IS.
Warum mache ich das? Warum dulde ich, dass mich – wegen meines Eintretens für Diplomatie statt Krieg und für Respekt statt Rassismus – eine mächtige Zeitung wie die Bild als »proislamistisch und antisemitisch mit Vorliebe für Diktatoren und Massenmörder« bezeichnete? Warum wehre ich mich nicht einmal juristisch gegen derartige Verleumdungen? Warum nehme ich schweigend hin, dass eines Morgens vor der von mir gegründeten Stiftung »Sternenstaub« ein Galgen hing, an dem ich offenbar hängen sollte. Dass mir Menschen seit Jahrzehnten Sätze schreiben wie: »Ich stech’ dich ab, du Dreckschwein!« Und: »Tod dem Höfer!« Dass zeitweise sogar meine Kinder von der Polizei geschützt werden mussten? Warum? Habe ich darauf wirklich eine überzeugende Antwort?
Wahrscheinlich hat mich der frühe Tod meines Bruders zum Nachdenken darüber gebracht, wie ich mein weiteres Leben sinnvoll gestalten sollte, ja, musste. Mein Bruder war bei seinem Freitod zweiundzwanzig, ich fünfundzwanzig Jahre alt. Bis dahin hatte ich das Leben mit vollen Zügen genossen und nichts ausgelassen. Hätte ich weiter so gelebt, säße ich heute vielleicht als Junkie in irgendeinem Park Münchens. Ich spürte damals, dass es nicht so weitergehen konnte.
Bei meiner grundsätzlichen, fast philosophischen Ablehnung von Kriegen spielte vieles eine Rolle. Dass ich die Schrecken der Bombennächte des Zweiten Weltkriegs noch sehr konkret miterlebt hatte. Dass ich später erfahren hatte, was Deutsche und andere Europäer in jener Zeit den Juden angetan hatten. Als Zwanzigjähriger hatte ich dann in Algerien und im tunesischen Bizerta hautnah erlebt, wie verächtlich europäische Kolonialisten die arabische Bevölkerung behandelten. War ich nicht auch ein Teil dieser westlichen Zivilisation, die weltweit trotz ihrer angeblich humanistischen Ziele ständig gegen die einfachsten Regeln menschlichen Zusammenlebens verstieß? Musste ich als Teil dieser Zivilisation nicht irgendwie mithelfen, dass die schlimmen Dinge, von denen ich wusste und die ich erlebt hatte, nie wieder geschahen? War das nicht die Aufgabe von uns allen?
Es waren die wilden sechziger Jahre. Der Kampf um den richtigen Weg wurde damals an den Universitäten, aber auch auf den Straßen, teils mit Gewalt, ausgetragen. Wer hatte recht? Der kapitalistische Westen oder der marxistische Osten? Ich hatte, offen gesagt, keine große Ahnung. Hatten die Wortführer der linken Straßendemos eine Ahnung?
Ich wusste nur, dass ich wenig wusste.
Meine Suche nach der Wahrheit
Unter dem Schock meines totalen Versagens beim Tod meines Bruders machte ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Und nach den sich daraus ergebenden Pflichten im Leben. Eine Suche, die ich bis heute nicht erfolgreich beenden konnte. Ich begann alle großen Philosophen zu lesen. Alle! Von Plato und Aristoteles über die großen Stoiker bis zu Kant. Meine damaligen Freundinnen und Freunde staunten. War ich nicht bis vor Kurzem ein zielloser Gammler gewesen, der nur Spaß und Vergnügen im Kopf hatte? Neben meinem Bett fanden sie plötzlich Bücher von Kant und Marx. Was war denn mit mir geschehen?
Ich las ferner alle großen Historiker, die ich in die Hände bekommen konnte. Bis heute. Ich musste herausfinden, was die Menschen früher geglaubt hatten und warum sie sich immer wieder geirrt und verirrt hatten. Warum waren selbst größte Zivilisationen untergegangen? Was sagte und dachte dazu der Römer Tacitus oder der Brite und US-Bürger Niall Ferguson? Was der Israeli Yuval Noah Harari, dessen Bücher ich verschlang? »Spinnt« Harari wirklich ein bisschen, wie mir Wolfgang Schäuble, der ihn auch mit Genuss gelesen hatte, schmunzelnd sagte?
Die nie endende Suche nach der Wahrheit war – neben meiner großen Neugier und auch einer Abenteuerlust – die Hauptmotivation meiner vielen Reisen. Ich fuhr nicht nur in den Mittleren Osten, sondern auch kreuz und quer durch Lateinamerika und Asien. Nach Kuba, Vietnam, China. Und immer wieder in die USA. Die letzte Fassung dieses Buches habe ich in Südamerika geschrieben. Auch meine Kinder nahm ich auf mehreren Reisen mit. Meine älteste Tochter Valérie musste außerdem Marx und Kant lesen, wie sie mir kürzlich schaudernd erzählte. Mein ganzes Leben wurde zu einer großen, spannenden Reise.
Die wichtigsten Erkenntnisse meiner Reisen und meiner Lektüre waren recht früh:
1. Es gibt keine anständigen Kriege. Man kann anderen nicht auf anständige Weise den Schädel einschlagen. Wer Kriege vor Ort miterlebt hat, weiß, dass die Legende vom »gerechten« Krieg eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte ist. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Wahrscheinlich haben Anhänger der Hamas am 7. Oktober 2023 auch Frauen vergewaltigt. So wie israelische Beamte in den dortigen Gefängnissen immer wieder junge Palästinenser vergewaltigen. Wir müssen alle Kriege ächten. Adeln müssen wir den Frieden.
2. Rassismus ist nicht nur ein Verstoß gegen alle ethischen Regeln unserer Zivilisation, sondern auch ein Zeichen von Ignoranz. Wer die Welt auch nur ein bisschen kennt, kann gar nicht Rassist sein. Die moderne Genforschung hat längst bewiesen, dass wir Mitteleuropäer seit Jahrtausenden eine bunte Mischung aus afrikanischen Auswanderern, anatolischen Ackerbauern und osteuropäisch-iranischen Steppenvölkern sind. Johannes Krause hat in seinem faszinierenden Buch Die Reise unserer Gene überzeugend dargestellt: Die Urbevölkerung Europas war nicht hellhäutig, blond und blauäugig, sondern schwarz. Alice Weidel ist, wie wir alle, zu je einem Drittel Schwarze, Anatolierin und iranisch-russischer Abstammung.
3. Reichtum verpflichtet. Egal, ob er marktwirtschaftlich oder sozialistisch erarbeitet wurde. Wenn es einem gut geht, sollte man sein Glück teilen. Die westliche Zivilisation hat sich mit den Werten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, mit Demokratie und Menschenrechten wertvolle Ziele gesetzt. Doch es reicht nicht, diese Werte zu deklamieren, wie die meisten unserer Politiker das tun. Man muss sie leben. Selbst dort, wo es den Verzicht auf die Durchsetzung kurzfristiger eigener Interessen bedeutet.
Das war in etwa mein Erkenntnisstand schon als Dreißigjähriger. Fünfzig Jahre weiteren Suchens nach der Wahrheit durch zahllose Reisen und Bücher, aber auch durch meine beruflichen Erfahrungen als Richter, Politiker, Unternehmensvorstand und Publizist haben diese drei zentralen Erkenntnisse immer wieder bestärkt. Sie sind meine Wahrheit. Doch diese Erkenntnisse standen schon damals wie riesige Berge vor mir. Wie sollte ich diesen großen Forderungen unserer Zivilisation gerecht werden? War nicht die Generation unserer Eltern und Großeltern gerade an diesen Aufgaben erbärmlich gescheitert? Konnte ich mir nicht kleinere Ziele setzen? Oder muss man nicht gerade als Jugendlicher groß träumen, wenn man die Welt irgendwann verändern will?
Ich fand, dass es die Aufgabe meiner und auch späterer Generationen war, die Welt zu einem humaneren Ort zu machen. Mitzuhelfen, dass wir nie mehr dort landeten, wo unsere Eltern gelandet waren. In Krieg und Rassismus. Ich fand, dass die Verhinderung von Krieg und Rassismus kein Größenwahn, sondern schlicht unsere gemeinsame Pflicht war. Und natürlich auch meine. Als Dreißigjähriger schwor ich mir, mich nie von diesen Zielen und Werten abbringen zu lassen. Und dafür bis an meine Grenzen zu gehen. Notfalls auch darüber hinaus. Wie andere junge Menschen auch.
Dann begann mein vielfältiges Berufsleben. Mit großen Herausforderungen, aber auch großen Versuchungen. Doch dem Schwur meiner Jugendjahre bin ich bis heute treu geblieben. Dass ich deswegen manchmal ausgelacht und verflucht wurde, war mir nicht ganz gleichgültig. Manchmal war das sogar ziemlich bitter. Jeder Mensch braucht Zuneigung. Auch ich. Doch ich wusste, dass harte Kritik bis zum Ausschluss aus der Gesellschaft nun mal der Preis war, den man zahlen muss, wenn man sich nicht der Diktatur der herrschenden Meinung unterwirft. Die Wahrheit ist fast immer in der Minderheit, wie schon der dänische Philosoph Kierkegaard bitter feststellte.
Viele Politiker haben genau deshalb panische Angst vor der Wahrheit. Das verleitete beispielsweise den deutschen Gesundheitsminister Lauterbach – als er gefragt wurde, was falsch daran sei, die Wahrheit zu sagen – zu dem entsetzten Geständnis:
»Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod, ich bitte Sie!« Für die meisten Politiker hat die Wahrheit keinen Stellenwert. Mehrheiten sind ihnen wichtiger. Ich habe einiges einstecken müssen, weil ich versuchte, auch unbequeme Wahrheiten sehr offen auszusprechen. Aber durfte ich mich über diese Kritik wirklich immer beschweren? Musste ich, nachdem ich andere hart kritisiert hatte, nicht akzeptieren, dass diese genauso hart zurückschlugen?
Und ich wurde ja nicht nur kritisiert. Zahlreiche Menschen haben mir viel Liebe entgegengebracht. Mehr, als ich erwarten durfte. Bis heute. Wenn ich durch die Straßen Münchens oder Berlins gehe, sprechen mich junge und alte Menschen an, nur um danke zu sagen. Weil ich ihnen aus dem Herzen gesprochen oder weil ich ihnen eine Stimme gegeben hätte. Mir hat iese Zuneigung von Menschen aller Bevölkerungsgruppen viel Kraft gegeben.
Was habe ich erreicht?
Außerdem hatte ich ein faszinierendes Leben. Erfüllter und spannender, als ich es mir jemals erträumt hatte. Es gibt kaum etwas, was ich nicht erlebt habe. Ich traf Präsidenten und Ganoven, Freiheitskämpfer und Terroristen, Bettler und Milliardäre, Waffenschieber und Friedensaktivisten. Menschen, die mich hassten, und Menschen, die mich liebten. Menschen trugen mich auf den Schultern über den Tahrirplatz in Kairo oder durch ihr Dorf in Gaza.
Habe ich einen Beitrag geleistet, die Welt zu einem humaneren Ort zu machen? Kaum! Das ist eine Aufgabe, der sich jede Generation stets von Neuem stellen muss – eine Sisyphusarbeit. Der riesige Felsbrocken, den König Sisyphus den Berg hochrollen sollte, rollte immer wieder herunter. Als Strafe der Götter für seinen Hochmut. Vielleicht war auch ich oft zu hochmütig. Aber vielleicht habe ich auch einige Menschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht erreichen sie eines Tages mehr als ich.
Vielleicht geht die Saat irgendwann auf. Vielleicht schaffen es die Jüngeren, Krieg, Rassismus und ähnliche Schändlichkeiten erfolgreicher zu ächten als ich. So, wie es heute niemand mehr wagt, offen für Sklaverei oder Hexenverbrennung einzutreten. Krieg und Rassismus sind nicht besser.
Verändert habe ich allenfalls das Leben des jungen Afghanen Abdul, der ohne meine Unterstützung keine Überlebenschance hatte. Oder das Leben der kongolesischen Kindersklavinnen Zipora und Chance, denen ich helfen konnte, eine Alternative zu ihrer Arbeit in den Minen des Kongo zu finden. Oder das Leben der hundert verzweifelten syrischen Kinder, denen ich Arm- und Beinprothesen besorgen konnte. Das war am Ende wahrscheinlich alles, was ich erreicht habe. Mehr war nicht drin.
Es war nichts Großes, aber auch nicht nur Kleines. Ich danke allen, die mir geholfen haben, diesen Weg zu gehen. Auch meinen Kritikern. Sie haben mich nachdenklich, aber auch stärker gemacht.
Ich weiß, dass ich diesen Weg gehen musste. Mein Bauchgefühl, mein »innerer Gerichtshof«, wie Kant das nannte, haben mir diesen Weg vorgeschrieben. Ich konnte gar nicht anders. Immer, wenn ich kurz davor war, den Mut zu verlieren, sagte mir mein Gewissen: »Und folgt dir keiner, geh allein!«