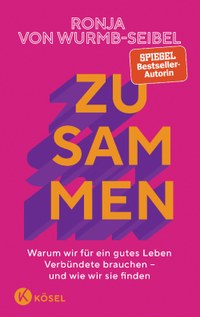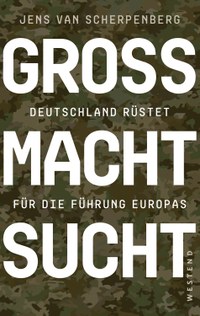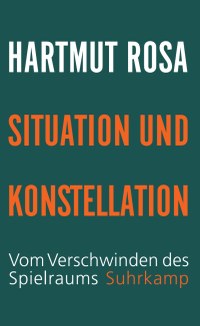Die Einladung kam überraschend. Irgendwann letzten Winter rief eine Bekannte aus unserem Dorf an und fragte, ob wir Lust hätten, an einem besonderen Abendessen teilzunehmen: Ein Sechs-Gänge-Menü, zubereitet von einem jungen Koch, der einige Zeit in einem Sterne-Restaurant in Kolumbien gearbeitet hatte. Er war seit ein paar Wochen zu Besuch bei unserer Bekannten und half auf ihrem Hof aus. Zusammen mit seiner Partnerin würde er alles frisch zubereiten, das Essen wäre vegetarisch-mexikanisch. Als Gäste wären ausschließlich Personen eingeladen, die sich jeweils noch nie zuvor begegnet waren, darunter mein Partner Nik und ich.
In unserem Dorf leben 470 Menschen. Es gibt kein Wirtshaus, kein Restaurant, keine Bar, kein Café. (Nur eine Bäckerei mit Tante-Emma-Laden, aber das ist eine andere Geschichte. Ich erzähle sie später im Buch.) Von dort, wo wir leben, bis zum nächsten Restaurant sind es mehrere Kilometer. Im näheren Umkreis gibt es Indisch, Bayerisch und Pizza. Sonst nichts. Nik und ich lieben Essen – wir mussten also nicht lange überlegen, als unsere Bekannte anrief, und sagten zu.
Ein paar Tage später machten wir uns auf den Weg. Obwohl der Abend gerade erst begonnen hatte, war es draußen längst dunkel. Februar, die Zeit der langen Nächte. Unsere Bekannte wohnt am anderen Ende des Dorfes. Wir waren zuvor erst zwei Mal bei ihr gewesen. Es lag nicht daran, dass wir uns nicht sympathisch waren. Irgendwie war nur immer viel los gewesen, seit Nik und ich vor zweieinhalb Jahren aus Hamburg hierher gezogen waren.
Unterwegs durch die Dunkelheit bemerkten wir eine gewisse Aufregung. Wir freuten uns nicht nur auf das Essen, wir waren auch gespannt auf die anderen Menschen. Und so ganz verstanden hatten wir immer noch nicht, was es mit dem Abend eigentlich auf sich hatte.
Das Erste, was wir vom Haus unserer Bekannten sahen, war die hell erleuchtete Küche, die mit dem Esszimmer verbunden ist. Noch von draußen beobachteten wir durchs Fenster mehrere Personen geschäftig hin und her laufen, Geschirr verteilen, Töpfe öffnen, dann wieder schließen. Die Scheiben waren vom Dampf angelaufen. Wir klingelten, begrüßten unsere Gastgeberin und wollten direkt in die Küche. Der Geruch, der zu uns in den Flur drang, war einfach zu gut. »Halt«, sagte sie, »da geht es heute nicht lang. Wir essen woanders.« Dann lotste sie uns und die übrigen Gäste – insgesamt waren wir zehn Personen – in einen anderen Teil des Hauses, eine alte Scheune, die zu einem riesigen Loft im Industriestil ausgebaut war und normalerweise als Meditations- und Yoga-Raum diente.
Wo sonst Matten und Sitzkissen lagen, stand heute eine lange Tafel, festlich gedeckt und mit Menükarten bestückt. Darauf standen Gerichte wie »Gebratenes Gemüse auf Romesco-Sauce, Perl- Tapioka-Cracker und schwarzer Olivenasche«. Oder »Kokos- Kürbiseis mit Sonnenblumenkernpraline und Minze«. Unsere Gastgeberin erzählte, dass der Koch in letzter Minute ein paar der Gänge noch einmal ausgetauscht hatte, weil er mit der Kombination nicht zufrieden war. Mehr als eine Woche lang habe er sich vorbereitet. Begonnen habe er damit, die einzelnen Zutaten und Gänge auf Papier zu zeichnen. (Als wir den Koch später kurz kennenlernten, sahen wir, dass er sogar Zeichnungen von Essen auf seinem Körper tätowiert hatte.) Das eigentliche Kochen habe dann etwa drei Tage lang gedauert.
Schließlich erklärte unsere Gastgeberin noch einige Regeln für unseren Abend: Keine Handys am Tisch. Alle sollten gemeinsam ein Gespräch führen – und nicht wie sonst oft mehrere einzelne nebeneinanderher. Und es gab ein fixes Thema, um das sich unsere Unterhaltung drehen sollte: »Eine bessere Zukunft!«, sagte unsere Gastgeberin. »Egal, was ihr euch darunter vorstellt oder was es für euch bedeutet.« Dann kam auch schon der erste Gang: »Süßkartoffel-Cracker an Kaffee mit Orange und Süßkartoffelasche«.
Die nächsten fünf Stunden verbrachten wir damit, das Essen zu bewundern, die Art, wie es präsentiert wurde, zu bestaunen – mal auf bei Flohmärkten zusammengesammelten Vintage-Bilderrahmen, die mit Moos ausgelegt waren, mal auf schwarz verkohlten (noch warmen!) Stücken Brennholz – und »hmm« und »ohhh« und »wow« zu sagen, weil es uns mehrfach so vorkam, als hätten wir diesen einen konkreten Geschmack noch nie zuvor in unserem Leben gekostet. Ehrlich, das Essen war fantastisch!
Zusammen nur eine Utopie?
Das wirklich Besondere an dem Abend, das, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, war aber etwas anderes: unser Gespräch. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde hatten wir begonnen, eine nach dem anderen, Ideen, Fragen oder Wünsche zu erzählen, die wir jeweils mit einer besseren Zukunft verbanden. Schnell wurde klar, dass unsere Biografien, unsere Berufe, unser Alter und sogar unsere politischen Ansichten sich im Grunde fast nirgendwo trafen. Dennoch führte unser Gespräch ziemlich geradlinig und ohne Umwege zu einer gemeinsamen Frage. Wie kann es gelingen, mehr Community aufzubauen, mehr Gemeinschaft zu erleben, mehr Zusammenhalt? Trotz aller Unterschiede war das die eine Sache, die uns alle beschäftigte, wenn wir in Richtung Zukunft dachten.
Das Gespräch war nicht sehr theoretisch. Wir suchten – und fanden – konkrete Ideen. Jemand redete davon, wie sehr Essen verbinden kann, jemand anders erzählte von der Erfahrung, dass um Hilfe zu bitten, und sei es bei Kleinigkeiten, ein guter Weg sei, um erste Kontakte aufzubauen – egal ob zu Nachbar*innen oder Kolleg*innen. Jemand anders wiederum stellte fest, dass sie Lust hätte, in einem Café zu arbeiten, weil auch das ein Ort sei, an dem Leute zusammenkommen und sich verbunden fühlen. Ein paar Sätze später waren wir gemeinsam bei der Idee eines Sonntags- Cafés gelandet, in dem jede Woche eine andere Person aus einem jeweiligen Dorf oder Stadtteil freiwillig kocht. Auf diese Weise würden, so war unser Gedanke, nicht nur immer unterschiedliche Gerichte auf den Tischen landen, sondern auch unterschiedliche Menschen an ihnen Platz nehmen.
So ging es den ganzen Abend. Wir waren uns nicht immer einig. Ich glaube nicht einmal, dass wir uns gegenseitig ausschließlich sympathisch fanden. Ich habe in der Zeit, die seit diesem Abend vergangen ist, außer der Gastgeberin keine der Personen wiedergesehen, und ich glaube nicht, dass jemand von ihnen unsere gemeinsame Idee vom Sonntags-Café umgesetzt hat.
Trotzdem ist bei mir an diesem Winterabend etwas entstanden, das bleibt. Die Frage, wie es sein kann, dass wir alle an diesem Abend auf Gemeinschaft und Zusammenhalt kamen, als wir anfingen, darüber nachzudenken, wie wir uns eine schönere Zukunft vorstellen.
Konnte es vielleicht sein, dass die Eingeladenen aus einem unwahrscheinlichen Zufall heraus überdurchschnittlich sozial vereinsamt waren? Ich glaube nicht. Alle, die an dem Abend mit am Tisch saßen, gingen einem geschäftigen Leben nach, pflegten Freundschaften, hatten Berufe, die sie, zumindest halbwegs, mit Sinn erfüllten.
Woran also lag es?
~
Wir alle leben heutzutage in einer Welt, die verbundener ist als je zuvor. Dennoch fühlen sich viele Menschen im Alltag einsam und sehnen sich nach neuen oder tieferen Verbindungen zu anderen Menschen. Bereits vor Beginn der Pandemie beschrieben etwa 14 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie sich einsam fühlten. Im Jahr 2021 verdreifachte sich dieser Wert. Fast die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland leben, waren damals also von Einsamkeit betroffen.
Und auch nach der Pandemie hat sich das leider nicht grundlegend geändert. Laut dem Deutschland-Barometer Depression, einer jährlich durchgeführten repräsentativen Befragung, fühlte sich 2023 noch jeder vierte Mensch in Deutschland einsam. Oft sei das Gefühl sogar unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Sozialkontakte. 86 Prozent der Befragten glaubten, dass sich heute mehr Menschen einsam fühlen als noch vor zehn Jahren.
Bei der Telefonseelsorge, die jährlich mehr als 1 Million Anrufe erhält, stand das Thema Einsamkeit 2023 an erster Stelle. Und die Stiftung Patientenschutz nennt Einsamkeit sogar »die größte Volkskrankheit in Deutschland«.
»Wir alle wurden in unterschiedliche Communitys hineingeboren und sind in unterschiedlichen Communitys aufgewachsen«, schreibt die Autorin Radha Agrawal.
Wir sind Rudeltiere, und wir können nur in solchen Gemeinschaften voll aufblühen, denen wir uns wirklich zugehörig fühlen. Trotz dieses Bedürfnisses und unserer Sehnsucht nach authentischer Gemeinschaft, erfahren viele von uns sie heutzutage nicht mehr in ihrem Leben.
Einsamkeit tötet
Fragen wir einmal uns selbst: Wie ist es in unserem eigenen Leben? Wie viele Leute haben wir in unserem Umfeld, die wir regelmäßig sehen – abgesehen von unseren Arbeitskolleg*innen? In der Schulzeit war es noch ganz normal, jeden Tag stundenlang zusammen abzuhängen. Viele von uns haben diese Routine im Erwachsenenleben verloren. Wir verabreden uns manchmal Wochen im Voraus, wir planen, wir erwarten. Wir bauen Slots in unseren Alltag, in denen Freundschaften stattfinden. Aber wirklicher Teil des Alltags sind sie nur selten.
In den USA sagt jeder vierte Mensch von sich, dass er oder sie keine Person habe, der sie sich anvertrauen könne. Vor dreißig Jahren war diese Zahl nur ein Drittel so hoch. »Wir feiern unverwüstlichen Individualismus, Wettbewerb, Unabhängigkeit und gegen den Strom schwimmen schon so lange«, schreibt Radha Agrawal, »dass wir vergessen haben, wie wichtig ein kollektives ›Wir‹ ist – und wie gut es sich anfühlt.«
Wozu das führt, erklärt die Sozialforscherin Brené Brown:
»Dass wir untrennbar miteinander verbunden sind, wird im Moment von uns weder anerkannt noch gefeiert. Vielmehr sind wir in fast allen Lebensbereichen von anderen getrennt.«6 Brown erforscht seit Jahren, unter welchen Umständen Menschen sich zugehörig fühlen. Immer wieder hätten Teilnehmende ihrer Studien die Sorge geäußert, dass das Einzige, was die Gesellschaft verbinde, geteilte Angst und Verachtung sei und nicht Menschlichkeit, Respekt, Vertrauen oder Liebe, so Brown.
Vivek H. Murthy, der oberste Leiter der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, geht sogar so weit, Einsamkeit als eines der größten gesundheitlichen Probleme unserer Zeit zu betrachten. Und als »beinahe universal-menschlichen Zustand«. Er beschreibt Einsamkeit wie einen Reflex, der uns zeigt, dass unser Bedürfnis nach menschlicher Verbindung nicht in dem Maße erfüllt wird, wie wir es brauchen: »Genau wie Hunger und Durst die Art unseres Körpers ist, uns zu sagen, dass wir essen und trinken müssen, ist Einsamkeit ein natürliches Signal, das uns daran erinnert, dass wir uns mit anderen Menschen verbünden müssen.«
Viele Menschen versuchen laut Murphy jedoch, dieses Gefühl zu unterdrücken, was sicher auch damit zu tun hat, dass Einsamkeit mit Scham behaftet ist. Den meisten fällt es schon schwer, überhaupt davon zu erzählen – geschweige denn, sich Hilfe zu holen, um etwas an ihrer Situation zu verändern.
Und das ist fatal.
Forschende der Universität Harvard untersuchen seit mehr als 80 Jahren, welche Faktoren dazu beitragen, wie alt wir werden. Die Studie begann im Jahre 1938 und läuft immer noch, es ist die weltweit längste und tiefgreifendste Studie überhaupt. Und sie zeigt seit Jahrzehnten ein eindeutiges Ergebnis: körperliche Gesundheit, finanzielle Sicherheit, soziale Schicht, Bildungsgrad, Gene, Status – alles schön und gut. Was wirklich zählt und vorauszusagen hilft, wie alt wir werden, ist allein die Qualität unserer sozialen Beziehungen.
»Einsamkeit tötet«, sagte Robert Waldinger, der Direktor der Studie. »Sie wirkt sich genauso heftig aus wie Rauchen oder Alkoholismus.«
Inzwischen ist auch in anderen Studien breit erforscht: Menschen, die sich einsam fühlen, haben eine höheres Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, an Depressionen, Angststörungen, Lungenkrankheiten, Stoffwechselstörungen, Gefäßleiden. Sie schlafen schlechter, fühlen körperlichen Schmerz stärker und begehen häufiger Suizid.
Im Gegensatz dazu machen uns erfüllte und verlässliche Beziehungen gesünder und in Krisen belastbarer. Je stärker wir mit anderen Leuten verbunden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir an Krisen und traumatischen Erfahrungen wachsen, anstatt an ihnen zu zerbrechen oder vor Angst zu verzweifeln. Traumatic growth, also traumabedingtes Wachstum, nennen Wissenschaftler dieses Phänomen.
Wenn Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören, leben sie nicht nur länger, sondern auch erfüllter, glücklicher und stabiler. In soziale Bindungen zu investieren – zum Beispiel in Form von Zeit oder Geduld – ist also das Beste, was wir für unsere Gesundheit tun können. Es ist die Vorsorge Nummer eins. »Freunde zu haben, einer Gruppe anzugehören, steigert die Überlebenswahrscheinlichkeit«, schreiben die Forschenden der Harvard-Studie.9 »Schlägt das Schicksal zu – und das tut es früher oder später –, sind es häufig unsere Freunde, die uns zur Seite stehen, die uns in stürmischen Zeiten helfen.«
Seit es uns Menschen gibt, sichert uns das Prinzip von Gemeinschaft und Zusammenhalt, wortwörtlich das Überleben. Wir Menschen brauchen Menschen.
»Unsere Instinkte für Gemeinschaft sind nach wie vor intakt und am Leben«, schreibt Murthy.
»Wenn wir eine gemeinsame Sache verfolgen, wenn wir eine gewisse Dringlichkeit verspüren, wenn wir bei einer Angelegenheit um Hilfe gebeten werden, bei der wir tatsächlich helfen können, werden die meisten von uns über sich hinauswachsen und zusammenhalten.«
Schon zum Zeitpunkt unserer Geburt sind wir mit gewissen Fähigkeiten ausgestattet, die uns soziales Handeln ermöglichen. Bereits als Babys, in den ersten Monaten unseres Lebens gelingt es uns, verlässliche soziale Beziehungen aufzubauen. Wir können Körpersprache deuten, gewisse Handlungsabfolgen vorhersehen, wahrscheinliche Reaktionen abschätzen und sie provozieren. Wir sind fähig zu Mitgefühl und Humor und verspüren bereits in unserem zweiten Lebensjahr einen nicht von außen beigebrachten Drang, anderen Menschen zu helfen, wenn sie Unterstützung brauchen. Unser Bedürfnis nach sozialen Beziehungen und Zusammenhalt prägt unser Leben von Anfang an.
Was also macht es mit uns, wenn dieses Bedürfnis nicht ausreichend erfüllt wird? Von den gesundheitlichen Folgen haben wir schon gesprochen. Aber es gibt auch gesellschaftliche.
Warum wir Verbündete brauchen
Hannah Arendt beschrieb in ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft Einsamkeit, Isolation und das Fehlen tragfähiger Beziehungen als entscheidende Wegbereiter des Nationalsozialismus in Deutschland. Auch aktuelle Studien zeigen, dass Einsamkeit dazu führt, dass Menschen sich weniger stark gesellschaftlich engagieren und weniger am politischen Prozess teilnehmen.
»Einsamkeitsbelastungen [schädigen] das stabile Funktionieren einer der wichtigsten Säulen der liberalen Demokratie in Deutschland«, heißt es in diesem Zusammenhang in einer Studie aus dem Jahr 2023. Die Prävention und Linderung von Einsamkeit sollten daher auch als Demokratieförderung verstanden werden, weil sie das demokratische System stabilisieren, so die Forschenden.
»Viele der Themen, die wir heute auf den Titelblättern unserer Zeitungen sehen, verschlimmern sich durch fehlenden Zusammenhalt«, schreibt Vivek H. Murthy. In manchen Fällen sei unsere Nicht-Verbundenheit sogar Ursache des Problems. Klimakrise, Rassismus, Armut, Krieg: »Viele dieser Herausforderungen sind die Folge von individueller und kollektiver Einsamkeit, die zu lange in zu vielen Menschen gebrodelt hat.«
Wundert es da immer noch, dass wir bei unserem SechsGänge-Gespräch über Zukunft bei dem Wunsch nach mehr Zusammenhalt gelandet sind? Ein bisschen vielleicht, weil wir zu diesem Zeitpunkt weder Fakten noch Studien kannten. Aber das Signal, das Einsamkeit sein kann – das haben wir alle an diesem Abend wohl gespürt.
Und das war erst der Anfang.
Die gute Nachricht ist: Wir können daran arbeiten, uns weniger einsam zu fühlen. Die Zukunft, wie wir sie uns wünschen, kann dabei unser Kompass werden. Ob wir sie jemals erreichen werden, eines fernen Tages? Wer weiß? Ich glaube, die Antwort ist gar nicht so wichtig. Wenn wir unsere Visionen vor Augen haben, liegt die Zukunft immer auch ein bisschen in der Gegenwart.
In meinem letzten Buch Wie wir die Welt sehen bin ich der Frage gefolgt, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen, was uns dabei helfen kann, einen anderen Umgang mit unseren Problemen zu trainieren, und wie wir schließlich einen neuen Blick auf unsere Welt gewinnen können. Die Formel Scheiße plus X war dabei ganz entscheidend. Sie meint: Egal, mit welchem Problem wir in unserem Leben konfrontiert sind, wir können immer nach dem suchen, was ich »X« nenne – einem ersten Schritt, der das Problem ein bisschen besser macht, manchmal auch nur: ein bisschen weniger schlimm. Es geht nicht darum, eine endgültige Lösung für das jeweilige Problem zu finden, in vielen Fällen ist das auf Anhieb gar nicht möglich.
Entscheidend ist vielmehr, dass wir losgehen, dass wir uns auf den Weg machen und uns daran erinnern, dass wir nicht hilflos und ohnmächtig sind, sondern konkrete Dinge tun können, um unsere jeweilige Situation – oder ein bestimmtes Problem – zu verbessern.
In diesem Buch will ich meine Formel auf das anwenden, was ich momentan für eines der größten Grundprobleme unserer Gesellschaft halte: den Mangel an Verbundenheit. Ich will Antworten suchen auf die Frage, was uns dabei hilft, verlässliche Verbündete zu finden: Menschen, mit denen wir uns tatsächlich verbunden fühlen. Was uns hilft, nicht gegen das Gefühl von Einsamkeit anzukämpfen – sei es gesellschaftlich oder individuell –, sondern ihm tatsächlich etwas entgegenzusetzen.
Mir ist klar, dass ein einzelnes Buch ein so gravierendes Problem wie Einsamkeit und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen nicht lösen kann; genauso wenig wie mein letztes Buch die ganze Medienlandschaft in Deutschland aufwirbeln und umkrempeln konnte. Aber vielleicht kann es Anstöße geben und hier und da Veränderungen in Gang bringen.
Bei meinem letzten Buch wurden diese Veränderungen nicht nur in medialen Debatten deutlich, die nach der Veröffentlichung folgten. Die Veränderungen, die mich am meisten bewegt haben, waren kleiner: Einzelne Journalist*innen, die mir schrieben, dass sie jetzt anders berichteten und immer auf der Suche nach dem X seien, eine Leserin, die mir schrieb, dass ihr das Buch dabei geholfen habe, während der Krebsbehandlung ihrer kleinen Tochter nicht den Mut zu verlieren. Und eine andere Leserin, die mir erzählte, sie suche seit der Lektüre meines Buches nun jeden Tag nach Highlights – kleinen Xen in ihrem eigenen Leben.