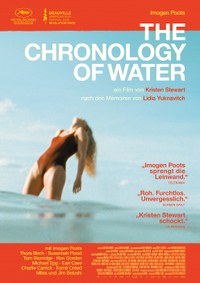Ein wehmütiger Rückblick auf vierzig erlebnisreiche Jahre
Am 8. Februar stellt Günter Grau im Auditorium des Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors" in der Niederkirchnerstr. 8 das "Lexikon zur Homosexuellenverfolgung 1933-1945" vor. Damit ist auch diese Zeit wissenschaftlich aufgearbeitet und steht späteren Generationen als Wissen zur Verfügung.
Als ich in den siebziger Jahren entlang der Mauer nach Kreuzberg radelte, waren die Grundmauern der ehemaligen Gestapozentrale noch zu sehen. Ich ahnte nicht, dass alle Kellerräume, in denen verhört und gefoltert wurde, noch vorhanden waren. Ein paar Jahre später wurde das Gelände plattgemacht und als Auslaufplatz für Hunde genutzt.
Als die Träume Fleisch ansetzten!
Kurz nach Ostern 1968 kam ich zum Studium nach Westberlin. Am Karfreitag zuvor hatte ich noch vor den Kirchen in Dinkelsbühl Flugblätter gegen den Krieg in Vietnam verteilt. Das Attentat auf Rudi Dutschke hatte mich weiter radikalisiert. Jetzt endlich war ich mittendrin im Zentrum des Aufbegehrens. Gesoffen wurde nach den aufregenden sit ins und Demos "Bei Herta" in der Schlüterstraße. Einmal begleitete ich einen jungen Mann, der am Flipperautomaten gespielt hatte. Unterwegs am KU-Damm deutete er lachend auf den Werbespruch eines Taxi-Unternehmens: "Haste keenen, lei dir eenen!" Am Savignyplatz verschwand er in einem Lokal, währen ich mich mit der S-Bahn auf den Heimweg nach Eichkamp machte.
Dass es Stricher gibt, wusste ich damals genauso wenig wie das die Toilette am Savigny-Platz ein von Schwulen rege besuchter Ort war. Doch hatte ich immerhin begriffen, homosexuell zu sein.
Kneipenglück und Strafanzeige
Bei Kiepert in der Knesebeckstraße hatte ich einen Führer entdeckt, der über das Westberliner Nachtleben aufklärte. Zu meinem Erstaunen wurden 96 Bars und Lokale für "Männer, die Männer lieben" aufgelistet. Neugierig machte ich mich nachts mit meinem Citroen auf Forschungsreise. Nach ein paar Wochen wusste ich, dass das "Trocadero" und das benachbarte "Kleist-Casino" zu den bevorzugten Bars gehörten.
Es war der 6. Dezember 1968, als ich den Schritt über die Schwelle des Trocaderos wagte. Ich kann mich so genau erinnern, weil man an Eingang einen kleinen Schokoladennikolaus geschenkt bekam. Schon bald genoss auch ich die "Blues-Phasen" im "Kleist-Casino". Sehnsüchtig warteten wir auf den Moment, wo der Raum abgedunkelt wurde. Aufgeregt stürzte sich dann jeder auf den, den er zuvor ausgespäht hatte. Wer zu den Glücklichen gehörte, konnte engumschlungen heiße zehn Minuten genießen. Auch Andreas Bader war hier Stammgast. Mit seinem eindrucksvollen Kolben, der sich in seiner selbstgenähten, hautengen Hose abzeichnete, genoss er die Blicke der Männer.
In einer schwülen Juninacht 1969 nahm mich aus dem "Trocadero" ein Berliner Prolo mit nach Hause. Er wohnte in dem Neubaukomplex am Anhalter Bahnhof, in dem sich auch die schwule Apollo-Sauna befand. Kaum waren wir im Bett gelandet, wurde wütend an die verschlossene Schlafzimmertür getrommelt. Sein Freund verlangte Einlass und weigerte sich, auf der Couch im Wohnzimmer zu schlafen. Nach heftigem Streit wurde es verdächtig still im Flur. Eine Viertelstunde später klopfte es wieder: "Polizei". Im Flur stand Kai mit zwei Beamten, die unsere Personalien aufnehmen wollten. "Ich zeige die beiden Herren an wegen homosexuellen Verkehrs". Kai war damals einer der legendären Discjockeys beim RIAS und sein Vater war außenpolitischer Berater von Franz-Josef Strauß.
Die nächsten Monate hatte ich Angst. Sicher wurde auf der Polizeistation in Dinkelsbühl nachgefragt. Schnell würde sich in der Stadt herumsprechen, dass der ehemalige Oberministrant, der einmal katholischer Priester werden wollte, im sündigen Westberlin bei "widernatürlicher Unzucht" erwischt worden war.
Zu meinem glück hatte der Bonner Bundestag die Liberalisierung des berüchtigten Paragraphen 175 bereits verabschiedet. Wahrscheinlich wurde deshalb die Anzeige nicht mehr bearbeitet.
"Hurra! Wir machen die Schwulenbewegung!"
Rosa von Praunheims Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt." kommt der Verdienst zu, den Impuls zur 2. deutschen Schwulenbewegung gegeben zu haben. Auch ich gehörte zu den Vielen im Arsenal, die nach der Vorführung des Filmes mit den Filmemachern diskutierten. Die meisten fanden den Film schrecklich.
Ein (gutaussehender) junger Mann kommt aus der Provinz nach Westberlin und entdeckt dort seine "gleichgeschlechtliche Veranlagung". Nach dem Versuch einer (spießigen) Ehe gerät er in den Sog der anonymen Sexorte in der Stadt. Am 15. Januar 1973 wurde der Film (außer in Bayern) im 1. Programm der ARD ausgestrahlt. Schon der Hinweis, Dass Homosexuelle auf öffentlichen Toiletten Sex suchen, wird viele Zuschauer abgestoßen haben. Auch im Fernsehen meldeten sich in der anschließenden open-end-Diskussion überwiegend empörte Telefonanrufer zu Wort.
Heute, vierzig Jahre später, wirken die halbdokumentarischen Szenen aus der Westberliner Sub nicht mehr provozierend, sondern eher belustigend. Ledertrinen, die im Volkspark durch die Büsche streifen und sich ab und zu scheu befummeln! Gierige, Ältere Homophile, die sich während eines Liederabend auf den jungen Sänger stürzen und ihm (fast) die Kleider vom Leibe reißen! Ablehnung provozierte damals auch Die "effeminierte" Stimme des Sprechers, der den Kommentar mit immer leidenschaftlicherem Pathos vortrug.
Schon die ersten Sätze verraten, dass hier eine (elitäre) Avantgarde den gewöhnlichen Homosexuellen ihre Überangepasstheit und ihren Selbsthass vorwirft. "Schwule wollen nicht schwul sein. Sie wollen nicht anders sein, sondern so spießig und kitschig leben wie der Durchschnittsbürger... Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß bürgerlicher Tugenden. Ihre politische Passivität und ihr konservatives Verhalten sind der Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben."
Auf der Suche nach den Wurzeln der Homosexuellendiskriminierung
Vielleicht hat der Verfasser des Kommentars an die Männer mit dem Rosa Winkeln in den Konzentrationslagern gedacht, als er von der Angst sprach, totgeschlagen zu werden. Aber die Homosexuellenverfolgung im 3. Reich wird in Film mit keinem Wort erwähnt. Sie spielte auch in unseren Diskussionen keine Rolle.
Einige trafen sich jetzt regelmäßig. Ich gründete die Donnerstaggruppe, in der wir über unsere Probleme mit der Sub sprachen. Eher ein Asket und noch wenig rauscherfahren, faszinierten mich Barrikadenstürmer wie der schwarzgelockte Georg von Rauch und seine Haschrebellen. Wir Spontis träumten von einer "Schwulen Befreiungsfront". Aber die Genossen, die die Emanzipation des Homosexuellen an der Seite der Arbeiterklasse erkämpfen wollten, lehnten das Wort "schwul" als zu anrüchig ab. Sie setzten sich mit ihrem Vorschlag einer "Homosexuelle(n) Aktion Westberlin" (HAW) durch.
Auf unserem 2. Pfingstreffen 1972 wagten wir die erste Westberliner Homo-Demo. Geworben wurde mit einer Plakette, die eine geballte Faust in einem leuchtend roten Herzen zeigte. Wir werden 500 bis 600 Menschen gewesen sein, die sich vom Savigny-Platz auf den Weg machten. Über die Kantstraße und die Wilmersdorfer erreichten wir den legendären Ku-Damm. Hier platzte den aus Frankreich angereisten Trinen endgültig der Kragen. Unser mit großem Ernst voranschreitendes Marschvolk kanzelten sie als schrecklich deutsch ab. Hysterisch begannen sie, uns von draußen zu beschimpfen. Wütend stürzten sich einige Genossen auf die keifenden Tucken. Eine(r) von ihnen, der später als Mechtild von Sperrmüll in die Geschichte dieser bewegten Jahre eingehen wird, drohte ihnen mit Schlägen.
Damit war allerdings ein Punkt erreicht, der uns Libertäre zum Widerstand zwang. Wir solidarisierten uns mit unseren französischen Schwestern. Die Demo wurde abgebrochen. Die anschließende, erhitzte Diskussion in unserer Fabriketage in der Dennewitzstraße dauerte bis nach Mitternacht. Auch ich erschien am nächsten Morgen im Fummel. Als "Frieda, Freifrau von Rechenberg" beteiligte ich mich mit einer Kampfschrift an dem (beginnenden) "Tuntenstreit".
Gestritten wurde um die Frage, wem man die Homosexuellendiskriminierung anlasten könne. War es wirklich der Kapitalismus, der uns warme Brüder zu verhassten Außenseitern machte? Oder war es das (selbst in der Schwulenbewegung) fortdauernde Patriachat, das sich durch den femininen Mann provoziert fühlte und ihn ablehnte?
Trotz der Strafrechtsreform bekamen die Tunten die Aggressionen ihrer Umwelt weiter zu spüren. Jetzt endlich hatten sie in der HAW ihren großen Auftritt, nachdem bisher kopflastige Intellektuelle den Ton angegeben hatten. Die Tunte wurde als die wahre Heldin schwuler Emanzipation gefeiert. So manche der jetzt Angehimmelten verschwieg in diesem Patriarchatsdiskurs, dass sie sich nicht ungern von einem schwanzgesteuerten Türken oder Araber durchficken ließ.
Der entliehene Rosa Winkel
Wie aber konnte man erreichen, dass endlich auch der unauffällige Homosexuelle Prügel bezog? Ich weiß nicht mehr, wer den Rosa Winkel in die Diskussion einbrachte. Vielleicht waren es Schwestern von der Rotzschwul, die bereits im April in der Frankfurter Innenstadt mit großen Rosa Winkeln mit der Aufschrift "schwul" demonstriert hatten. Ich hatte bei dem Vorschlag, den Rosa Winkel als Abzeichen einzuführen, kein gutes Gefühl. Wir konnten doch nicht ernsthaft unsere Diskriminierung in Beziehung setzen zu dem Terror, mit dem die Männer in den Konzentrationslagern konfrontiert gewesen waren. Andere fanden es gut, endlich mit einem geschichtsträchtigen Symbol auf den Opfer-Status von Homosexuellen aufmerksam machen zu können. Der Erfolg schien ihnen Recht zu geben. Der Westberliner Senat richtete ein Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ein. Es sollte Schwule und Lesben bei ihrer Emanzipation unterstützen. Die Aussicht, irgendwann einmal als bezahlter Pädagoge Schwulenarbeit machen zu können, fand auch ich reizvoll.
Sommer 1973 flog ich mit einem Freund in die Vereinigten Staaten. Es wurden aufregende, mich verändernde Monate. Zwar bin ich in der Nachkriegszeit großgeworden, habe aber nie hungern müssen. Jetzt sah ich zum ersten Mal Menschen, die Mülltonnen nach Essbaren absuchten. Ärmlich ging es auch in so mancher gay community zu, die mich gastfreundlich aufnahm. Mich beeindruckte ihr buntes Spektrum an Gruppen und Zeitschriften. Alle klagten über Geldmangel. Aber den Gedanken, Geld vom Staat zu fordern, fanden alle abwegig.
Ausufernde Sexwelten und der AIDS-Schock
Frühjahr 1974 besuchte ich wieder einmal das Institut für Wirtschaftspädagogik der Freien Universität. hier hatte ich noch vor drei Jahren Berufsschullehrer ausgebildet. Als ich den Toilettentrakt im Keller des WiSo-Gebäudes aufsuchte, war ich sprachlos. Aus dem linken Flügel hatten Vandalen ein Puff gemacht. Sämtliche Kabinenwände waren durchlöchert. Auf dem Klo sitzend konnte man durch weitere Löcher die wartenden mustern. Vor den Kabinen standen die Studenten Schlange. Die völlig intakten Kabinen auf der anderen Seite wurden kaum benutzt.
Während ich in meiner Hose ein angenehmes Prickeln spürte, lief ich schamrot an. Wie hätte ich mich verhalten, wenn es diese Lasterhöhle schon zu meiner Zeit als Dozent gegeben hätte? Hätte ich den Mut gehabt, diesen Ort aufzusuchen? Vielleicht wäre ich an dem Schwanz eines Studenten geraten, der kurz zuvor eine meiner Veranstaltungen besucht hatte.
Ich war erleichtert, dank meines Promotionsstipendiums die akademische Welt nur noch selten aufsuchen zu müssen. Auch ich nutzte inzwischen die anonymen Sexmöglichkeiten im Grunewald oder im Tiergarten. Auch ich fand es reizvoll, an unendlich vielen Klappen der Stadt mit Schwulen rechnen zu können. Einige Jahre nahmen die zuständigen Behörden das wilde Treiben in den Parks und auf den Toiletten hin. Dann leiteten sie Gegenmaßnahmen ein. Der Versuch, durch immer neue Baumaßnahmen den Sex in den Toiletten zu verhindern, wird den Senat Millionen gekostet haben. Dieser über zwei Jahrzehnte sich hinziehende "Krieg" endete nicht mit einem Waffenstillstand, sondern mit der Schließung der meisten Öffentlichen Toiletten.
Für einen Waffenstillstand hätten sich die Schwulenfunktionäre einsetzen müssen, die es in wachsender Zahl gab. An fast jeder Fachhochschule oder Uni etablierte sich ein Schwulenreferat. Es gab eine vom Senat finanzierte Schwulenberatung. Zwei sich streitende Homosexuellenverbände warben um Mitglieder und politischen Einfluss. Aber keiner der hier Engagierten wagte offen für das Recht auf anonymen Sex im öffentlichen Raum einzutreten. An der Kluft zwischen der Szene und ihrer Avantgarde hatte sich nichts geändert.
Das Bedürfnis nach schnellem Sex veränderte auch die Kneipenlandschaft. Die "Knolle" in der Bundesallee war die erste Lederbar, wo es im Keller direkt zur Sache ging. "men at work" war an der Treppe zu lesen, die nach unten führte. Auch wenn es sicher zutraf, dass in so mancher Ledermontur eine Trine steckte: in unseren Patriachatsdiskussionen hätten wir solche exzessiven Männlichkeitskulte abgelehnt. Jetzt konnte jede Sexvariante ausgelebt werden und auch die SM-Szene warb um Anhänger.
Freilich lässt sich diese Entwicklung nur auf den ersten Blick mit "typisch schwul" erklären. Nicht wenige Heteromänner beneideten uns um unsere Sex-Paradiese. Sie hätten ihre Lust auch gerne freizügiger ausgelebt. Aber ihnen fehlten die Frauen, die mitzuspielen bereit waren.
Mit AIDS drohte das Bild vom hässlichen Homosexuellen zurückzukehren. Peter Gauweiler (CSU), der durch (s)einen Freund die Münchner Klappenszene gut kannte, forderte eine Isolierung der bereits Infizierten. Sonst würde sich aufgrund des promiskuitiven Treibens der Schwulen die neue Seuche schnell ausbreiten. Durchgesetzt haben sich die, die im Erkrankten trotz seiner lasterhaften Vergangenheit ein Opfer sahen. Statt mit Verfolgung und Diskriminierung antworteten sie mit den AIDS-Hilfen, die neue Arbeitsplätze für Schwule brachten.
Der ersehnte Mythos: Militanz und Rausch
Im Juni 1979 fand in Westberlin die erste "gay parade" statt, die in den folgenden Jahren als "Christopher-Street-Day-Demonstration" (CSD) angekündigt wurde. Vorbild waren die amerikanischen Schwulenparaden, mit denen jedes Jahr in allen größeren Städten an die Auseinandersetzungen in der Christopher Street in New York erinnert wird. Dort hatte in der Nacht zum 26. Juni 1969 in der Bar "Stonewall" eine der üblichen Polizeirazzien stattgefunden. Diesmal aber leisteten die Gäste -der Legende nach Tunten und Transvestiten-erbitterten Widerstand. Das Ereignis sprach sich schnell in den benachbarten Bars herum. Als die Polizei in der nächsten Nacht wieder anrückte, war sie mit einer anwachsenden Zahl kampfbereiter Schwuler konfrontiert. In den folgenden Nächten kam es zu regelrechten Straßenschlachten zwischen der gay community und der Polizei.
Die 2. deutsche Schwulenbewegung war durch die Liberalisierung des Sexualstrafrechts in den siebziger Jahren möglich geworden. Sie hatte diese Reform nicht erkämpft, aber von ihr profitiert. Weil man ohne Kampf zu Einfluss gekommen war, übernahm man den amerikanischen Mythos. Und diesmal fühlte sich auch die Szene angesprochen. Es kamen Tausende, in den folgenden Jahren Zehntausende. Alle Varianten schwuler Lust waren zu sehen und mit den Jahren immer mehr nackte Haut.
Viele der Älteren, die noch das 3. Reich und die bedrückende Nachkriegszeit erlebt hatten, lehnten diesen "Karnevalsspuk" ab. Verbittert beklagten sie, dass sich kaum einer der Nachgeborenen ernsthaft für ihre Leidensgeschichte interessierte. Sie verstanden sich mit größerem Recht als wir als Opfer. Deshalb soll in einem 2. Teil auf ihre Erfahrungen eingegangen werden.
Daniel Schneider
blindhero@gmx.net