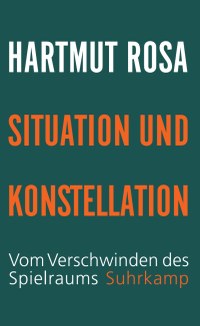Künstlerisch besteht der Sinn von Festivals wie der Berlinale darin, dass Filme miteinander ins Gespräch kommen. Klingt banal oder blöde, weil Filme ja nicht reden können. Aber sie unterhalten Verbindungen zueinander, die fürs Weltverständnis hilfreich sind.
"Aujourd'hui (Tey)", der Wettbewerbsbeitrag des franco-senegalesischen Regisseurs Alain Gomis, ist nach dem merkwürdig diffusen Eröffnungsfilm, dem Kostümfilm "Lebe wohl, meine Königin" von Benoit Jacquot, ein erster Höhepunkt im Programm. Und es ist ein Film, der die Kritik spalten wird. Weil Gomis, gerade für westlich-rationale Auffassungen, eine Geschichte erzählt ist, in der wenig passiert.
Satché, gespielt vom amerikanischen Slam-Poeten und Rapper Saul Williams, ist in den Senegal zurückkehrt. Er muss sterben, man weiß warum, gibt ein Insert zu Beginn des Films zu verstehen, erklärt wird es nicht. Es geht nicht um dieses Warum, und es geht auch nicht darum, dass Satché sich dagegen auflehnen müsste. Er ist Teil eines größeren Zusammenhangs, der vielleicht nicht einmal einer alten Opferritus, es ist einfach so. Und so läuft oder besser wandelt Satché durch diesen sehr ungewöhnlichen, sehr sensitiven Film wie eine Metapher, wie das Medium einer gesellschaftlichen Tiefenbohrung.
Er sucht familiäre Zusammenhänge auf, seinen Onkel, den Leichenwäscher, die alten Freunde, aber eben auch die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten: die alte Geliebte in der schicken Galerie, die Repräsentanten der Stadt an einem verwaisten Empfang, von dem noch die Plastikbecher des Buffets geblieben sind, eine zornige Demonstration auf den Straßen, auf der die Leute gegen ihre Ausbeutung rebellieren.
"Aujurd'hui" erzählt mehr über die senegalesische Gesellschaft als über seinen stoischen Protagonisten, der in einer anderen grandiosen Szenen seinen Todesmarsch durch eine Gasse paradiert, bei der ihm dauernd etwas geschenkt wird wie bei einem umgekehrten Karnevalsumzug. Und dass ist der Moment, wo der Film zu reden beginnt mit Werner Herzogs als Special gezeigten Fernsehsendungen "Death Row". Wer mit Unverständnis auf das Schicksal von Satché blickt, muss bei Herzogs Todesstrafenerkundung in den USA merken, dass diese Art der Verdammung nicht weniger rational ist.
Herzog erweist sich als großer Geschichtenentdecker. Mit seinem sehr speziellen Englisch, seiner engagiert-pathetischen Sprecherhaltung, die genau weiß, was sie von dem Stoff, den Delinquenten, dem Apparat will, gelingt dem Regisseur eine Reise in die amerikanische Finsternis. "Als in den USA lebender Gast muss ich respektvoll sagen, dass ich die Todesstrafe ablehne", hackt Herzog unmissverständlich zu Beginn jedes der 45-minütigen Feature in die Tonspur. Um dann die Geschichten der Verurteilten und die Zusammenhänge ihrer Verurteilung aufzuschließen.
Im Falle von James Barnes, eines mehrfachen Mörders, der durch das stückchenweise zugeben immer weiterer Taten die Gerichte zu beschäftigen und seine Exikution rauszuzögern versucht (oder der nur reinen Tisch machen will vor seinem Tod - so genau weiß man es nicht), entzaubert die Todesstrafe als überkommenes Machtmittel. Wenn der Staatsanwalt ihm erklärt, sie diene der Abschreckung, unterbricht Herzog umgehend: Dass das nicht funktioniere, ist tausendfach belegt. Irgendwann kann der Staatsanwalt nur noch bekunden, dass er dem Willen der Bevölkerung folge - ein Eingeständnis des Endes von aller vernunftgesteuerten Politik.
James Barnes überbringt Herzog dagegen Grüße von dem Vater, vor dessen Gewalt Barnes selbst in Gewalt geflohen ist (Herzog verfolgt auch die Verheerungen dieses Regimes in der Familie weiter). Und in diesem Moment steigen Barnes die Tränen in die Augen - ein Detail, das in anderer Weise auch in "Aujourd'hui" vorkommt.