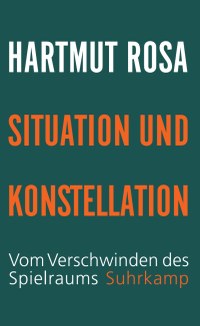Die Leipziger Buchmesse ist eine Publikums- und eine Lesemesse. Das zeigt sich nicht nur an den fast zweitausend Lesungen, die im Rahmen von Leipzig liest in der ganzen Stadt stattfinden, sondern auch daran, dass der Versuch, „Freude am Lesen und an der Literatur“ zu vermitteln, als Schwerpunkt ausgewiesen wird. Aber wie bringt man gerade junge Menschen zum freiwilligen Lesen von Büchern? Schon zum vierten Mal findet auf der Messe eine „Bücher-Rallye“ für Schulklassen statt – mit „Boxenstopps“ an einzelnen Messeständen.
Bücher-Rallye, Boxenstopps: Es sind solche Sperenzchen, die einen Alt-Leser in den Wahnsinn treiben. Können die jungen Menschen nicht einfach ein Buch lesen? Nein, können sie eben nicht. Aber ehrlich gesagt, sie konnten es noch nie. Erinnert man sich an die eigene Schulzeit, dann waren die Leseratten unter den Mitschülern oder man selbst durch ein Handicap (eine empfindliche Seele, eine Allergie, die ans Bett band) zum vielen Bücherlesen doch quasi genötigt. Nennen wir es die Kompensationstheorie des Lesens. Später konnte dieser Mangel dann natürlich in einen Gewinn umgemünzt werden, aber das Bücherlesen ist auch für uns Alt-Leser keine sichere Sache. „Wir sind nicht zum Lesen geboren“, an diesem anthropologischem Befund der Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf ändert auch die Einführung neuer, benutzerfreundlicher Medien wie des E-Books nichts. Der Nicht-Leser steckt nun einmal im Menschen drin, und unsere Zeit lässt ihn immer frecher hervorlugen.
Schlechte Nachrichten aus dem Zentralorgan
Vor nun schon fünf Jahren bestätigte eine britische Umfrage, was man ahnte: Auch wer Bücher kauft, liest diese nicht unbedingt. Über die Hälfte der Befragten gab an, Bücher „nur zur Dekoration“ zu kaufen. Stimmt unsere Beobachtung, dass Bücherregale rapide an Sozialprestige verlieren, dürfte sich auch dieser Wert deutlich verändern. Damit nicht genug. Lapidar stellte Julia Karnick neulich in ihrer Kolumne in der Brigitte fest: „Früher las ich Bücher und hatte Sex.“ Man unterschätze Brigitte nicht. Wenn in einer Buchkritik das Wort „wunderbar“ vorkommt, kann das für Verlag und Autor immer noch zum Freudenfest werden. Von einer Besprechung im Qualitätsfeuilleton lässt sich Gleiches nicht behaupten. Wenn also in so einem Zentralorgan der Leselust das Ende des Bücherlesens verkündet wird, ist das ein Zeichen.
Zumal der größte aktuelle Verführer des Nicht-Lesers in uns von Karnick genannt wird – es sind TV-Serien wie Mad Men oder The Wire. Auch hier eine Zahl: Eine kleine, wenn auch nicht repräsentative, Umfrage unter zehn Hildesheimer Studenten der Kulturwissenschaften hat ergeben, dass fünf The Wire komplett gesehen haben, aber nur einer den diesjährigen Favoriten für den Leipziger Buchpreis, Tschick von Wolfgang Herrndorf, nein, noch nicht einmal gelesen, sondern ins – offenbar noch vorhandene – Regal gestellt hat.
Verheerend hatte in diesem Zusammenhang ein kluger Beitrag in der FAZ gewirkt, der in The Wire den „Balzac für unsere Zeit“ erkannte: „Der Roman der Gegenwart ist eine DVD Box“. Obwohl man kein Buch las, stand man sozusagen an der Spitze der Literaturbewegung, so beruhigten wir unser schlechtes Gewissen über ungezählte Stunden Serie- Schauen statt Bücherlesen. Zur Buchmesse erscheint übrigens Clockers von Richard Price in einer neuen Übersetzung, der Roman gilt als Blaupause dieser fabelhaften Serie aus Baltimore. Wenn dass kein Grund ist, den Nicht-Leser in uns einmal mehr zu überlisten.