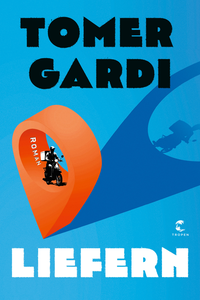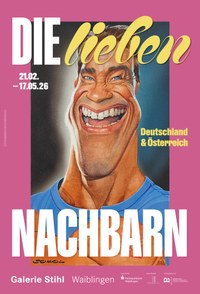Sie hat viel Energie gekostet, die Klimakonferenz in Durban. Nur unter dem Aufwand größten Willens konnte ein Scheitern des ökologischen Krisengipfels verhindert werden. Am Ende haben sich die teilnehmenden Staaten aber doch noch einen präsentablen Kompromiss aus den Verhandlungsrippen geleiert. Man vernimmt nun: „Kyoto ist gerettet!“. Man hört jetzt, es sei eine „historische Konferenz“ gewesen, wenn nicht gar ein „Meilenstein“. Soweit zumindest ausgewählte Repräsentanten des politischen Lagers. Aber nicht jeder mag darüber jubeln, dass dem Kyotoprotokoll nun erst 2018, also sechs Jahre später ein auch für Schwellenländer gültiger Pakt folgen soll. Frustrieren dürfte das Ergebnis nicht zuletzt Klimaforscher, deren Arbeit die Notwendigkeit solcher Klimakonferenzen doch eigentlich erst impliziert hatte, und die Hand in Hand mit der Politik einen globalen Kollaps verhindern sollten. Was ist da nur schief gelaufen?
Noch am Wochenende haben sich zwei beteiligte Wissenschaftler um eine Analyse bemüht: Die Klimaforschung sei in ihrer Rolle als Politikberater zu sehr auf die Senkung von Kohlendioxid-Emissionen kapriziert gewesen und habe sich in Bevormundungen ergangen, anstatt sich sinnvollen Optionen des Klimaschutzes zu widmen und Zurückhaltung zu üben, schreiben Nico Stehr von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und Hans von Storch vom GKSS-Forschungszentrum in Geesthacht auf Spiegel Online. Die Politik sei dadurch verprellt und die öffentliche Debatte erschwert worden. Stehr und von Storch halten die Tatsache, dass das Grundgesetz keine direkte Teilnahme der Wissenschaft an der politischen Willensbildung vorsehe, für ein Gebot der Zurückhaltung. Mit anderen Worten: Forscher, die zu Erkenntnissen von globaler Tragweite gelangen, mögen bitte ihre Klappe halten, bis sie gefragt werden.
Man kann diesen Versuch einer Selbstkritik gut finden: Endlich stellen Forscher mal ihre Arroganz infrage, und das in der Klimawissenschaft, wo Selbstüberschätzung und Überheblichkeit bisweilen nette Partys feiern – nicht ohne die Inanspruchnahme der Publikumsmedien, versteht sich. Die Wissenschafts-Pressekonferenz berichtete kürzlich, dass der stets sich durch die Medien gebasht fühlende Stefan Rahmstorf von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung im vergangenen Jahr heftig eine Journalistin kritisiert hatte, weil sie wagte, ihrerseits Kritik am aktuellen Bericht des Intergovernmental Panel of Climate Change zu üben. Dass die Betreffende damit unter Umständen ihrer beruflichen Pflicht nachgekommen war, kam dem Professor nicht in den Sinn. Der Zeitung, die den Artikel veröffentlicht hatte, auch nicht. Am Ende gewann die Autorin vor Gericht, der Forscher wurde verurteilt.
Der Fall zeigt zwei Dinge: Stehr und von Storch haben recht, wenn sie ihre Kollegen für eine falsche Strategie schelten, aber erstens fängt die Analyse hier nur an, denn „Bevormundung“ ist nicht das einzige Problem auf Seiten der Forschung. Es ist wie bisweilen schon fatale, weil dem Konzept von Wissenschaft vollkommen widerstrebende Kritikunfähigkeit. Und zweitens übersehen Forscher auch, dass eine wissenschaftlich fundierte Lösung nicht durchzusetzen sein wird, solange die Welt weiter nach Profitmaximierung strebt. Die Wissenschaft könnte ja gar keinen direkten Einfluss auf die Politik nehmen, vor ihr ist immer die Ökonomie dran. Und die stets akuten Zwänge des kapitalistischen Strebens nach Geld, Konsum, noch mehr Geld und noch mehr Konsum erlauben keine Zugeständnisse an die Zukunft dieses Planeten. Jedenfalls nicht, solange dieser noch eine hat. Und sei sie noch so schmutzig.