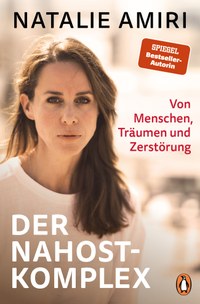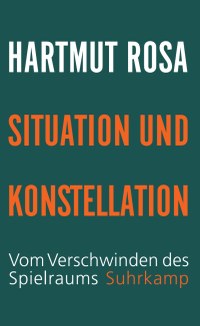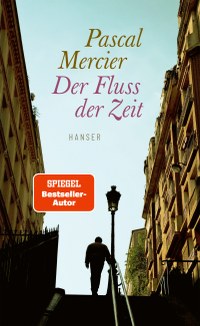Einleitung
Wie oft habe ich in den vergangenen Wochen überlegt, wie dieses Buch beginnen könnte. Jeder Ansatz schien mir plausibel – und im nächsten Moment schon wieder unzureichend. Kaum hatte ich einen Satz notiert, war er von der Realität überholt. Das Geschehen im Nahen Osten vollzieht sich gegenwärtig in einem Tempo, dem ich kaum nachkam. Und zwischenzeitlich fragte ich mich, wie man sich so etwas antun kann, ein Buch zu schreiben mit einem solchen Titel. Es ist wie im Karussell, das sich unablässig dreht, immer schneller, bis man kaum noch unterscheiden kann, was Ursache und was Wirkung ist. Wo will ich in dieser Bewegung, in diesem Strudel, einen Anfang setzen? Diese Einleitung dient am meisten wohl mir, die ich mich nach Monaten, in denen ich im Nahen und Mittleren Osten unterwegs war, sortieren muss. Ich bin mehr als 40 000 Kilometer gereist, habe mit mehr als 200 Personen Interviews geführt, in Syrien, dem Libanon, in Rojava, in Israel, Gaza, dem besetzen Westjordanland, dem Iran, dem Irak und in Deutschland. Mein Telefon vibriert im Minutentakt – Nachrichten aus Journalisten-WhatsApp-Gruppen, aus Beirut, Teheran, Damaskus, Gaza und Jerusalem. Selbst wenn ich den gesamten Tag nichts anderes machen würde, als den Verlauf dieser Chats zu lesen, würden mir 24 Stunden nicht reichen. Wenn ich auf meinem Handy durch die Fotos und Videos der letzten Monate scrolle, wird mir ganz schwindlig.
Vielleicht ist es gut, mit einem Geständnis zu beginnen: In diesem Buch habe ich um jeden Halbsatz gekämpft. Denn Worte sind in dieser Region mehr als nur Worte. Jeder Satz, jeder Ton wird sofort Teil des Konflikts. Wer sich zu Israel oder Palästina äußert, ist nicht Beobachter, sondern wird Teil des Diskurses – und der Diskurs ist längst Teil des Krieges. Ich schreibe und weiß zugleich: Für viele Leserinnen und Leser wird schon die erste Seite darüber entscheiden, ob sie dieses Buch als Versuch verstehen, Komplexität abzubilden, oder als Angriff auf die eigene Position. Ich würde ihnen gern zurufen: »Haltet noch ein paar Seiten durch, bald seid Ihr wieder dran!«
Ich will es dennoch versuchen. Der 7. Oktober 2023 war ein Schock, der Israel erschütterte, wie es das Land seit seiner Gründung nicht erlebt hatte. Ein Land umzingelt von Feinden. Wer mit seiner Erzählung über den Nahen Osten hier beginnt, blendet das Vorherige aus: die jahrzehntelange Besatzung, die Nakba von 1948, die Blockade von Gaza seit 2007. Der 7. Oktober war nicht der Anfang, sondern die Explosion eines Konflikts, dessen Brandherd nie gelöscht wurde. Ich notiere mir die nächsten Zeilen in Sderot, einer israelischen Grenzstadt, einen Kilometer von Gaza entfernt. Während ich hier sitze, höre ich hinter mir das dumpfe Grollen der Artillerie, die Gaza beschießt. Im Minutentakt. Vor wenigen Stunden war ich noch im Kibbuz Be’eri, wo jeder eine Geschichte von Tod, Zerstörung und Entsetzen in sich trägt. Am Vortag wiederum war ich beim »Jerusalem-Tag«, einem Aufmarsch radikaler jüdischer Nationalisten, die die Stadt für sich beanspruchen und immer mehr auch das Land. Palästinensische Bewohner wurden von israelischen NGO-Helfern zu ihrem Schutz aus der Altstadt eskortiert.
Ein paar Tage später stand ich vor dem Flüchtlingscamp im besetzten Westjordanland, mit Palästinensern, die dort geboren worden waren und deren Großeltern bereits in Zelten gelebt hatten nach der Vertreibung von 1948. Heute ist ihr Camp von israelischen Soldaten besetzt. Ich traf Basel Adra, den Filmemacher, der in Hollywood einen Oscar gewann und in sein Dorf zurückkehrte – wissend, dass sich nichts zum Besseren ändern würde. Ständig verknüpfen sich die Fäden: Jeder Ort, jede Begegnung führt in eine Geschichte, die älter ist als die Menschen, die sie erzählen.
»Bis hierhin ist es der Blick durch ein Teleobjektiv. Doch um zu verstehen, was der 7. Oktober ausgelöst hat, muss die Linse geweitet werden«, schreibt mir ein Bekannter, auf mindestens ein 28er Weitwinkel. Denn der 7. Oktober hat Wellen über die gesamte Region gezogen. Es ist, als würde man die Züge eines Schachspiels verfolgen – jedoch auf vielen Schachbrettern gleichzeitig. Jeder Zug auf dem einen Brett löst Bewegungen auf den anderen aus. Der 7. Oktober hat das vernetzte Spiel im Nahen und Mittleren Osten noch einmal in eine neue Phase katapultiert. Israel verfolgt in diesem Krieg Ziele, die weit über die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Hamas hinausreichen. Im Kern geht es darum, den Iran so weit zu schwächen, dass er für Israel keine Bedrohung mehr darstellen kann. Deshalb wurde auch sein wichtigster Stellvertreter, die Hisbollah, massiv geschwächt. Und auch Assads Sturz, der Irans Garant für seine geostrategischen Züge durch die Region war, kommt Israel entgegen, wie auch ein instabiles neues Syrien.
Premierminister Benjamin Netanjahu ist nicht nur durch das Versagen am 7. Oktober gezeichnet, sondern steht auch unter massivem Druck seiner rechtsextremen Koalitionspartner. Diese drängen ihn, jede Form von Kompromiss auszuschließen und die Maximalforderungen durchzusetzen: ein Gaza ohne die Hamas, am besten ohne Palästinenser. Eine West Bank unter dauerhafter Kontrolle, mit kontinuierlichem Landgewinn. Netanjahu versucht, seine fragile Regierungskoalition zusammenzuhalten, seine juristische Immunität vor Korruptionsverfahren zu sichern – und zu beweisen, dass nur er in der Lage ist, Israels Sicherheit langfristig zu garantieren.
Meine Idee für dieses Buch, die komplexen Entwicklungen im Nahen Osten zu schildern, begann in Damaskus, fünf Tage nach dem Sturz von Bashar al-Assad. Ich stand in der Umayyaden-Moschee beim ersten Freitagsgebet nach Jahrzehnten der Diktatur. Für einen Moment schien es, als könnten die Geschicke des Landes eine Wendung nehmen. Dort, im Dezember 2024, erhielt ich eine SMS: »Wir bauen ein freies Syrien für alle, ohne Unterscheidung oder Diskriminierung. Syrien braucht uns alle, um es wieder aufzubauen, Stein auf Stein, und Hoffnung auf Hoffnung. Lasst uns wieder aufbauen, was zerstört wurde, reparieren, was beschädigt wurde, und einander unterstützen.« Geschickt von von der Führung der HTS-Milizen, die gerade das Land erobert hatten. Haben sie ihre Versprechen gehalten? Nagham, eine syrische Christin, schreibt mir später: »Immer, wenn wir denken, dass es besser wird, passiert etwas Schreckliches.«
Es war so viel los. Als ich in Beirut war, bombardierte Israel plötzlich inmitten des Waffenstillstands nach der Auslöschung der Führungselite der Hisbollah wieder die südlichen Vororte. Der Libanon ringt mit der historischen Aufgabe der Entwaffnung der Hisbollah. Für Beirut bedeutet das die wichtigste Machtprobe mit einer Miliz, die tief im Staat verankert ist und die von der Islamischen Republik Iran gesteuert wird.
Wenige Wochen zuvor, in Nordostsyrien, traf ich kurdische Milizionärinnen. Sie erzählten von den Jahren des Widerstands, von den erfolgreichen Kämpfen gegen den IS, von dem Erfolg ihrer Autonomie. Und während ich dort saß, erreichte uns die Nachricht, dass Damaskus und Ankara die Auflösung ihrer Bataillone wünschen, um sie der Armee der Islamisten in Damaskus unterzuordnen. Jener Islamisten, gegen die diese Frauen mutig gekämpft haben. Und genau ihre beiden Feinde wollen jetzt über ihr Schicksal bestimmen.
Oder jener skurrile Morgen in Tel Aviv: Ich saß an einem Hotelpool, ohne zu wissen, dass um mich herum israelische Kampfpiloten schwammen – Männer, die gerade erst aus dem 12-Tage-Krieg gegen die Islamische Republik zurückgekehrt waren. Ein reicher israelischer Geschäftsmann hatte ihnen und ihren Partnerinnen die Nacht im Luxushotel geschenkt, als Dank für ihren erfolgreichen Einsatz.
Und im Iran? Dort hat man die müde hoffnungslose Bevölkerung mit einem gedemütigten und angeschlagenen Regime allein gelassen. Einem Regime im Überlebenskampf, das jedoch noch genug Kraft hat, brutal gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen.
So reiht sich mein Erleben dieser Reisen aneinander, wie ein Mosaik aus Szenen, die einen, wie immer im Nahen Osten, dazu zwingen, mittendrin zu sein, auch wenn man sich für eine Beobachterin hält.
Jeder Akteur nutzt die Schwäche des anderen, um sich Raum zu verschaffen. Fast jeder ist gleichzeitig überfordert von der Gesamtlage.
Es gibt keinen klaren Plan, wohin die Reise gehen soll. Dennoch habe ich zwei Jahre nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas auf Israel zum ersten Mal ein klein wenig Hoffnung, dass es vielleicht doch einen Weg gibt aus der Ausweglosigkeit der ersten Monate, die zu einer Verhärtung der Fronten und der Herzen führten. Zu einer Kälte und Empathielosigkeit auf beiden Seiten.
Jetzt, im August 2025, sagt mir Iddo, der den Wehrdienst ver- weigerte, auf einer Demonstration in Tel Aviv, auf der Hunderttausende ein Ende des Krieges fordern: »Ich kann nicht Teil eines Systems sein, das Palästinenser unterdrückt, eines Systems, das ihr Leben in Gefahr bringt. Ich sehe meine Zukunft und Sicherheit als ein Israeli – als ein Jude – nur dann gesichert, wenn es Sicherheit für Palästinenser gibt.«
Auch wenn dies nicht die Mehrheitsmeinung ist, nehmen doch die Stimmen deutlich zu, die »Genug!« rufen. Knapp 75 Prozent der Menschen in Israel verlangen nach 22 Monaten ein Ende des Krieges. In erster Linie, weil die letzten noch lebenden Geiseln lebend zurückgeholt werden sollen, und weil die Gesellschaft müde ist.
Ayelet, eine Mutter von drei Kindern, die die Bewegung »Mütter an der Front« gründete und dafür kämpft, dass der Krieg endet, sagt mir: »Nach weit mehr als 600 Tagen appelliert Netanjahu jetzt für die Einnahme Gazas. Hier wird kein Gaza erobert werden, das wird nicht passieren. Mit wessen Kindern? Wenn Netanjahu das will, soll er doch seine eigenen Kinder einziehen, um in Gaza zu kämpfen. Oder die Kinder seiner ultraorthodoxen Koalitionspartner.« Ihr Ziel ist es, dass Mütter auf beiden Seiten wieder schlafen können. Doch ich weiß nicht, ob die palästinensischen Mütter in Gaza jemals wieder zur Ruhe finden können. »Die Hamas ist keine Gefahr mehr für Israel«, heißt es auf Social Media in einem Video, in dem ehemalige ranghohe israelische Sicherheitsverantwortliche, darunter Ex-Militärchefs, Mossad- und Geheimdienstleiter, scharfe Kritik an der Fortsetzung des Kriegs in Gaza äußern und ein Ende des Kriegs fordern. Mit Ami Ajalon, dem ehemaligen Schin-Bet-Chef, werde ich lange darüber sprechen. Die Hisbollah ist geschwächt und hat keinen charismatischen Führer mehr. Ihr Geldgeber, das Regime der Islamischen Republik Iran, ist zudem so schwach wie noch nie.