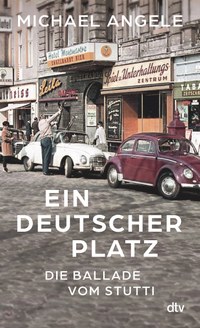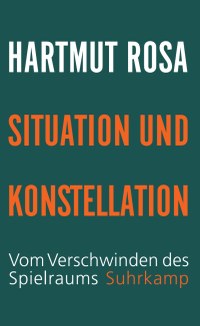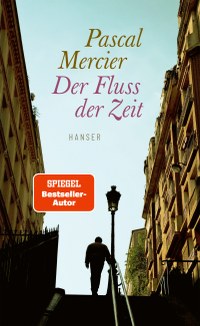Mitte der Sechzigerjahre kommt eine neue Bar an den Stuttgarter Platz. Eigentlich fängt die Geschichte der Babalu Bar aber schon ein halbes Jahrhundert früher an, in einem Weiler in der Nähe von Warschau, wo Nuchym Wajselfisz, Sohn des Jankel Wajselfisz und der Sluwa Wajselfisz, die ein Kolonialwarengeschäft und eine Mühle betreiben, 1908 geboren wird. Mit 28 Jahren heiratet er seine Zelda und arbeitet bei den Eltern im Kolonialwarenladen. Er ist ein attraktiver, sportlicher Typ, schafft es sogar in die Zeitung mit seiner Clique aus erfolgreichen polnischen Boxern, die meisten jüdischen Glaubens wie er. Dann kommen die Nazis an die Macht und überfallen 1939 den östlichen Nachbarn.
Nuchym wird in ein Arbeitslager verbracht, in welches, weiß man nicht mehr, er wird später nur wenig von dieser schrecklichen Zeit erzählen. Eine knappe Bemerkung hier, eine dort. „Im Lager haben sie mir die Zähne mit einer Peitsche rausgeschlagen“, sagt er seinem Sohn einmal. Aber Nuchym kommt irgendwie frei. Zurück in Warschau wird es immer schlimmer für die Juden, eine couragierte katholische Polin namens Gurska hilft ihnen. Sie führt Nuchym und Zelda, deren Vater Hananja sowie den neugeborenen Sohn Marian, zwei Onkel und eine Tante nach Otwocku. In dem Weiler leben Herr und Frau Grund. Die Eheleute Grund sind bereit, die Familie Wajselfisz gegen gutes Geld in ihrem Keller zu verstecken. Die Gurska hat dagegen für ihre Hilfe kein Geld genommen, dafür wird man sie ein halbes Leben später in Yad Vashem ehren.
Der größte Teil der Familie Wajselfisz wurde vergast. Aber die, die im Keller der Grunds hausten, haben die Shoa überlebt. Schon 1946 reist Nuchym das erste Mal von Warschau nach Berlin, zu den Schwarzmärkten. Ein georgischer Offizier nimmt ihn mit, vor der Sektorengrenze zieht er ihm seine Uniformjacke über den Kopf und sagt, er soll sich schlafend stellen. In Berlin kauft Nuchym Feuerzeugsteine auf dem Schwarzmarkt, steckt sie in seine Taschen und verkauft sie in Warschau wieder. Polen ist für Juden auch nach der Befreiung durch die Sowjets kein guter Ort.
1946 werden in Kielce über vierzig von ihnen ermordet und weitere achtzig verletzt, auch anderswo gibt es Pogrome. Nuchym und seine Familie wollen nichts wie weg. Die Bricha, die große jüdische Fluchtorganisation, organisiert den Transport von Stettin nach Berlin. Die Familie Wajselfisz geht einen anderen Weg. Ein Schlepper schleust sie in die Tschechoslowakei, eine kleine Odyssee führt über Prag und Lager in Stuttgart und München schließlich wieder nach Berlin. Erst leben sie zur Untermiete, dann bekommen sie eine eigene Wohnung in Charlottenburg.
Der Onkel lebt in der Nachbarschaft direkt neben einem Kino, Kurbel heißt es. In dem Kino soll Oliver Twist von David Lean gezeigt werden, nach dem Roman von Charles Dickens. Der Weg protestiert dagegen, der Gemeindevorsitzende Heinz Galinski schreibt selbst einen Artikel. Die Darstellung des Diebeskönigs Fagin, den Dickens einen „garstig aussehenden, abstoßenden alten Juden“ genannt hatte, stehe auf einer Stufe mit Veit Harlans Jud Süß. Schließlich versammeln sich vielleicht hundert jüdische Displaced Persons (D.P.) vor der Kurbel und werden von Berliner Schupos mit Schlagstöcken gewaltsam auseinandergetrieben. Es gibt Dutzende Verletzte und drei Festnahmen. In einer der ersten gewaltsamen Demonstrationen auf den Straßen West-Berlins, der unzählige folgen sollten, sind ausgerechnet Juden die Leidtragenden. Schlimmer kann es nicht anfangen. Aber es gibt kein Interesse an weiteren Auseinandersetzungen.
Einer ragt heraus
Fast herrscht so etwas wie Aufbruchstimmung. Oft sieht man Nuchym nun im Haus Brandenburg, wo er Billard spielt oder Geschäfte macht. Das Haus Brandenburg liegt am Kurfürstendamm 202, es ist der Treffpunkt der Juden, die entweder aus den D. P.-Lagern kommen, in Berlin selbst überlebt haben wie Hans Rosenthal, aus dem Exil zurückkehren wie Rolf Eden oder auf verschlungenen Wegen in die Stadt gefunden haben wie Nuchym selbst. Manchmal nimmt er den Sohn mit. Marian ist jetzt zwölf, vielleicht dreizehn, und er beobachtet, wie die Deutschen das Haus Brandenburg meiden, lieber auf der anderen Seite gehen.
Nachdem sie in München einen Schlaganfall erlitten hat, stirbt Nuchyms erste Ehefrau Zelda mit nur 44 Jahren im März 1958 in der Charité. Marian ist da schon bei seiner Tante in Buenos Aires, wo er seine vielleicht glücklichsten Jahre verbringt, bei River Plate boxt und unzählige Derbys zwischen River Plate und Boca Juniors verfolgt. Schließlich kehrt er nach Berlin zurück, wird Mitgründer des Fußballklubs TuS Makkabi Berlin und eröffnet in Neukölln seine erste Diskothek.
Sein Vater Nuchym wiederum lernt eine neue Frau kennen und eröffnet seine erste Bar in der Bülowstraße, die er nach ihr benennt, die Lolibar. Ob er Stasek Klinowski und seine Frau Doris auch im Haus Brandenburg kennengelernt hat, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Man kennt sich eben, die jüdische Szene ist überschaubar. Einer ragt schon damals heraus: Rolf Eden, der in Tempelhof geboren wurde, 1933 nach Palästina auswanderte, im ersten israelisch-arabischen Krieg kämpfte und dann nach Paris ging, wo er gerade dabei war, neben seinen Rollen als Musiker und Autohändler auch noch im Film Fuß zu fassen, als er in der Zeitung las, dass es für jeden geborenen Berliner 6.000 Mark gab, wenn er oder sie in seine Heimatstadt zurückkehrte. Shimon, wie seine Freunde ihn nach seinem richtigen Namen nennen, will nicht länger als Staubsaugervertreter arbeiten und träumt davon, ins Diskothekengeschäft einzusteigen. Mit dem Begrüßungsgeld und weiterer Hilfe finanziert er sich seinen ersten Laden, den Eden-Saloon in der Nestorstraße. Nuchym sponsert ihm die Musikbox, 5.000 Mark kostet sie. Mit seinen beiden Bars hat er es zu einem kleinen Wohlstand gebracht. Rolf Eden wiederum verkörpert wie kein anderer die Lebensgier der Überlebenden. Was ihr zugrunde liegt, begreift, wer hört, dass Eden zeitlebens keine Krankenhausbesuche gemacht habe, auf keine Beerdigung gegangen sei.
Mit den Leuten vom Stuttgarter Platz will Rolf Eden offiziell nichts zu tun haben, er ist Diskothekenbesitzer, kein Bordellbetreiber oder Chef einer Animierbar. Aber die Grenzen in der „Nachtbranche“, wie Marian Wajselfisz es ausdrückt, sind fließend, und Eden kennt „viele aus der Nacht“. 1965 kauft Rolf Eden das Haus Brandenburg und macht daraus den Klub New Eden, nach dem Old Eden seine zweite Diskothek.
Ungefähr zur gleichen Zeit eröffnet das Ehepaar Klinowski zusammen mit Nuchym das Babalu am Stuttgarter Platz 10. Das Haus ist ein Einstöcker mit der zeittypischen Kachelfassade. Der neuen Bar muss ein Bekleidungshaus weichen. Aber ein Haus weiter gibt es ja noch eins. Der Betreiber der Babalu Bar sucht wie die anderen Bars junge attraktive Frauen, die dem Gast eine so gute Zeit machen, dass der es sich etwas kosten lässt. Gerne gesehen sind Studentinnen, die können gut reden. Antje Krüger, die an der Werkkunstschule studiert, ist so eine, kann gut reden, kann auch das Gegenüber reden lassen, hübsch ist sie außerdem, große Augen und Bubikopf. Gelegentlich sieht man sie samstags nachts in der Babalu Bar. Aufgewachsen ist sie in Tiergarten, in ihrer Straße gibt es einen Sportplatz, der als Drehort für Die Halbstarken diente. Aber nun ist die Zeit der Halbstarken vorbei, die englische Beatkultur ist ihr Ding.
Eigentlich wollte Antje Schaufensterdekorateurin werden, die Schaufenster vom KaDeWe sind toll ausgestaltet, aber Oma und Mama fanden, dass sie etwas Handfestes lernen soll. Krankenschwester oder, noch besser, Kindergärtnerin. So denken die einfachen Leute zwanzig Jahre nach dem Krieg immer noch. Außerdem kann Antje doch so gut basteln und werkeln, das mögen Kinder. Aber das ist nun wirklich Quatsch, Werkeln kam so gut wie gar nicht vor. Dennoch macht sie die Ausbildung zu Ende, will aber nicht als Kindergärtnerin arbeiten, lieber richtig basteln und werken, aber erst mal, ohne zu arbeiten – also studieren. An der Werkkunstschule belegt sie den Studiengang Angewandte Kunst. Die Schule liegt an der Straße des 17. Juni, auf der Rückseite der Technischen Universität, der TU, der Steinplatz ist nicht weit; ein Platz mit einem Café, an dem ein kleines Kino dranhängt, in das man für 80 Pfennig reinkommt. In der Winterfeldtstraße findet sie ein Zimmer in einer großen Wohnung. Und Antje will mit ihrer Freundin Gudi nach Irland reisen.
Wenn der letzte Gast weg ist
Das Geld dazu verdienen sie am Stuttgarter Platz. Von Schöneberg fährt sie nun samstags nach Charlottenburg und geht dort zuerst in die Lolita Bar. Auch die Lolita Bar ist mit der Zeit gegangen. Nun gibt es eine farbige, in Quader unterteilte Tanzfläche, die von unten beleuchtet wird. Das hat was, kann man gut drauf tanzen. Auch der Verdienst ist immer noch gut, denn die Gäste lassen sich auch in der Lolita Bar abzocken, sie bestellen auch hier die albernen Getränke, in denen eigentlich nichts drin ist. In den Bars gibt es für die Frauen ein Fixum, so 15 Mark. Bestellt der Gast ein Getränk, muss er eins für das Animiermädchen mitbestellen. Wenn die Männer einen Cocktail für das Mädchen bestellen, gibt es vier Mark auf dem Zettel. Jede Frau hat so einen Zettel. Die Kellner sind nett und schauen, dass alles korrekt aufgeschrieben wird. Manchmal will ein Gast auch, dass man ein Bier mit ihm trinkt. Aber Antje mag nicht den ganzen Abend trinken. Einmal lässt sie ein Bier am Stuhlbein entlanglaufen, damit es nicht auf den Fußboden plätschert. Dummerweise läuft das Bier einem Engländer in den Schuh. Der ist nicht amüsiert. So what.
Wenn in der Lolita Bar Schluss ist, geht sie manchmal noch ins Babalu. Am Ende eines langen Abends hat Antje Krüger ein paar Briten oder Messebesucher abgefüllt und geht mit 65 oder 70 Mark raus. Es gibt Frauen, die noch mehr verdienen. Aber es reicht auch so. Das Geld steckt Antje in Bücher, die dann doch bei ihr rumliegen, oder sie vergisst es in einer blauen Brieftasche, die sie an einen Freund verschenkt hat, der gerade eine braucht.
Schluss in einer Bar ist, wenn der letzte Gast gegangen ist. Dann ist aber immer noch nicht Schluss. Dann fahren sie und Gudi in die Rankestraße, dort wohnen Horst Tomayer, ein bunter Hund, ehemaliger Mitarbeiter der St. Pauli Nachrichten und Assistent des Satirikers Wolfgang Neuss, und Toby Fichelscher, ein Drummer und Bluessänger, Star der Eierschale, interessanter Typ, er ist der Freund von Gudi. Oder man läuft noch ins Old Eden in Wilmersdorf, den Klub von Rolf Eden. Er hat bis in die frühen Morgenstunden auf. Dort verkehrt ein illustres Völkchen.
Da ist ein Neffe der Reporterlegende Herbert Zimmermann, den jeder von der Weltmeisterschaft 1954 kennt, der Neffe studiert Jura, Hans-Christian Ströbele heißt er. Auch Andreas Baader, den Antje schon vom Steinplatz kennt, trifft sie im Old Eden, oder Rolf Zacher, der ganz jung bei Wolfgang Staudte mitgespielt hat, von einer Filmkarrier träumt, aber vor allem sich selber spielen kann. Das aber unnachahmlich.
Michael Angele ist Leiter des Ressorts Debatte beim Freitag