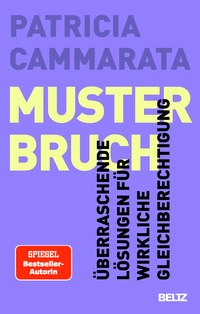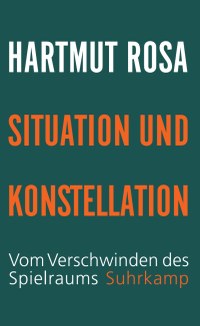Auf Konferenzen zum Thema Equal Care sagt früher oder später jemand: »Wir haben kein Wissensdefizit, sondern ein Handlungsdefizit.« Mein Vorgängerbuch Raus aus der Mental Load-Falle ist genau aus dieser Motivation entstanden. Wenn doch schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist, was Mental Load und Emotionsarbeit sind, warum sind vor allem Frauen davon belastet und warum sehen viele Männer den Wert dieser Arbeit nicht – ja, nicht mal die Belastung? Noch wichtiger: Wie lässt sich das ändern?
Seit dem Erscheinen des Buchs habe ich viele Vorträge gehalten und mir wurde klar: Es sind noch viele Fragen zu beantworten. Und außerhalb der Blase der Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Sorgearbeit beschäftigen, gibt es durchaus ein Wissensdefizit. Mit Musterbruch möchte ich dem entgegenwirken. Ich möchte die komplexen Mechanismen, die hinter der Ungleichverteilung von Sorgearbeit stehen, näher beleuchten, möglichst einfach erklären und dann gleich Ansätze in die Hand geben, wie wir dieses Wissen im Alltag umsetzen können. Dabei soll berücksichtigt sein, dass gerade diejenigen, die durch Sorgearbeit stark belastet sind, nur selten die Zeit haben, lange, komplizierte Abhandlungen zu lesen.
Zu meinem allerersten Buch Sehr gerne, Mama, du Arschbombe erhielt ich oft die Rückmeldung, es sei eine super Klolektüre. Anfangs war ich etwas empört, was sollte das heißen? Ein Buch fürs Klo? Doch dann ging es mir auf. Die kurzen Geschichten waren bestens geeignet, sie zwischen Tür und Angel zu lesen – oder eben, auch wenn es ein bisschen unhygienisch klingt: auf dem Klo. Das Klo als kleine Alltagsflucht also. Der Ort, an dem man mal fünf Minuten für sich hat.
Das Buch, das ihr jetzt in der Hand haltet, soll auch ein Klobuch sein. Eines, das gelesen und nicht nur gekauft wird. Eines, das Ansätze liefert, wie man auf individueller Ebene Dinge so verändern kann, dass unsere Welt gerechter wird – für uns, für unsere Kinder, für alle. Der erste Schritt ist stets, Verständnis für einen bestimmten Zusammenhang zu schaffen. Nicht immer gibt es im bestehenden System eine Lösung. Oft aber doch.
Auf der individuellen Ebene anzusetzen, kann man kritisieren. Bekannte Sprüche wie »Don’t fix women, fix the system« sind natürlich wahr. Unsere Gesellschaft macht den Menschen vor, dass sie alles erreichen können, vorausgesetzt natürlich, sie strengen sich richtig an. Wenn man dann doch nicht erreicht, was man möchte, ist man eben selbst schuld. In Wahrheit gibt es einen festgesteckten Rahmen, an dessen Grenzen Menschen an unterschiedlichsten Stellen aus unterschiedlichsten Gründen stoßen. Spricht man das laut aus, muss man sich schnell anhören, man nehme eine Opferhaltung ein. Und wer will schon ein Opfer sein? Wenn es irgendwie geht, freunden sich Menschen dann lieber mit den Ungerechtigkeiten an und deuten sie um. Es liegt zudem in der menschlichen Natur, lieber das bereits Bekannte hinzunehmen, als sich auf Neues einzulassen. Vor Veränderungen fürchten sich viele. Diejenigen, denen es im bestehenden System gut geht, natürlich am meisten.
_________
»Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.« Franz Kafka
Ich bin absolut dafür, Ungerechtigkeiten zu benennen und an deren Abbau aktiv zu arbeiten. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die Handlungsspielräume haben, die sie noch nicht vollständig nutzen (schlicht: weil sie eben doch ein Wissensdefizit haben). Nicht jede*r, aber viele können auf der individuellen Ebene Verbesserungen erzielen. Arbeit an beiden Ebenen schließt sich nicht gegenseitig aus. Wir können auch durch unsere Wahlentscheidung oder unser eigenes politisches Engagement Veränderungen anstoßen. Der Nachteil an Änderungen auf der systemischen Ebene ist der, dass sie nur sehr langsam passieren. Bis sie wirken, kann es Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. So lange können wir nicht warten.
Nils Pickert schreibt in seinem wunderbaren Buch Lebenskompliz*innen: »Gleichberechtigte Elternschaft kriegen Sie nur gegen das System hin. Gegen politische Entscheidungen, gegen die Nachbarschaft, gegen das Geflüster beim Kuchenbasar.«1 Dieser Satz hat ein großes Echo in mir hervorgerufen. Denn natürlich kann ich, Patricia, mit meinem Partner Marcus Dinge anders machen als andere Paare und Eltern. Aber wir tun das gegen Widerstände. Der Mensch ist ein Gruppentier. Was wir tun und denken, wird wesentlich davon bestimmt, was unser Umfeld tut und denkt.
Vielleicht kennt ihr das: Man steht an einer roten Ampel und links und rechts neben einem strömen die Menschen über die Straße. Sie alle ignorieren das rote Licht, nur man selbst steht beharrlich vor dem Verkehrssignal und wartet. Eigentlich hat man keinen Zeitdruck, aber die innerliche Unruhe steigt, je mehr Menschen sich anders verhalten als man selbst. Das Herdentier in einem scharrt mit den Hufen. Die Sekunden, bis die Ampel auf Grün schaltet, kommen einem unendlich lange vor, man fühlt sich falsch, obwohl man weiß, dass es eigentlich richtig ist, an einer roten Ampel zu warten. So ist es auch, wenn man versucht, gleichberechtigt zu leben – und zwar gegen alle äußeren Kräfte, denn Gleichberechtigung ist im Patriarchat gar nicht vorgesehen.
Immerhin wollen viele Paare gleichberechtigt leben und wir distanzieren uns geistig von den traditionellen Rollen. Schon 2017 lehnten knapp drei Viertel der Deutschen die Aussage ab, dass es die wichtigste Aufgabe der Frau sei, sich um Haushalt und Familie zu kümmern. Hinzu kommt, dass fast zwei Drittel der Auffassung widersprachen, dass es die wichtigste Aufgabe des Mannes sei, Geld zu verdienen. Doch Wunsch und Wirklichkeit klaffen immer noch weit auseinander. Das belegen die Zahlen zur Sorgelücke (dem Gender Care Gap). Meine Lieblingszahl dazu: Das größte Ungleichgewicht zeigt sich bei 34-Jährigen, hier übernehmen die Frauen 110,6 Prozent mehr Sorgearbeit. Prozentangaben können ja alles Mögliche heißen, deswegen noch mal in Minuten: Die Frauen verbringen täglich durchschnittlich fünf Stunden und 18 Minuten mit Sorgearbeit, die Männer dagegen nur zwei Stunden und 31 Minuten. Wer in Mathe aufgepasst hat, könnte einwenden, dass eine solche Zahl auch zustande kommen könnte, wenn es einige wenige Haushalte gibt, bei denen das Ungleichgewicht extrem ausgeprägt ist, während ein Großteil ein ganz ausgewogenes Verhältnis hat. Spoiler – dem ist nicht so. Egalität leben nur rund 15 Prozent der Paare in Deutschland. Die ungleiche Verteilung ist »keine Randerscheinung, sondern weit verbreitet«. Uff! Bis »Wir teilen uns die Arbeit gerecht auf« ist es noch ein langer Weg.
Erich Kästner (okay, ich dachte, es war Pumuckl) hat gesagt: »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, und das stimmt auch beim Thema Gleichberechtigung. Doch die Schwierigkeit liegt eben im Gegendruck des Systems. Wir stehen vereinzelt an der roten Ampel und alle anderen rennen an uns vorbei.
Die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, was eine gute Mutter tut (und was ein guter Vater), begegnen uns im Alltag bei den kleinsten Lappalien. Während mein Partner es zum Beispiel völlig normal findet, dass ich gerne alleine in den Urlaub fahre, ernte ich in anderen Kreisen dafür immer noch besorgte Fragen: »Aber wer kümmert sich dann um die Kinder?« Es fällt mir dann immer sehr schwer, nicht sarkastisch zu antworten: »Wieso? Die kette ich mit ausreichend Wasser und Brot an die Heizung«, sondern zu erläutern, dass meine armen Kinder sehr gut von meinem Partner, ihrem Bonus-Papa, versorgt werden.
Musterbruch soll die Muster beschreiben, die uns das gleichberechtigte Leben schwer machen, weil wir, wenn wir diese Muster brechen, gegen den Strom schwimmen. Ich möchte auch dazu beitragen, Verständnis zu schaffen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Den Status quo zu verstehen und Ursachen zu kennen, halte ich für eine Voraussetzung, Änderungen überhaupt angehen zu können. Oft entwickelt sich eine Stärke allein aus der Erkenntnis: Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht alleine. Gerade Letzteres hat für mich eine nicht zu vernachlässigende Kraft. Deswegen gehe ich gerne auf Demos. Denn wenn ich zu Hause sitze und mir den Kopf zerbreche, wie meine Kinder später mal ein gutes Leben leben sollen, fühle ich mich schwach und ohnmächtig. Stehe und gehe ich mit Hunderten, ja, manchmal Tausenden und Zehntausenden von Menschen, erfüllt mich das mit Kraft und Glück. Dieses Buch soll euer Weggefährte sein, sodass ihr euch nicht als Außenseiter*innen fühlt, weil ihr anders leben wollt, als es die meisten auch heute noch tun.
Wo das Ungleichgewicht nicht herkommt
Dass Frauen in den meisten Fällen mehr Sorgearbeit übernehmen als Männer, wird von einem Großteil der Gesellschaft als normal angesehen. Zum einen, weil viele davon ausgehen, dass Frauen das durchaus freiwillig tun, weil sie eine Art Kümmerinstinkt haben. Zum anderen, und das gilt vor allem, wenn es Kinder in den Paarbeziehungen gibt: Es erscheint den meisten Menschen logisch, weil Männer in ihrem Umfeld öfter Vollzeit erwerbsarbeiten als Frauen, die ihre Erwerbsarbeit einschränken, um sich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern.
Es gilt also die These: Wer viel erwerbsarbeitet, leistet wenig Sorgearbeit, und umgekehrt, wer viel Sorgearbeit leistet, der erwerbsarbeitet wenig. Daraus ließe sich vielleicht logisch ableiten, dass beide, wenn sie gleich viel erwerbsarbeiten, auch gleich viel Sorgearbeit leisten. Das müsste sich in bestimmten Zahlen entsprechend widerspiegeln.
Dem ist jedoch nicht so. Es gibt starke Indizien, dass der gesellschaftlich behauptete Zusammenhang zwischen der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit so nicht stimmt. Sonntags leisten Frauen mehr Sorgearbeit als Männer. Die Lücke vergrößert sich, wenn Kinder im Haushalt leben. Das ist insofern relevant, weil zu erwarten wäre, dass an einem Tag, an dem die meisten Paare nicht erwerbsarbeiten, die Sorgearbeit gleichmäßig verteilt ist.
Im gleichen Umfang einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, führt nicht dazu, dass die Sorgearbeit gleich verteilt ist. Besonders deutlich wird das in Paarbeziehungen mit Kindern: Arbeiten die Eltern beide Vollzeit, leisten Frauen mehr Sorgearbeit als Männer. Die Sorgelücke beträgt dann 41,3 Prozent. Das gilt auch, wenn beide Teilzeit arbeiten und sogar, wenn beide nicht erwerbsarbeiten.
Ist die Frau Alleinverdienerin, leistet sie mehr Sorgearbeit als der nicht erwerbstätige Partner.Überraschend, oder? Ich teile diese Zahlen gleich zu Beginn, denn da ist der Kopf noch frisch und aufnahmefähig. Macht euch also einen ersten Strich auf der Liste der Musterbrüche. Wenn ihr bislang gedacht habt, dass Frauen ausschließlich mehr Sorgearbeit leisten, weil sie weniger erwerbsarbeiten: Nö. Es ist sehr viel komplexer. Und ob es einen Kümmerinstinkt gibt oder nicht, darauf werden wir auch noch eingehen.
Weibliche Minderwertigkeitsgefühle Abbauen
Eine wichtige Voraussetzung für Gleichberechtigung ist, dass wir uns gleichwertig fühlen. Nur dann können wir uns auf Augenhöhe begegnen. In allen anderen Fällen bleiben wir in einem Machtgefälle, das Aushandlungsprozesse erschwert. Bedauerlicherweise fühlen sich viele Frauen mindestens unbewusst den Männern gegenüber alles andere als gleichwertig. Dabei basieren die weiblichen Minderwertigkeitsgefühle auf zwei zentralen Pfeilern: Erstens bringen wir in unserer Gesellschaft den Frauen bei, dass ihr Aussehen zentral für ihren Wert ist, und zweitens, darauf gehen wir später noch ein, bringen wir Frauen bei, dass sie nicht annähernd so relevant wie Männer sind.
Beginnen wir mit dem Thema Schönheit. Eine meiner Lieblingsszenen in der großartigen BBC-Kurzserie Fleabag geht so: Fleabag und ihre Schwester sitzen in einem Vortrag einer renommierten Feministin. Es geht um gesellschaftliche Schönheitsideale. Die Rednerin fragt als Warm-up das Publikum: »Wer von Ihnen würde zwei Jahre ihres Lebens für den perfekten Körper opfern?« Fleabag und ihre Schwester haben die Arme schneller oben, als die Kamera auf sie schwenken kann. Alle anderen schauen entsetzt in ihre Richtung und schütteln den Kopf. Darf man als Feministin einem Schönheitsideal nachhecheln? Ganz ehrlich, ich hätte mich auch gemeldet. So bitter und widersprüchlich das zu meiner inneren Haltung ist.
Mädchen wachsen auch heute immer noch mit der Ausrichtung auf, dass ihr Aussehen eine Art Kapital ist. Gleichzeitig definieren sich Mädchen und Frauen viel mehr über andere, sie sind interdependent, denn sie bekommen von klein auf beigebracht, ihren Fokus nicht auf sich selbst, sondern auf andere zu legen. Das hat aber auch eine Kehrseite, denn deswegen hat sowohl reales als auch imaginiertes Feedback mehr Gewicht für sie, berichtet die Psychologin Astrid Schütz in einem Interview. Ihr Selbstbewusstsein ist damit eher von anderen abhängig. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Mädchen und Frauen sich eher mit einem Ideal vergleichen. Jungs und Männer beziehen sich dementgegen eher auf eine reale Gruppe, also ihr direktes Umfeld.
_________
»[A]s a woman you’re always either too old or too young for things, because the perfect age is when you’re a man.« @cassrattray
Viele Frauen haben ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper. Wer das nicht glaubt oder nachvollziehen kann (etwa, weil er ein Mann ist), dem empfehle ich den Dokumentarfilm Embrace, in dem die australische Fotografin Taryn Brumfitt der Frage nachgeht, warum so viele Frauen mit ihrem Körper unzufrieden sind. Brumfitts Botschaft lautet: »Liebe deinen Körper, wie er ist, er ist der einzige, den du hast!«
Der Film schockiert, denn er zeigt sehr gut auf, wie schlecht das Verhältnis vieler Frauen zu ihrem Körper ist – und zwar völlig unabhängig davon, wie normschön er tatsächlich ist. Mehrere Frauen antworten auf die Frage: »How would you describe your body?« mit »Disgusting«, und das sind keine bedauerlichen Einzelfälle. Auch auf Plattformen wie Instagram ist immer wieder zu lesen, dass viele Frauen sehr mit ihrem Aussehen kämpfen.
Als junge Frau war ich auch nicht mit meinem Körper zufrieden. Aber ich kann wenigstens sagen, dass ich ihn nie gehasst habe. Es gab allerdings eine lange Phase, in der ich mich viel mit der Menge an Kalorien beschäftigt habe, die ich aufnehme, und überzeugt war, dass alles jenseits von Kleidungsgröße 36 nicht attraktiv ist. Wenn mich heute jemand wie im Film fragen würde: »Wie würdest du deinen Körper beschreiben?«, lautete meine Antwort in etwa so: »Ein bisschen moppelig, aber insgesamt sehr zweckmäßig. Mein Körper kann nämlich sehr gut kuscheln, mit viel Freude Kuchen essen und einfach so mit einem Schraubendreher Rigips-Dübel in die Wand drehen. Top Körper! Gerne wieder!«
Älterwerden ist eine echte Chance, ein besseres Verhältnis zu seinem Körper zu bekommen. Ich habe mir den Prozess so erklärt: Solange man noch nah am Jugend-, Schönheits- und Schlankheitsideal ist, sind Abweichungen schmerzhaft. Mit einigen Tricks, ein bisschen Diät und Schminke robbt man sich dann weiter an den Idealzustand heran.
Dann wird man vierzig und älter, und irgendwann sind es nicht fünf graue Haare, sondern so viele, dass man sie nicht zählen kann, und so viele Falten, dass man sie nicht wegschminken kann. Dieser Übergang tut kurz weh und dann ist man zu weit weg von den Magazin-Schönheitsansprüchen und dann ist es einem (weitgehend) herzlich egal.
Jedenfalls: Je weniger mir all die Äußerlichkeiten an mir wichtig sind, desto egaler sind sie mir auch an anderen. Denn was zur Hölle geht mich der Körper anderer Menschen an? Mir ist irgendwann auch klar geworden, dass ich mich noch nie aufgrund eines bestimmten Aussehens in jemanden verliebt habe, und ich empfinde wirklich Mitleid für Menschen, denen das so wichtig ist, dass sie ihre Partnerwahl extrem einschränken müssen, weil sie eben beispielsweise nur blonde Frauen mit Kleidergröße 36 attraktiv finden können oder nur Sex haben können mit Frauen, die sich ihre Schamhaare rasieren.
Schönheit ist ohnehin vergänglich. Wir müssen deswegen weg von der Vorstellung, dass Schönheit überhaupt ein Kriterium ist, das uns liebenswert macht. Diese Love-your-Body-alle-Menschen-sind-schön-Appelle sind, wenn man genauer darüber nachdenkt, nicht zielführend. Warum sollen alle schön sein müssen? Wenn man ständig dazu aufruft, dass alle Menschen schön sind, dann folgt man weiter einem Schönheitsparadigma. Denn es geht offenbar nicht, dass man nicht schön ist. Alle sind schön, nur divers schön oder individuell schön, aber eben auf jeden Fall schön. Ohne das Schönsein geht es offenbar nicht. Die Dimension ist schön/hässlich. Was anderes kommt nicht infrage.
Bezogen auf mein Aussehen fühle ich in der Zwischenzeit eher so was wie eine Egalness. Deswegen rufe ich zur Aussehen-Egalness auf! Eine Aussehen-Egalness-Bewegung würde insgesamt helfen, ein entspannteres Verhältnis zum eigenen Körper zu bekommen. Gelingen kann das vielleicht, indem man sich stärker auf das fokussiert, was ein Körper einem ermöglicht, als darauf, wie ein Körper aussieht. Und auch da sollten Höchstleistung oder Perfektion kein Kriterium sein. Denn spätestens mit zunehmendem Alter (oft aus verschiedensten Gründen weit vorher) wird auch die Funktionsfähigkeit eingeschränkt sein.
Vielleicht helfen euch diese zwei Gedanken, um zukünftig liebevoller auf euch zu blicken:
Wie schaut ihr auf Menschen, die ihr liebt? Wie wichtig sind euch Äußerlichkeiten bei anderen? Müssen Freund*innen und Partner*innen für euch perfekt aussehen? Wenn ihr diese Antworten habt, behaltet sie im Kopf, und traut den Menschen in eurem Umfeld zu, dass sie ebenso auf euch blicken, wie ihr liebevoll auf sie blicken könnt.
Kennt ihr folgendes Phänomen: Ihr seht ein älteres Foto von euch von vor – sagen wir – drei Jahren: Denkt ihr manchmal: »Oh, da sehe ich eigentlich ganz gut/jung/schlank/erholt/fröhlich aus!« Ja? Ihr werdet genau dasselbe in drei Jahren von einem Foto denken, das heute jemand von euch macht. Und in drei Jahren wieder und dann wieder. Also könnt ihr das auch gleich von euch denken, und zwar heute und jetzt.