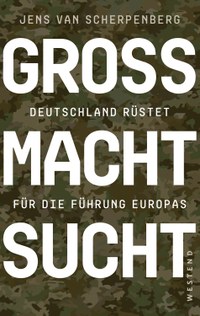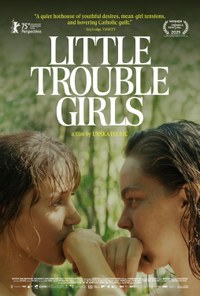Dass Filmkameras auch Waffen sind, ist in unserer digital-visuellen Kultur kaum noch wahrnehmbar. Das Online-Foto wird als konstituierend für die Persönlichkeit wahrgenommen und nicht umgekehrt als Abbild der einen Person, der damit möglicherweise etwas genommen wurde.
Dem Dokumentarfilm ist das Verhältnis von Gewalt, Technik und Erzählen noch anzumerken, insofern die Anwesenheit der Filmkamera Reaktionen bei den Gefilmten hervorruft. In Tomer Heymanns Dokumentarfilm I shot my love über seinen deutschen Lover Andreas und seine Mutter Noa wird die Aufdringlichkeit der Aufnahmesituation zunächst zu einer Art Running Gag.
„Ich habe meine Mutter nur unter der Bedingung ins Krankenhaus begleitet, dass ich die Kamera mitnehmen darf“, erzählte der israelische Filmemacher über die Filmszenen, die seine Mutter vor und nach einer Hüft-OP zeigen, etwas kokett im Interview nach der Filmpremiere letztes Jahr auf der Berlinale. Hier hatte Heymann 2006 mit seinem Dokumentarfilm Paper Dolls über philippinische Transsexuelle, die in Israel als Altenpfleger arbeiten, den Panorama-Publikumspreis gewonnen.
Haggada auf Deutsch
Dass es sich bei den Reflexionen über die Aufnahmesituation in I shot my love nicht nur um einen billigen Trick handelt – der Filmemacher gibt seine Schuld gegenüber den Abgefilmten zu, in der Absicht gerade dadurch weiterzufilmen – wird vor allem durch die Liebesbeziehung mit seinem Freund Andreas deutlich. Plötzlich wird in der Filmsituation die Frage nach dem Verhältnis von Opfer und Täter konkret: Tomers Freund kommt aus Deutschland.
Vom ersten Moment an, den intimen Duschszenen in einer Berliner Wohnung, nachdem sich die beiden Männer im Club kennengelernt haben, geht es um die Vergangenheitsbewältigung auf der Ebene einer schwulen Liebesbeziehung. Der blonde Lover mit den blauen Augen nutzt die Film-Bühne charmant: Unschuldig trällert er deutsches Liedgut, verspielt zeigt er seine Kochkünste oder übt konzentriert Tanzbewegungen. Schnell stellt sein jüdischer Freund bohrende Fragen: Bist du gerne deutsch? Hast du mit deinen Großeltern über die Vergangenheit gesprochen? Heymanns Position, versteckt hinter der Kamera, ist nicht ohne Sadismus. Als ginge es darum, das geschichtliche Täter-Opfer-Verhältnis auf privater Ebene umzukehren.
Andreas wird im Kreis der jüdischen Familie wie selbstverständlich aufgenommen. Beim Pessach-Fest zitiert er inmitten von Tomers Verwandten auf Deutsch aus der Haggada. Tomers Onkel Werner hat sie ihm gegeben, „die ist noch aus der jüdischen Gemeinde in Emmendigen“. Onkel Werner war wie Tomers Großvater vor den Nazis nach Palästina geflüchtet.
Keine billige Versöhnung
Deutsch-jüdische und israelisch-deutsche Begegnungen treten in widersprüchlichen Konstellationen auf. Alle Beteiligten sind in ein privates und historisches Netz von Bindungen und Bedeutungen verstrickt, aus dem es keine Abkürzungen gibt. Die Intensität des Films hängt von dem Mut ab, sich auf das verminte Terrain zu begeben, wovon Heymann sich selbst nicht ausnimmt. Und von der „Gewalt“, die es letztendlich bedeutet, diese widersprüchlichen intimen Momente mit der Kamera schonungslos einzufangen.
Das filmische Ergebnis ist faszinierend. Und Heymanns große Leistung liegt darin, dass er der allzu leichten Versuchung widersteht, schwule Liebe als Versöhnung der Verbrechen von Deutschen an Juden zu inszenieren.