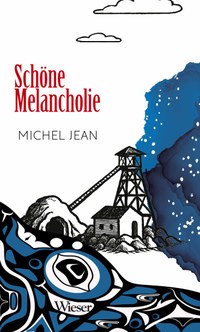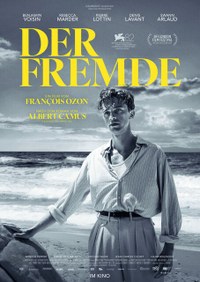Die Sache mit Bradley Manning ist der US-Regierung offenbar etwas entglitten und peinlich geworden. Ende April wurde der mutmaßliche Wikileaks-Informant von seiner weltweit als erniedrigend, demütigend und verfassungswidrig angeprangerten Haft im Militärgewahrsam von Quantico im Bundesstaat Virginia nach Fort Leavenworth in Kansas verlegt. Mannings Verteidiger David Coombs erfuhr davon aus den Medien. Ausgewählte Reporter durften die „moderne“ Militärhaftanstalt besichtigen. In den Zellen dort gibt es sogar Fenster nach draußen. Sprecher der US-Armee haben inzwischen versichert, Manning sei verhandlungsfähig: keine psychologischen Probleme. Die Bedingungen bei der Einzelhaft in Quantico seien zu seinem Schutz nötig gewesen und hätten den Vorschriften entsprochen.
Szenenwechsel und Rückblick auf das vergangene Wochenende und das Hilton-Hotel in Washington: die jährliche Gala der White House Correspondents Association. Da tummelt sich die journalistische High Society mit Politikern, Lobbyisten und Stars aus dem kulturellen Hochglanz-Milieu, sprich: Hollywood. Die opulente Verschränkung des Journalismus mit Institutionen, denen man auf die Finger schauen soll, wird manchen Kollegen allmählich peinlich. Die Washington Post saß in diesem Jahr besonders in der Klemme, hatte sie doch den aufgeplusterten Immobilien-Mogul Donald Trump als Gast an ihren Tisch gebeten, der sich gern Schlagzeilen verschafft, wenn er Gefallen daran findet, die Legitimität des ersten afro-amerikanischen Präsidenten anzuzweifeln.
Barack und Michelle Obama waren auch im Hilton. Der Präsident – souverän wie immer bei solchen Anlässen. Nahm sich in seiner Ansprache selber ein bisschen auf den Arm, machte sich lustig über den mit versteinertem Gesicht und Haar dasitzenden Donald, der sich nach dem Vorlegen der Geburtsurkunde nun wichtigeren Fragen zuwenden könne, etwa ob die Astronauten seinerzeit wirklich auf dem Mond gelandet seien. Obama sprach lobend von Journalisten, die manchmal unter großer Gefahr über „die Revolutionen im Nahen Osten“ berichteten.
Etwas menschlicher
Kabarettist Seth Meyers verschonte anschließend den Präsidenten nicht über Gebühr. Obamas Aussichten auf eine Wiederwahl 2012 seien sehr gut, meinte er, die republikanische Kandidatenriege sei doch recht dürftig. Der Einzige, der gegen Obama gewinnen könne, wäre wohl der Obama von 2008. Der charismatische Hoffnungsträger, der vielleicht ein bisschen zu idealistisch gewesen sei. Obama nickte.
Der „Fall Manning“ führt in diesem Zusammenhang vor, wie sehr die Spielräume eines charismatischen Hoffnungsträgers begrenzt sind. Der Jurist Obama, angeblich besonders im Verfassungsrecht bewandert, hat es sich doch nicht nehmen lassen, Mannings an Guantánamo erinnernde Behandlung in Quantico zu verteidigen. Die Offiziere dort, die den Gefangenen zuweilen nackt zum Morgenappell antreten ließen, konnten sich bestätigt sehen vom Oberkommandierenden der US-Streitkräfte. Bei einem 5.000-Dollar-pro-Ticket-Fundraiser in San Francisco Ende April wurde Obama auf Manning angesprochen. Man dürfe nicht vergessen, so der Präsident, Manning „hat das Gesetz gebrochen“, und die USA seien „eine Nation des Rechts“. Es könne nicht jeder selbst deuten, was die Gesetze vorschreiben.
Eine von den Fakten losgelöste Behauptung. Ob Manning „das Gesetz gebrochen“ hat, steht rechtlich gesehen erst nach einem Prozess und einem Urteil fest. Bradley Manning sitzt ja noch in Untersuchungshaft. Obamas Vorverurteilung hat die Chancen auf ein faires Verfahren nicht unbedingt gesteigert. Irgendwie peinlich ist Mannings drohender Strafprozess – die genaue Anklage steht offenbar noch nicht fest – wohl auch für so manchen Redakteur. Die angeblich von Manning an Wikileaks geleiteten Geheiminformationen sind seit Monaten immer wieder gut für Enthüllungsgeschichten. Aber man bleibt auf Distanz zu Manning und erst recht zum Wikileaks-Champion Julian Assange. Die Haftbedingungen in Kansas sind wohl menschlicher als die in Quantico. Bradley Manning wird angeblich auch „Feindbegünstigung“ vorgeworfen. Es drohen ihm Jahrzehnte Haft.
Konrad Ege ist seit 1990 USA-Korrespondent des Freitag