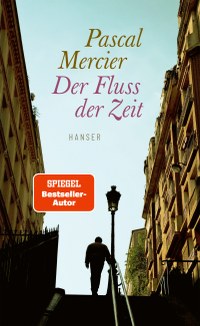Wie Dokumente zeigen, die dem Blog netzpolitik.org zugespielt wurden, hat die Berliner Polizei Ende 2009, Anfang 2010 immer wieder Handydaten aus dem Stadtteil Friedrichshain angefordert und ausgewertet, wer wann mit wem telefoniert hat. Der richterlich genehmigte Datencheck sollte bei der Suche nach Zündlern weiterhelfen, die damals mehrere Autos in der Gegend angesteckt haben.
Um es kurz zu machen: Die Brandstifter schnappten die Polizisten so nicht. Dafür machten sie die Bevölkerung eines halben Stadtteils zu Verdächtigen. Man kann nun wie der Grünen-Abgeordnete Christian Ströbele spekulieren, ob das Interesse der Polizei an den Telefondaten auch mit den Bewohnern des besetzten Hauses in der Liebigstraße 14 zu tun hat. Sicher ist, dass die Polizei die Schnüffelei erst stoppte, als das Bundesverfassungsgericht die deutsche Vorratsdatenspeicherung stoppte.
Der Berliner Fall ist ein sprechendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Daten auf Vorrat gespeichert werden: Sind solche Datenbestände erst einmal vorhanden, braucht es nicht viel, um aus nackten Daten einen Verdacht zu kreieren, der völlig Unbeteiligte treffen kann. Da hilft weder, dass ein Richter jede Auswertung genehmigen muss, noch dass eine Abfrage nur bei so genannten "schweren Straftaten" geschehen darf. In diese Kategorie fällt nämlich - anders als oft behauptet - viel mehr als Mord, Vergewaltigung und Terror.
So ist der nun entdeckte Fall auch eine Erinnerung daran, nicht zu vergessen, dass das Ungeheuer "Vorratsdatenspeicherung" höchstens betäubt, aber immer noch nicht tot ist. Erst kürzlich hat Deutschland einen blauen Brief von der Europäischen Union bekommen, weil es nach dem Verfassungsgerichtsurteil kein neues Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass die Vorgaben aus Brüssel umsetzt. Bisher hat Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger jede Forderung dieser Art abgeschmettert. So lange die Leitlinie in der bisherigen Form jedoch weiterbesteht, können die Vorratsdaten-Gegner nicht ruhen. Sonst reicht bald wieder einfach nur ein Telefonat zur falschen Zeit und am falschen Ort, um ins Visier von Ermittlern zu gelangen.