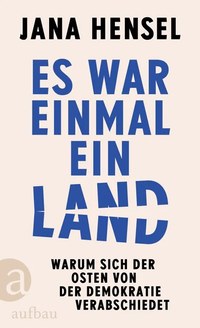Vorwort
Vierzig goldene Jahre? Das ist natürlich übertrieben. Aber für China waren die vier Jahrzehnte von 1979 bis 2019 eine gute Zeit. Sie dürften zu den besten in der chinesischen Geschichte gehören. Kein Krieg, kein Bürgerkrieg, keine Hungersnot. Stattdessen ein wirtschaftlicher Aufschwung, wie ihn das Land nie zuvor gesehen hatte. Die Freiheitsräume im privaten Leben der Menschen wurden größer. Das Land befreite sich aus seiner selbst gewählten Isolation. Bewundernd blickte die Welt auf das Wiedererstarken einer großen, fünftausend Jahre alten Nation.
Mit dem Beginn der Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings Ende 1978 ließ China die wirren gesellschaftlichen Experimente Mao Zedongs hinter sich, deren leidvolle Folgen die Bürger der Volkrepublik im Elend des „Großen Sprungs nach vorn“ und in den Gewaltexzessen der „Großen Proletarischen Kulturrevolution“ ertragen mussten. Es kehrte Ruhe ein im Leben der Menschen. Die Kinder gingen wieder zur Schule. Die Bauern durften ihr eigenes Land bewirtschaften. Privateigentum wurde nicht mehr verteufelt. Im Gegenteil, es galt nun die Devise Deng Xiaopings: „Es ist ruhmvoll, reich zu werden.“ Und viele Chinesen wurden reich, einige sogar sehr reich. Sie kauften sich Wohnungen in Singapur oder Vancouver, schickten ihre Töchter und Söhne auf teure amerikanische Universitäten. Von Venedig bis Paris, überall drängten sich jetzt chinesische Touristen.
Alles andere als goldene Jahre waren es für jene, die politisch anderer Meinung waren als die Machthaber. Sie wurden ausgespäht, verfolgt und mundtot gemacht. Dennoch meldeten sie sich immer wieder zu Wort: auf Wandzeitungen, in literarischen Zeitschriften, bei Demonstrationen. 1989 erfasste eine Demokratiebewegung das ganze Land. Die Menschen versammelten sich friedlich, bis die Armee den Protest in der Nacht zum 4. Juni am Pekinger Platz des Himmlischen Friedens mit einem Blutbad beendete. Ein Trauma, das bis heute nicht weicht.
Schon in den Jahren, die auf das Tiananmen-Massaker folgten, wurde die Überwachung der Bevölkerung immer ausgeklügelter. Die „große chinesische Firewall“ schottete die Bürger vom freien Zugang zum Internet ab. Die Zensur erstickte jede Kritik am Regime. Zwischen der kleinen Freiheit im Privaten und der großen Freiheit in der Politik verlief eine tiefrote Linie. Nur sehr Mutige überschritten sie und zahlten dafür einen hohen Preis.
Und doch, das Leben der vielen, die sich von der Politik fernhielten, besserte sich. Dies war ja der Deal, den die Kommunistische Partei den Bürgern anbot: Haltet den Mund, dann lassen wir euch in Ruhe Geld verdienen. Eine stille Übereinkunft, auf die sich die meisten einließen. Kritik aus dem Ausland fand das Regime zwar lästig, maß ihr aber keine große Bedeutung zu. Die Wirtschaftsführer im Westen, die mit China Geschäfte machen wollten, schauten ohnehin nicht so genau hin. Kein Markt der Welt war verführerischer, alle wollten dabei sein. Den Diebstahl geistigen Eigentums, den erzwungenen Technologietransfer, die Joint Ventures wider Willen nahmen sie hin. Sie konnten es sich nicht leisten, die chinesische Bonanza zu verpassen.
Im vierten Jahrzehnt nach Beginn der Reformen kippte die Stimmung. Der Unmut wuchs über ein China, das die Chancen des liberalen Weltwirtschaftssystems nutzte, aber weiterhin nach den eigenen Regeln spielen wollte. Das sich weigerte, der erhoffte „responsible stakeholder“ zu werden – ein verlässlicher und verantwortungsvoller Mitgestalter der internationalen Ordnung. Diese Kritik war in Europa genauso zu hören wie in Amerika. Aber es brauchte die Skrupellosigkeit eines Donald Trump, um China wegen seiner Regelverstöße gleich den Handelskrieg zu erklären. Mit dem Spürsinn eines Raubtiers sah er die Schwächen des Rivalen und trieb die Volksrepublik vor sich her. Trump drohte mit einer „Entkopplung“ der beiden größten Volkswirtschaften der Welt und tat alles, um ein Vorzeigeunternehmen wie den Technologiekonzern Huawei in den Ruin zu treiben.
Die Europäer waren sich in ihrer Haltung der Volksrepublik gegenüber nicht einig, jedes Land trachtete nach dem eigenen Vorteil. Und die Führung in Peking tat das ihre, um Europa zu spalten. Zugleich einte sie die Europäer mit ihrem Verhalten wieder. Bei einigen Regierungen waren es Pekings leere finanzielle Versprechen, die zu einem Umdenken führten, bei anderen die aggressiven Einkaufstouren chinesischer Investoren, bei fast allen die entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen. Dies alles summierte sich nach Jahren der China-Euphorie zu einer tiefen Desillusionierung.
Als Xi Jinping seine Ämter als Parteichef (2012) und als Staatspräsident (2013) antrat, galt er als Reformer. Welch ein Irrtum. Unter Xi legte Chinas Politik ideologisch den Rückwärtsgang ein. Die KP startete eine Kampagne gegen „westliche Werte“, verschärfte noch einmal die Zensur, stärkte die Staatsbetriebe auf Kosten der Privatunternehmen, unterdrückte die muslimischen Minderheiten, setzte Hongkongs vertraglich zugesicherte Autonomie außer Kraft und drohte Taiwan mit gewaltsamer Wiedervereinigung.
Dann trat von Wuhan aus das Coronavirus seinen tödlichen Weg rund um die Welt an. Peking bekämpfte, nach anfänglichem Vertuschen, die Pandemie mit rücksichtsloser Härte – und war damit erfolgreich. Kaum war das Schlimmste überstanden, erklärte die Regierungspropaganda, der Sieg über das Virus beweise die Überlegenheit des chinesischen Systems. Nur wollte die Welt vom „Modell China“ nichts wissen. Sie fühlte sich vielmehr abgestoßen vom herrischen Auftreten der chinesischen Diplomaten, die sich unter dem Beifall der chauvinistischen Presse daheim in „Wolfskrieger“ verwandelt hatten.
Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sanken auf einen Tiefpunkt. Washingtons Außenminister rief den Westen zu einer „Allianz der Demokratien“ gegen China auf. Daran mochte sich Europa nicht beteiligen. Überhaupt wollte es sich nicht in die Rivalität der beiden Giganten hineinziehen lassen. Von einer wirtschaftlichen „Entkopplung“ hielten die Europäer auch nichts, es wuchs bei ihnen aber der Wunsch, sich aus der allzu großen Abhängigkeit von China zu lösen, nicht nur bei Masken und Medikamenten.
China wiederum schien den Streit regelrecht zu suchen. Ausgerechnet im Jahr der Coronakrise legte sich die Volksrepublik mit der halben Welt an. Die Führung in Peking erpresste Australien mit Embargodrohungen, nahm zwei kanadische Bürger in eine Art Geiselhaft, beschimpfte die Regierungen Schwedens, Tschechiens sowie Großbritanniens, lieferte sich zu allem Überfluss ein Grenzscharmützel mit Indien.
Und wunderte sich, als sich Widerstand regte. Australien, Indien, Japan und die Vereinigten Staaten intensivierten ihre Kooperation in der „Quad“, jenem lockeren Verbund, der vor allem eines verhindern will: eine Vorherrschaft Chinas im Indo-Pazifischen Raum. Japan überlegte, ob es den „Five Eyes“ beitreten sollte, jenem Zusammenschluss fünf angelsächsischer Länder (USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland), die ihre nachrichtendienstlichen Erkenntnisse untereinander austauschen. Sogar die Nato begann sich mit China zu beschäftigen. In Berlin legte die Bundesregierung „Indo-Pazifik-Leitlinien“ vor; die Große Koalition sah in Chinas wachsender Macht eine Gefahr für die Stabilität der Region und plädierte für eine engere Zusammenarbeit mit traditionellen Partnern wie Japan, Indien und Australien.
Es war eine eindrucksvolle Phalanx von Ländern, die Peking gegen sich aufgebracht hatte. Aber die Machthaber in der Volksrepublik blieben gelassen, sie mussten schon ganz andere Herausforderungen bestehen. Und doch waren sie irritiert. Denn in der weltweiten Kritik offenbarte sich Chinas vielleicht größte Schwäche: der Mangel an politischer Anziehungskraft, an soft power. Die Volksrepublik hat wenig Freunde und keine Verbündeten von Gewicht. Wenn China zur zweiten ebenbürtigen Supermacht neben den USA aufsteigen will, dann wird das Land auf diesem Weg ziemlich einsam sein.
Aber hat China diesen Ehrgeiz überhaupt? Will es zu den Vereinigten Staaten aufschließen, gar an ihre Stelle treten? Will es die weltpolitische Verantwortung einer Supermacht tragen? Blickt man auf die Geschichte des Landes, spricht wenig für solche Ambitionen. Nichts lag China in der Vergangenheit ferner, als seine Ordnung anderen Ländern aufzuzwingen oder in fremden Weltgegenden Streit zu schlichten. Das ist heute nicht viel anders. In der friedlichen Entwicklung des eigenen Landes zu auskömmlichem Wohlstand sieht Pekings Führung ihren wichtigsten Beitrag zur internationalen Stabilität.
In Asien und im Westpazifik allerdings soll keine andere Macht den Ton angeben. Hier tritt China als eine Hegemonialmacht auf, die ihre Interessen mit aller Härte durchsetzt. Die Gefahr eines militärischen Konflikts im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan darf deshalb niemand unterschätzen.
Für Europa geht von der Volksrepublik keine militärische Bedrohung aus. Sehr wohl aber ist sie, wie es die Europäische Kommission formuliert hat, ein „systemischer Rivale“. Der autoritäre Staatskapitalismus Chinas lässt sich mit Europas Vorstellungen von freiheitlicher Demokratie und liberaler Marktwirtschaft nicht vereinbaren. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron forderte deshalb zu Recht ein „Ende der Naivität“. Reiner Spaß wird der zu erwartende Drachentanz mit dem Konkurrenten China nicht sein.
Die Arbeit an diesem Buch hat knapp anderthalb Jahre gedauert. Meine journalistische Beschäftigung mit China aber reicht zurück bis zum Beginn der achtziger Jahre. Das Studium der Sinologie hat mich darauf vorbereitet. Meine Professoren Rolf Trauzettel (Göttingen), Daniel Kwok und John DeFrancis (Honolulu) sowie Wolfgang Franke und Liu Mau-Tsai (Hamburg) waren wunderbare Lehrer, denen ich bis heute dankbar bin. Und nie ist das Gespräch über China mit meinem Freund und Lehrer Kuan Yu-Chien abgerissen.
Seit 1983 habe ich in der ZEIT den Wiederaufstieg Chinas beschrieben und kommentiert. Auf vielen Reisen durch das Land war ich Zeuge einer atemberaubenden Erfolgsgeschichte, aber auch dramatischer Rückschläge. Es war ein großes Glück, in all diesen Jahren zum Thema China in der ZEIT-Redaktion zwei eminent kluge und erfahrene Gesprächspartner zu haben: Theo Sommer und Helmut Schmidt. Theo Sommer hat vor zwei Jahren die Summe seines Nachdenkens über China in dem Buch „China First“ vorgelegt, das ebenfalls beim Verlag C.H.Beck erschienen ist. Er hat auch das Manuskript dieses Buches gelesen und mit hilfreichen Anmerkungen versehen. Dafür, und für unsere fortwährende Freundschaft, danke ich ihm sehr.
Ein genauer und aufmerksamer Leser des Manuskripts war auch mein Freund Hans Janus, für dessen Hinweise und Ergänzungen ich sehr dankbar bin. Wir sind einander seit Jahrzehnten in enger Freundschaft verbunden.
Den Anstoß zu diesem Buch hat Detlef Felken gegeben, der Cheflektor von C.H.Beck. Er hat die Arbeit am Manuskript von Beginn an mit seinen Anregungen und kritischen Nachfragen, mit Ansporn und Ermutigung begleitet. Ihm gilt dafür mein großer Dank.
Bettina Spyrou hat auch dieses Manuskript mit liebevoller Sorgfalt betreut. Mit ihr seit vielen Jahren zusammenarbeiten zu dürfen, ist ein Geschenk.
Ohne meine Frau Lisa gäbe es dieses Buch nicht. Sie ist stets meine erste – und kritischste – Leserin. Sie hat mich auf unschätzbare Weise bei der Recherche unterstützt und Tag für Tag geholfen, in der Flut des Materials nicht unterzugehen. Ihr und unseren beiden Kindern Sarah Mie und Stefan Akio ist das Buch gewidmet.
Hamburg, im September 2020
Corona: Heimsuchung und Weltkrise
Ahnungslos, voller Vorfreude brechen im Januar 2020 Abermillionen Chinesen in den Neujahrsurlaub auf. Sie steigen in die Bahn, den Bus, das Flugzeug. Das halbe Land macht sich auf den Weg, um Eltern und Großeltern zu besuchen. Chinesisch-Neujahr ist ein Familienfest wie Weihnachten in Deutschland oder Thanksgiving in Amerika, nur viel wichtiger. Nichts wissen die Reisenden davon, dass viele von ihnen ihr eigenes Heim erst Wochen, ja Monate später wiedersehen werden. Dass sie zurückkehren werden in eine Welt, die nicht mehr dieselbe ist.
Am 23. Januar, zwei Tage vor dem Neujahrsfest, wird die zentralchinesische Stadt Wuhan abgeriegelt, kurz darauf die gesamte Provinz Hubei mit fast 60 Millionen Einwohnern. Rund vierhundert Menschen haben sich zu diesem Zeitpunkt mit einem unbekannten Virus infiziert. Und während die Wissenschaftler noch debattieren, ob das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar sei, hat der Krankheitserreger bereits seinen zerstörerischen Weg rund um den Globus angetreten. Thailand meldet am 13. Januar den ersten Erkrankten. Am 28. Januar wird in Bayern bei einem Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto das neue Virus diagnostiziert. Im Herbst 2020 werden sich auf der Erde mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben, werden über eine Million Menschen an der vom Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben sein.
Die Pandemie verschont kein Land. Sie verändert alles – wie die Menschen arbeiten, wie sie feiern, wie sie an Schulen und Universitäten lernen, wie sie einkaufen, reisen und gemeinsam essen, wie sie einander auf der Straße begegnen und wie sie sich von ihren Toten verabschieden. Regierungen nehmen Unsummen an neuen Schulden auf, um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Dennoch verlieren Millionen ihren Arbeitsplatz, schließen Fabriken, Büros, Restaurants, Hotels und Museen. Flugplätze und Fußballstadien verwaisen. Gläubige müssen auf Abstand gehen, wenn sie gemeinsam in der Kirche beten, und niemand gibt sich zur Begrüßung mehr die Hand. Eine Heimsuchung ohne Beispiel. Wie konnte es dazu kommen? Und wie blickt die Welt auf China, das Land, in dem die Krise ihren Ausgang nahm?
Rekonstruktionen des zeitlichen Ablaufs ergeben, dass der erste Mensch vermutlich im November 2019 an Covid-19 erkrankte („Patient Null“), ein 55 Jahre alter Mann aus der Provinz Hubei. Im Dezember häufen sich die Infektionen in der Nähe des Huanan-Marktes in Wuhan. Dort werden nicht nur Fische und Meeresfrüchte verkauft, sondern auch Schlangen, Gürteltiere, Reptilien und Fledermäuse. Die Ärztin Ai Fen, Leiterin der Notaufnahme in Wuhans Zentralkrankenhaus, berichtet von Patienten mit auffälligen, nicht zu erklärenden Symptomen. Sie wird gezwungen, über das Gesehene zu schweigen. Am 30. Dezember schreibt der Augenarzt Li Wenliang im sozialen Netzwerk WeChat über ein unbekanntes Virus in seiner Klinik. Ein Screenshot seines Posts verbreitet sich rasend schnell. Noch in derselben Nacht wird Li von der Polizei einbestellt. Sie wirft ihm vor, gefährliche „Gerüchte“ verbreitet zu haben, und zwingt ihn, ein Geständnis über sein „illegales Verhalten“ zu unterschreiben. Wenige Tage später erkrankt der Arzt selbst am Coronavirus.
Zum Jahreswechsel hat Chinas Gesundheitsbehörde 27 Krankheitsfälle registriert. Sie informiert das Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Peking. Am 1. Januar wird in Wuhan der Huanan-Markt geschlossen. Auch die Regierung der Vereinigten Staaten wird nun vom Auftauchen des neuen Virus in Kenntnis gesetzt. Nur die eigene Bevölkerung erfährt nichts. Am 7. Januar tagt in Peking das Politbüro. Parteichef Xi Jinping ordnet an, den Kampf gegen das Virus aufzunehmen, um eine drohende Epidemie abzuwenden. Aber erst am 20. Januar wird Xi in einer Rede die Öffentlichkeit informieren. Am selben Tag bestätigt der von vielen Chinesen verehrte Arzt Zhong Nanshan, der 2003 die vom Staat vertuschte Lungenkrankheit Sars publik machte, die Übertragbarkeit des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch.
[...]