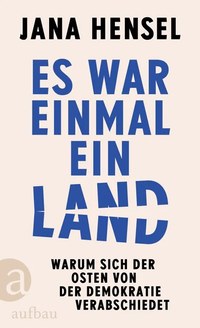»Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst.« – Rosa Luxemburg
1. Stalin
Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet, nicht bis zu dem Tag, als ich Stalin umarmte. Aus der Nähe wirkte er viel größer als erwartet. Unsere Lehrerin Nora hatte uns erzählt, Imperialisten und Revisionisten stellten Stalin gern als kleinen Mann dar, doch tatsächlich sei er nicht so klein gewesen wie Ludwig XIV., über dessen Körpergröße – seltsamerweise – niemand je redete. Jedenfalls, fügte sie ernst hinzu, sei es ein typisch imperialistischer Fehler, sich auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren statt auf das, was wirklich zählt: Stalin war ein Riese und sein Erbe weitaus wichtiger als seine Statur.
Was Stalin so besonders machte, fuhr Nora fort, war seine Fähigkeit, mit den Augen zu lächeln. Ist das zu glauben? Mit den Augen lächeln? Es lag daran, dass sein freundlicher Schnurrbart die Lippen verdeckte, und wer nur auf die Lippen achtete, würde niemals erkennen, ob Stalin gerade lächelte oder etwas anderes tat. Doch es genügte ein Blick in seine Augen – stechend, intelligent und braun – und man wusste Bescheid. Stalin lächelte. Manche Leute schafften es nicht, anderen in die Augen zu sehen. Offensichtlich hatten sie etwas zu verbergen. Stalin hingegen sah einen unverwandt an, und falls ihm danach war und man sich gut benommen hatte, lächelten seine Augen. Meistens trug er einen unscheinbaren Mantel und schlichte braune Schuhe, außerdem schob er sich oft die rechte Hand unters linke Revers, wie um sie sich aufs Herz zu legen. Die andere Hand ließ er oft in der Tasche.
»In der Tasche?«, fragten wir. »Ist es denn nicht unhöflich, mit der Hand in der Tasche herumzulaufen? Die Erwachsenen sagen uns immer, wir sollen die Hände aus den Taschen nehmen.«
»Nun ja«, sagte Nora. »In der Sowjetunion ist es sehr kalt. Außerdem«, fügte sie hinzu, »hatte Napoleon auch immer eine Hand in der Tasche, und da hat keiner behauptet, es wäre unhöflich.«
»Nicht in der Tasche«, sagte ich schüchtern. »In seiner Weste. Zu seiner Zeit galt das als Zeichen für eine gute Erziehung.«
Lehrerin Nora ignorierte mich und wartete auf die nächste Frage.
»Und er war klein«, ergänzte ich. »Woher willst du das wissen?«
»Meine Großmutter hat es mir erzählt.« »Was genau hat sie gesagt?«
»Sie hat gesagt, Napoleon war klein, aber als Marx’ Lehrer Hangel, oder Hegel, ich weiß es nicht mehr, ihn gesehen hat, sagte er, man könnte den Weltgeist auf einem Pferd stehen sehen.«
»Hangel«, korrigierte sie mich. »Und Hangel hatte recht. Napoleon hat Europa verändert. Er war ein Wegbereiter der Aufklärung und ein großer Mann. Aber nicht so groß wie Stalin. Hätte Marx’ Lehrer Hangel Stalin dort stehen sehen, natürlich nicht auf einem Pferd, aber vielleicht auf einem Panzer, hätte er ebenfalls vom Weltgeist gesprochen. Stalin war eine wichtige Inspiration für viele Menschen, nicht nur in Europa, sondern auch für Millionen unserer Brüder und Schwestern in Asien und Afrika.«
»Hat Stalin Kinder geliebt?«, fragten wir.
»Natürlich!«
»Mehr als Lenin?«
»Ungefähr genauso sehr, aber seine Feinde haben immerversucht, das zu verheimlichen. Sie wollten Stalin schlechter als Lenin aussehen lassen, weil er stärker und für sie viel, viel gefährlicher war. Lenin hat Russland verändert, Stalin die ganze Welt. Aus diesem Grund wurde die Tatsache, dass Stalin Kinder ebenso sehr geliebt hat wie Lenin, nie offiziell festgestellt.«
»Hat Stalin Kinder so geliebt wie Onkel Enver?«
Lehrerin Nora zögerte.
»Noch mehr?«
»Ihr wisst die Antwort«, sagte sie mit einem warmen Lächeln.
Vielleicht hat Stalin Kinder geliebt. Wahrscheinlich haben die Kinder Stalin geliebt. Absolut fest steht nur, dass ich ihn nie mehr liebte als an jenem nassen Dezembernachmittag, als ich vom Hafen zu dem kleinen Park am Kulturpalast rannte. Ich schwitzte und zitterte und mein Herz klopfte so wild, dass ich fürchtete, es könnte mir aus dem Mund springen. Zwei Kilometer war ich gerannt, so schnell ich konnte, und dann hatte ich den kleinen Park entdeckt, und als Stalin am Horizont erschien, wusste ich, ich war in Sicherheit. Er stand dort so feierlich wie immer mit seinem unscheinbaren Mantel, den schlichten Bronzeschuhen und der rechten Hand unterm Revers, als hielte er sich das Herz. Ich blieb stehen, vergewisserte mich, dass niemand mir gefolgt war, und trat näher heran. Sobald ich die Wange an Stalins Oberschenkel legte und versuchte, seine Knie vollständig zu umarmen, wurde ich unsichtbar. Ich atmete tief durch, kniff die Augen zu und zählte. Eins. Zwei.
Drei. Als ich bei siebenunddreißig angekommen war, hörte ich die Hunde nicht mehr bellen. Das donnernde Stampfen von Stiefeln auf Asphalt war ein fernes Echo. Nur die Rufe der Demonstranten hallten noch vereinzelt herüber: »Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie.«
Als ich mich ganz sicher fühlte, ließ ich Stalin los. Ich setzte mich auf den Boden und nahm ihn genauer in Augenschein. Auf seinen Schuhen trockneten die letzten Regentropfen, die Farbe des Mantels war verblasst. Stalin war genauso, wie Lehrerin Nora ihn beschrieben hatte: ein Bronzeriese mit unerwartet großen Händen und Füßen. Ich legte den Kopf in den Nacken, um zu sehen, ob sein Schnurrbart tatsächlich die Oberlippe verdeckte und er mit den Augen lächelte. Aber da war kein Lächeln. Keine Augen, keine Lippen, nicht einmal ein Schnurrbart. Die Hooligans hatten Stalins Kopf gestohlen.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund und unterdrückte einen Schrei. Stalin, der Bronzeriese mit dem freundlichen Schnurrbart, der schon im Garten des Kulturpalastes gestanden hatte, als ich noch nicht einmal geboren war – geköpft? Stalin, über den Hangel gesagt hätte, er wäre der Weltgeist auf einem Panzer? Warum? Was wollten sie? Warum riefen sie »Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie«? Was sollte das bedeuten?
Über Freiheit hatte ich nie viel nachgedacht. Warum auch, wir hatten jede Menge Freiheiten. Ich fühlte mich so frei, dass mir die Freiheit manchmal wie eine Bürde erschien und gelegentlich, an Tagen wie diesem, sogar wie eine Bedrohung.
Ich hatte nicht in die Demonstration geraten wollen. Ich wusste ja kaum, was eine Demonstration war. Nur wenige Stunden zuvor hatte ich vor dem Schultor im Regen gestanden und mich gefragt, auf welchem Weg ich nach Hause gehen sollte: linksherum, rechtsherum oder geradeaus. Es stand mir frei, mich zu entscheiden. Jede Route warf andere Fragen auf, es galt, Gründe und Konsequenzen abzuwägen, die möglichen Folgen zu bedenken und eine Entscheidung zu treffen, von der ich wusste, dass ich sie am Ende vielleicht bereuen würde.
So wie an diesem Tag. Ich hatte frei entschieden, auf welchem Weg ich nach Hause gehen würde, und die falsche Wahl getroffen. Nach der letzten Stunde hatten wir Klassendienst. Beim Putzen wechselten wir uns in Vierergruppen ab, aber meistens erfanden die Jungen irgendeine Ausrede und ließen die Mädchen allein zurück. Ich hatte mir die Schicht mit meiner Freundin Elona geteilt. An normalen Tagen verließen Elona und ich nach dem Klassendienst die Schule und gingen bei der alten Frau vorbei, die an der nächsten Straßenecke auf dem Bürgersteig saß und Sonnenblumenkerne verkaufte. »Können wir mal probieren? Sind die mit Salz oder ohne? Geröstet oder nicht?«, fragten wir. Die Frau öffnete einen der drei mitgebrachten Säcke – einer für geröstet und gesalzen, einer für geröstet und ungesalzen, der dritte für ungeröstet und ungesalzen –, und wir durften uns aus jedem ein paar Kerne nehmen. An Tagen mit etwas Kleingeld hatten wir die große Auswahl.
Anschließend bogen wir nach links ab und gingen zu Elona. Unterwegs kauten wir Sonnenblumenkerne, und an der Tür mühten wir uns mit dem rostigen alten Schlüssel ab, den Elona an einer Halskette ihrer Mutter unter der Schuluniform trug. Einmal in der Wohnung, mussten wir uns für ein Spiel entscheiden. Im Dezember war das ganz einfach, denn zu der Zeit begann der nationale Liederwettbewerb. Wir dachten uns eigene Lieder aus und stellten uns vor, wir würden im Fernsehen auftreten. Ich schrieb die Texte, Elona war die Sängerin. Manchmal begleitete ich sie am Schlagzeug, was bedeutete, dass ich in der Küche mit einem großen Holzlöffel auf die Töpfe eindrosch. Aber in letzter Zeit hatte Elona das Interesse am Liederwettbewerb verloren. Sie wollte lieber Braut-und-Baby spielen. Statt in der Küche auf Töpfen zu trommeln, wollte sie im Elternschlafzimmer die Haarspangen ihrer Mutter ausprobieren, deren altes Brautkleid anziehen oder ihr Make-up auftragen und so tun, als würde sie die Puppen stillen, bis es Zeit fürs Mittagessen war. An diesem Punkt musste ich entscheiden, ob wir weiterspielen – was Elonas Wunsch war – oder ob ich sie dazu überrede, uns Rührei zu machen, oder ob wir, falls keine Eier im Haus waren, Brot mit Öl essen oder einfach nur Brot. Aber das waren vergleichsweise banale Entscheidungen.
Das wahre Dilemma offenbarte sich nach dem Streit, den Elona und ich an dem Tag gehabt hatten. Es ging um den Klassendienst. Elona wollte das Klassenzimmer fegen und wischen, denn andernfalls würden wir den Wimpel für die besten Putzkräfte des Monats, auf den ihre Mutter immer sehr erpicht gewesen war, nie bekommen. Ich entgegnete, dass wir eigentlich an ungeraden Tagen fegen und nur an den geraden fegen und wischen sollten, und weil heute ein ungerader Tag war, könnten wir früher nach Hause gehen und würden den Wimpel trotzdem bekommen. Elona sagte, dies sei nicht das, was die Lehrerin von uns erwarte, und erinnerte mich daran, dass meine Eltern wegen meiner schlampigen Putzarbeit ja schon einmal in die Schule zitiert worden seien. Ich sagte, da irre sie sich; der wahre Grund sei der Kontrolltrupp vom Montagmorgen gewesen, der meine Fingernägel für zu lang befunden habe. Sie erwiderte, das sei egal; so oder so bestehe die richtige Methode darin, den Klassenraum zu fegen und zu wischen, und wenn wir den Wimpel am Monatsende trotzdem bekämen, würde es sich anfühlen wie Schummeln. Außerdem, sagte sie, als sei die Diskussion damit beendet, putze sie zu Hause auf diese Weise, denn so habe ihre Mutter es immer gemacht. Ich erklärte Elona, dass sie nicht einfach jederzeit ihre Mutter ins Spiel bringen könne, nur um ihren Willen durchzusetzen, und stürmte wütend hinaus. Als ich vor dem Schultor im Regen stand, fragte ich mich, ob Elona möglicherweise erwarten durfte, von allen nett und freundlich behandelt zu werden, selbst wenn sie im Unrecht war. Ich überlegte, ob ich nicht besser so getan hätte, als liebte ich es, zu fegen und zu wischen, so wie ich ja auch vorgab, furchtbar gerne Braut-und-Baby zu spielen.
Ich hatte es ihr nie erzählt, aber eigentlich hasste ich das Spiel. Ich hasste es, im Schlafzimmer ihrer Eltern zu stehen und das Brautkleid ihrer Mutter anzuziehen. Das Kleid einer Toten zu tragen und die Schminke zu benutzen, die sie noch vor wenigen Monaten selbst benutzt hatte, machte mich fassungslos. Aber alles war noch ganz frisch, und Elona hatte sich sehr auf ihre kleine Schwester gefreut, die später mit meinem kleinen Bruder spielen sollte. Stattdessen war ihre Mutter gestorben, die Schwester im Waisenhaus und nur das Brautkleid noch da. Ich wollte Elona nicht verletzen, indem ich mich weigerte, es zu tragen, oder indem ich ihr sagte, wie sehr ich mich vor den alten Haarspangen ekelte. Natürlich stand es mir frei, ihr meine ehrliche Meinung zu Braut-und-Baby zu sagen, so wie es mir freigestanden hatte, sie das Klassenzimmer allein wischen zu lassen; niemand hielt mich auf. Ich kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, Elona mit der sie möglicherweise verletzenden Wahrheit zu konfrontieren, anstatt sie bis in alle Ewigkeit anzulügen, nur um sie bei Laune zu halten.
Nun, da ich nicht nach links zu Elona ging, hätte ich nach rechts gehen können, das wäre der kürzeste Weg nach Hause gewesen. Er führte durch zwei schmale Gassen, die auf der Höhe einer Keksfabrik von der Hauptstraße abzweigten. An dieser Stelle tat sich ein neues Dilemma auf. Weil der Betrieb täglich von einem Lastwagen angesteuert wurde, der die Erzeugnisse auslieferte, versammelte sich dort nach Schulschluss eine beträchtliche Anzahl von Kindern. Wählte ich diesen Weg, würde ich mich der von uns so genannten »Keksaktion« anschließen müssen. Ich würde mit den anderen Kindern eine Schlange bilden, die sich an der Außenmauer des Betriebs entlangzog, mit ihnen aufgeregt die Ankunft des Lasters erwarten, die Ausgänge im Blick behalten und auf potenziell störenden Durchgangsverkehr achten, etwa auf Radfahrer oder auch Pferdefuhrwerke. Irgendwann würde sich die Tür des Betriebs öffnen und zwei Transportarbeiter würden heraustreten, die Kisten voller Kekse schleppten, wie zwei Atlasse, beladen mit dem Gewicht der Welt. In dem Moment würde es zu einem kleinen Aufruhr kommen, alle würden losstürzen und rufen: »Geizig, geizig, Kekse her, du Geizkragen!« Die Warteschlange aus schwarz uniformierten Kindern würde sich dann spontan aufteilen in eine Vorhut, die mit den Armen fuchtelt und versucht, sich an die Beine der Fahrer zu klammern, und in eine Nachhut, die zum Werktor ausschwärmt und die Ausfahrt blockiert. Die Arbeiter würden mit hektischen Bewegungen hüftabwärts versuchen, die Kinder abzuschütteln, während sie ihre obere Körperhälfte anspannen würden, um die Kisten noch fester im Griff zu haben. Eine Schachtel würde herunterrutschen, ein Handgemenge würde entstehen und irgendwann würde jemand von der Betriebsleitung aus dem Inneren des Gebäudes auftauchen, mit so vielen Keksen, wie es brauchte, um alle zufriedenzustellen und die Versammlung aufzulösen.
Es stand mir also frei, nach rechts zu gehen oder geradeaus, und wenn ich mich für rechts entschied, konnte ich damit rechnen, dass genau das eben Geschilderte geschieht. Es war alles ganz harmlos, und es wäre widersinnig, wenn nicht gar unfair, von einer Elfjährigen, die nicht auf der Suche nach etwas Süßem, sondern einfach nur auf dem Heimweg war, zu verlangen, den köstlichen Keksduft, der aus den geöffneten Fenstern des Backbetriebs strömte, auszublenden und einfach stur weiterzugehen. Ebenso widersinnig wäre es, von ihr zu verlangen, die schiefen, fragenden Blicke der anderen Kinder zu ignorieren und Desinteresse an der Ankunft des Lasters vorzuschützen. Und doch hatten meine Eltern am Vorabend dieses elenden Tages im Dezember 1990 genau das von mir verlangt, und so hing die Wahl des Nachhausewegs direkt mit der Freiheitsfrage zusammen.
In gewisser Weise war es meine Schuld. Niemals hätte ich so triumphierend mit den Keksen nach Hause kommen dürfen. Dann wiederum war es auch die Schuld der neuen Betriebsleiterin. Sie hatte erst vor Kurzem dort angefangen, war mit den Sitten des neuen Arbeitsumfelds noch nicht vertraut und hatte die Kinderversammlung an diesem Tag für ein einmaliges Ereignis gehalten. Statt wie alle ihre Vorgänger jedem Kind einen Keks zu geben, hatte sie ganze Schachteln ausgeteilt. Aufgeschreckt durch die Veränderung und das, was sie für zukünftige »Keksaktionen« vielleicht bedeutete, hatten wir unsere Beute, statt sie auf der Stelle zu essen, in unsere Schulranzen gesteckt und waren weggelaufen.
Ich gebe zu, ich hatte nicht mit dem Theater gerechnet, das meine Eltern veranstalteten, als ich ihnen die Kekse zeigte und erklärte, wie ich sie bekommen hatte. Ihre erste Frage verblüffte mich besonders: »Hat dich irgendjemand gesehen?« Selbstverständlich hatte mich jemand gesehen, nicht zuletzt die Person, die uns die Kekse gegeben hatte. Nein, ich konnte mich nicht genau an ihr Gesicht erinnern. Ja, sie war mittleren Alters. Weder groß noch klein, eher mittel. Dunkles, gewelltes Haar. Breites, herzliches Lächeln. Als ich das sagte, wurde mein Vater blass. Er stand aus seinem Lehnstuhl auf, beide Hände am Kopf. Meine Mutter verließ das Wohnzimmer und bedeutete ihm, ihr in die Küche zu folgen. Meine Großmutter strich mir wortlos übers Haar, und mein kleiner Bruder, dem ich einen Extrakeks geschenkt hatte, hörte auf zu kauen, setzte sich in die Ecke und fing vor lauter Anspannung an zu weinen.
Ich musste versprechen, mich nie wieder vor der Keksbäckerei herumzutreiben oder mich in die Warteschlange an der Hauswand einzureihen, außerdem musste ich versichern, dass ich verstanden hatte, wie wichtig es war, die Arbeiter ihre Arbeit machen zu lassen; denn wenn alle sich so verhielten wie ich, würde es in den Geschäften bald keine Kekse mehr geben. GE-GEN-SEI-TIG-KEIT, schärfte mein Vater mir ein. Der Sozialismus beruhe auf Gegenseitigkeit.
Als ich das Versprechen gab, war mir bereits klar, wie schwer es zu halten sein würde. Oder vielleicht auch nicht – wer weiß das schon? Jedenfalls musste ich mein Bestes geben. Dass ich an dem Tag geradeaus gegangen bin statt nach rechts oder zurück, um Elona nach dem Klassendienst abzuholen und Brautund-Baby zu spielen, dass ich entschieden habe, die Kekse zu ignorieren, kann ich auf niemanden abwälzen. Das waren alles meine Entscheidungen. Ich hatte mein Bestes gegeben und war trotzdem zur falschen Zeit am falschen Ort gelandet, und nun hatte diese ganze Freiheit mir nichts gebracht als die blanke Angst, die Hunde könnten zurückkehren und mich in Stücke reißen oder ich könnte von einer Menschenmenge zertrampelt werden.
Natürlich hatte ich nicht ahnen können, dass ich in eine Demonstration geraten oder dass Stalin mir Zuflucht bieten würde. Wenn ich nicht kurz zuvor im Fernsehen die Bilder von Unruhen in anderen Städten gesehen hätte, wäre mir nicht einmal klar gewesen, dass das seltsame Spektakel aus Leuten, die Slogans skandieren, und Polizisten, die Hunde mit sich führen, »Demonstration« genannt wird. Wenige Monate zuvor, im Juli 1990, hatten Dutzende Albaner die Mauern einiger ausländischer Botschaften überwunden und sich gewaltsam Zutritt verschafft. Ich begriff nicht, wozu man sich in einer fremden Botschaft verschanzen sollte. In der Schule sprachen wir darüber, und Elona erzählte von einer sechsköpfigen Familie, zwei Brüdern und vier Schwestern, die sich als ausländische Touristen verkleidet in die italienische Botschaft in Tirana eingeschlichen hatten. Fünf Jahre lang lebten sie dort – fünf ganze Jahre – in zwei Zimmern. Dann bereiste ein weiterer Tourist unser Land, dieses Mal ein echter namens Javier Pérez de Cuéllar. Er sprach mit den Botschaftskletterern und übermittelte ihren Wunsch, in Italien zu leben, an die Partei.
Elonas Geschichte faszinierte mich. Ich fragte meinen Vater danach. »Das sind Uligans«, sagte er, »so hieß es zumindest im Fernsehen.« Hooligans, fügte er an, sei ein Fremdwort, für das es keine albanische Übersetzung gebe. Wir brauchten keine. Hooligans waren zumeist wütende junge Männer, die zu Fußballspielen gingen, sich betranken und Ärger machten. Sie prügelten sich mit den Fans der gegnerischen Mannschaft und verbrannten Flaggen ohne jeden Grund. Sie lebten größtenteils im Westen, kamen aber auch vereinzelt im Osten vor; aber weil wir weder zum Westen noch zum Osten gehörten, gab es sie in Albanien nicht. Bis vor Kurzem.
Noch während ich versuchte, meine Eindrücke zu verarbeiten, fielen mir die Hooligans ein. Ganz offensichtlich hätte ein Hooligan kein Problem damit, über Botschaftsmauern zu klettern, Polizisten anzubrüllen, die öffentliche Ordnung zu stören oder Statuen zu enthaupten. Im Westen gingen die Hooligans anscheinend ähnlich vor; vielleicht hatten sie sich bei uns eingeschlichen, um einfach Ärger zu machen. Die Leute, die vor ein paar Monaten über die Mauer geklettert waren, waren jedoch eindeutig keine Ausländer. Was also hatten diese verschiedenen Sorten von Hooligans gemeinsam?
Ich erinnerte mich vage an irgendwelche Demonstrationen, die ein Jahr zuvor an der Berliner Mauer stattgefunden hatten. Wir hatten darüber in der Schule gesprochen, und Lehrerin Nora hatte erklärt, sie hingen mit dem Kampf zwischen Imperialismus und Revisionismus zusammen, und wie sie sich gegenseitig einen Spiegel vorhielten, wobei beide Spiegel kaputt waren. Nichts davon gehe uns etwas an. Unsere Feinde versuchten regelmäßig, die Regierung zu stürzen, und ebenso regelmäßig scheiterten sie. Ende der Vierzigerjahre hatten wir uns von Jugoslawien losgesagt, weil es mit Stalin gebrochen hatte. Als Chruschtschow in den Sechzigerjahren Stalins Erbe entehrte und uns »linksnationalistisches Abweichlertum« vorwarf, kappten wir die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion. In den späten Siebzigern kündigten wir unsere Allianz mit China auf, weil es beschlossen hatte, reich zu werden und die Kulturrevolution zu verraten. Uns kümmerte es nicht. Wir waren von mächtigen Feinden umzingelt, aber wir wussten, wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte. Wann immer unsere Feinde uns bedrohten, ging die Partei, vom Volk unterstützt, noch stärker daraus hervor. Im Laufe der Jahrhunderte hatten wir gegen gewaltige Reiche gekämpft und dem Rest der Welt bewiesen, dass selbst eine winzige Nation am Rand des Balkans die Kraft zum Widerstand aufbringen konnte. Und nun führten wir den schwierigsten aller Umbrüche an: von der sozialistischen zur kommunistischen Freiheit, vom revolutionären, durch gerechte Gesetze geregelten Staat zur klassenlosen Gesellschaft, in der der Staat allmählich absterben würde.
Natürlich hatte die Freiheit ihren Preis, erklärte Lehrerin Nora. Immerzu hatten wir die Freiheit allein verteidigt, und nun war es an ihnen, den Preis zu zahlen. Sie trudelten ins Chaos, wir hingegen blieben standhaft. Wir würden weiterhin als gutes Beispiel vorangehen. Wir besaßen weder Waffen noch Geld, doch wir trotzten dem Sirenengesang des revisionistischen Ostens genauso wie dem des imperialistischen Westens; unsere Existenz schenkte all jenen kleinen Staaten, auf deren Würde nach wie vor herumgetrampelt wurde, neue Hoffnung. An die Ehre, in einer gerechten Gesellschaft zu leben, reichte höchstens unsere Dankbarkeit heran, vor dem Horror geschützt zu sein, der sich in anderen Teilen der Welt entfaltete, an Orten, wo Kinder verhungerten, in der Kälte erfroren oder zur Arbeit gezwungen wurden.
»Seht ihr diese Hand?«, hatte Nora gefragt und mit strenger Miene ihre Rechte in die Höhe gehoben. »Diese Hand wird immer stark sein. Diese Hand wird immer kämpfen. Und wisst ihr, warum? Weil sie Genosse Envers Hand geschüttelt hat. Nach dem Parteitag habe ich sie tagelang nicht gewaschen! Und selbst danach war seine Kraft noch spürbar. Sie wird mich nie verlassen, niemals, bis ich sterbe.«
Ich dachte an Lehrerin Noras Hand und an das, was sie erst vor ein paar Monaten zu uns gesagt hatte. Ich saß immer noch vor Stalins Bronzestatue auf dem Boden und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, meinen Mut zusammenzunehmen, aufzustehen und nach Hause zu gehen. Ich wollte mich an jedes ihrer Worte erinnern und ihren Stolz und ihre Stärke heraufbeschwören, als sie uns gesagt hatte, sie werde die Freiheit immer verteidigen, weil sie Onkel Envers Hand geschüttelt hatte.
Ich wollte sein wie sie. Auch ich muss meine Freiheit verteidigen, dachte ich. Auch ich muss meine Angst überwinden. Ich hatte nie Onkel Envers Hand geschüttelt. Ich hatte ihn nie getroffen. Aber vielleicht reichten Stalins Beine aus, um mir Kraft zu geben.
Ich stand auf und versuchte, zu denken wie meine Lehrerin. Wir lebten im Sozialismus. Der Sozialismus schenkte uns Freiheit. Die Demonstranten waren auf dem Holzweg. Niemand war auf der Suche nach Freiheit. Alle waren längst schon frei, so wie ich, sie übten diese Freiheit einfach aus oder verteidigten sie oder trafen Entscheidungen, zu denen sie stehen mussten, beispielsweise über den Nachhauseweg und ob man nach rechts, nach links oder geradeaus geht. Vielleicht waren sie, so wie ich, Richtung Hafen geirrt und hatten sich zur falschen Zeit am falschen Ort wiedergefunden. Vielleicht hatten sie beim Anblick der Polizisten und der Hunde einfach nur große Angst bekommen, was vielleicht ebenso für die Polizisten und die Hunde galt; auch sie hatten sich gefürchtet, besonders als sie die Menschen losstürmen sahen. Möglicherweise jagten beide Seiten einander, ohne genau zu wissen, wer hinter wem her war, und nur deshalb hatten die Leute angefangen, »Freiheit, Demokratie« zu rufen, aus Angst und aus Unsicherheit, um auf das hinzuweisen, was sie nicht verlieren wollten, und nicht auf das, was ihnen bislang fehlte.
Und vielleicht hatte Stalins Kopf nichts mit alldem zu tun. Vielleicht war er am Vortag durch den Sturm und den Regen beschädigt worden und jemand hatte ihn bereits abgeholt, um ihn zu reparieren und schon bald runderneuert zurückzubringen, mit den blitzenden, lächelnden Augen und dem dicken, freundlichen Schnurrbart, der die Oberlippe verdeckte, genauso, wie man ihn mir beschrieben hatte und wie er immer gewesen war.
Ich umarmte Stalin ein letztes Mal, drehte mich um, fixierte den Horizont und versuchte, die Entfernung zu meinem Zuhause einzuschätzen. Dann holte ich tief Luft und rannte los.