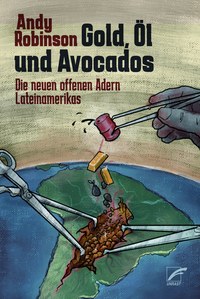QUINOA
(Uyuni, Bolivien)
Aufstieg und Fall des Wunderkorns
Über die Gemeinde San Agustín war die überraschende Nachricht von Morales’ plötzlichem Rücktritt und seiner Flucht nach Mexiko im November 2019 wie ein Strom Lava aus dem Vulkan Ollagüe (5.868 Meter hoch) hereingebrochen, der im Westen am Horizont aufragte. Der Ort liegt eine Stunde Fahrt durch die Atacama-Wüste von der chilenischen Grenze entfernt. Der Gemeinderat fürchtete um seine sozialen Projekte in einer Region, die sich wie alle ländlichen Gebiete dank der Entwicklungsprojekte der Regierung Morales und der Transferleistungen zur Bekämpfung der Armut verändert hatte. Ihre Hauptsorge war jedoch die Zukunft einer neuen Verarbeitungsanlage für Quinoa, in die der Staat vier Millionen Bolivianos investiert hatte, eine halbe Million Euro. »Wir denken, dass die Anlage nicht gefährdet ist, weil wir schon fast die gesamte Finanzierung haben, aber man kann sich im Moment bei nichts sicher sein«, sagte mir Emilio Muraña Huanca, der Leiter der Abteilung für Wirtschaft der kleinen Gemeinde, die mitten in einer der wichtigsten Produktionszonen von Quinoa in Bolivien lag. »Quinoa ist unsere große Herausforderung«, meinte der Bürgermeister Juan Tomás Catur, in einem Spanisch mit der im Quechua typischen Aussprache der Vokale. »Könnten Sie uns helfen, Käufer zu finden?« Es sollte noch erwähnt werden, dass es in San Agustín nicht um irgendeine Quinoa ging, sondern um die Quinoa Real, das Nonplusultra der Quinoa, die weltweit teuerste Sorte des Korns.
Quinoa war zu Beginn des 21. Jahrhunderts schwer in Mode gekommen, zumindest bei den Mittelschichten der entwickelten Länder, in denen Millionen Menschen wegen Allergien gegen Gluten ihre Ernährung umstellten. Wie die Avocado wurde Quinoa wegen ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften zu einem begehrten Superfood. Sie enthält doppelt so viel Eiweiß wie Reis oder Gerste und ist eine ausgezeichnete Quelle für Kalzium, Magnesium, Phosphor, Kalium und Natrium sowie für die Vitamine B und E. Und sie enthält überhaupt kein Gluten.
Für die Konsument*innen der reichen Länder, die gegen den globalisierten Kapitalismus des Big Food rebellierten (gegen die Giganten der Lebensmittelindustrie wie Nestlé, Unilever, Cargill oder McDonald’s), war das Korn der Quechua sogar noch attraktiver als Avocados. Im Lauf der Zeit wurde immer klarer, dass diese Lebensmittelindustrie den Planeten und die Gesundheit seiner Bewohner*innen zerstörte. Quinoa war dagegen, zusammen mit der Kartoffel, das wichtigste Subsistenz-Nahrungsmittel der bäuerlichen Quechua und Aymara auf dem Altiplano der Anden. Es war eines der grundlegenden Lebensmittel, welche die demografische Ausbreitung der großen präkolumbianischen Zivilisationen in den Anden ermöglicht hatten. Als ab 2005 die indigenen Bewegungen in Bolivien und Ecuador an die Macht kamen, wurde das widerstandsfähige Korn zu einem Nahrungsmittel, das nicht nur körperliche Gesundheit versprach, sondern auch ein kulturelles oder vielleicht auch politisches Statement war.
Die Explosion der internationalen Nachfrage nach Quinoa pflanzte in der Quechua-Bevölkerung der ländlichen Gemeinden im Süden von Potosí einen Samen der Hoffnung, und sie fiel mit den ersten euphorischen Jahren von Morales zusammen. Die extremen klimatischen Bedingungen auf 4.000 Metern über dem Meeresspiegel waren für den Anbau des Superfoods bestens geeignet. Temperaturen von null Grad in der Nacht und einundzwanzig Grad am Tag waren eine Herausforderung für das Überleben. Diese Bedingungen sollen die genetische Zusammensetzung des Korns in einem darwinistischen Prozess gestärkt haben. Hinzu kamen die ausgeklügelten landwirtschaftlichen Techniken Tausender Generationen indigener Bäuerinnen und Bauern. Die trockene Hitze und die Intensität der Sonnenstrahlung trugen ebenfalls dazu bei, dass Quinoa zu einem Superfood wurde. Die vulkanische Erde sorgte für einen nährstoffhaltigen Dünger. Einige Wissenschaftler*innen erklärten, dass die Quinoa Real aufgrund der Nähe zum Salar eine stärkere Sorte mit einer anderen Art von Fotosynthese sei. »Auf dem Salar de Uyuni wächst fast nichts, aber ein paar Kilometer weiter haben wir einen Boden und ein Mikroklima, die für die Quinoa Real außerordentlich gut sind«, erklärte mir Hugo Bautista, Quechua, Agronom und eine Autorität in Sachen Salar. Wir fuhren in seinem Jeep nach San Agustín, über eine Landstraße, die an einigen Stellen von Herden weißer Lamas blockiert war. Das Tal der Hochwüste war saisonal überflutet, und es waren rosafarbene Punkte zu sehen – die Andenflamingos, die sich von den Mikroben im Salzwasser ernährten. Das Land war Gemeinschaftseigentum der Quechua, und die Lamas weideten frei. Jahrhunderte alte indigene Institutionen – eine Parallelverwaltung neben dem Gemeinderat und der Verwaltung des Departements Potosí – legten die Abmessungen der Parzellen für den Quinoa-Anbau der Quechuaund Aymara-Familien nach deren jeweiligen Bedürfnissen fest. »In zwei Monaten, wenn es an die Ernte geht, wird das alles farbig sein: rot, violett, ocker, rosa«, sagte Bautista und zeigte auf sein Land der Vulkane. »Es ist ein einzigartiges Fleckchen Erde; es gibt keinen anderen Ort der Welt, der eine Quinoa Real wie unsere hervorbringt.«
Wie alles, was mit der indigenen Kultur zu tun hatte, war auch die Quinoa, selbst die Quinoa Real, in der Vergangenheit von einem großen Teil der bolivianischen Bevölkerung und sogar von Indigenen selbst als minderwertig angesehen worden. Sie wurde als »Essen für Arme« oder noch schlimmer als das »Essen der Indios« bezeichnet. Aber im neuen Jahrhundert der indigenen Revolutionen in Bolivien, Ecuador und in geringerem Ausmaß in Peru, zwischen 2000 und 2005, hatte sich die Wahrnehmung der Quinoa auf spektakuläre Weise geändert. Wie üblich wurde sie zuerst in den angesagten Restaurants in Europa und den USA eingeführt und verbreitete sich dann in Bioläden und den Gourmet-Abteilungen der globalen Supermärkte, bis sie schließlich auch bei den Mittelschichten der Andenländer ankam. In Bolivien begannen die Indigenen, insbesondere die Aymara in El Alto, der auf 4.000 Meter Höhe über La Paz gelegenen Stadt, zum ersten Mal in der 500-jährigen Geschichte des Landes ein gewisses kulturelles Selbstwertgefühl zu entwickeln. Dieses fand seinen Ausdruck in dem mehr oder weniger großen Erfolg der Luxus-Polleras (Röcke) bei den Modeschauen und in der postmodernen Cholet-Architektur – ein Neologismus aus der Verbindung von Chalet und Cholo, der Bezeichnung für Indigene und Mestizen. Für die neue Aymara-Handelsbourgeoisie wurden vierstöckige Rokoko-Gebäude errichtet.
Nachdem das Superfood auf den Frühstückstischen in New York, Barcelona oder London in Mode gekommen war, führte der Quinoa-Boom bald zu wirtschaftlichen Auswirkungen in den bäuerlichen Gemeinden von San Agustín und in der Umgebung. Der Quinoa-Preis stieg von 40 US-Dollar pro Quintal (45 Kilogramm) 2005 auf 350 US-Dollar pro Quintal 2013, eine Steigerung von 800 Prozent. In diesem Jahr organisierten Evo und sein damaliger Amtskollege in der Präsidentschaft von Peru, Ollanta Humala, mit einer globalen Marketing-Kampagne das Internationale Quinoa-Jahr. Es wurde ein grandioser Erfolg. Die weltweiten Exporte stiegen in den folgenden fünf Jahren auf das Siebenfache.
Dass Evo auf Quinoa setzte, hatte jedoch seine Vorund Nachteile. Genau genommen war dies eine der beiden Seiten der schizophrenen Entwicklungspolitik, mit der Morales wie auch die anderen Regierungen der progressiven Welle in Lateinamerika die Pacha Mama mit dem globalen Rohstoffmarkt in Einklang bringen wollten. Während er versuchte, den kleinen Produzent*innen des tausendjährigen Korns der Quechua und Aymara zu helfen, war der Präsident gleichzeitig dem Beispiel von Lula und Dilma jenseits der Grenze in Brasilien gefolgt. Auch er hatte eine Allianz mit der agroindustriellen Oligarchie geschlossen, vor allem mit den Viehzuchtund Soja-Großbetrieben in Santa Cruz und dem tropischen Tiefland im Osten des Landes. Für den Wald in der Savannenregion Chiquitania sollten die Folgen ähnlich katastrophal sein, wie sie es für den Cerrado in Brasilien waren. In der Trockenzeit des Jahres 2019 vernichteten Tausende Waldbrände 15.000 Quadratkilometer Wald im Osten von Bolivien, wo die Viehzüchter mit Feuer rodeten. Und wie in Brasilien kam nach den Ochsen die Soja. »Die Regierung hat das Programm des Agrobusiness umgesetzt, das wir begraben wollten«, erklärte Solón, der die ersten Programme des Sumak Kawsay, des ›Guten Lebens‹ entworfen hatte, die auf einem neuen Entwicklungsmodell mit Alternativen zum Bergbau und zur Export-Agrarindustrie beruhten. An der Spitze einer Koalition, zu der Indigene, Koka-Bäuer*innen, städtische Arbeiter*innen, Bergarbeiter und Student*innen gehörten, übernahm Morales das Programm für die Wahlen von 2006 und fuhr einen spektakulären Sieg ein. Aber das Gute Leben sollte nicht einmal zwei Jahre dauern. Seine Freundschaft mit Pablo Solón ebenso wenig.
Ich traf mich mit Solón im bescheidenen Büro seiner Stiftung im Zentrum von La Paz, eine Woche nach dem Staatsstreich gegen Morales – den Pablo nicht als Staatsstreich ansah, vielleicht, weil der Hass von alten Kampfgefährten besonders tief sitzt. »Unser ursprüngliches Projekt, das sich an der Philosophie des Guten Lebens orientierte, war der Ausstieg aus dem Extraktivismus«, erklärte er. »Wir bewegten uns in Richtung eines Industrialisierungsprozesses, der die Mutter Erde respektiert. Wir wollten aus der Logik ausbrechen, ein Land zu sein, das nur Rohstoffe exportiert, und das haben wir in unser Programm von 2006 aufgenommen.« Doch bald nach dem Wahlsieg von Evo und Solón kam es zum ersten Putschversuch, der in Santa Cruz ausgeheckt wurde, und zur versuchten Abspaltung des sogenannten Halbmondes, der Region im Osten. Dies war von der agroindustriellen Oligarchie geplant worden – mit Unterstützung der kroatischen Rechtsextremen und ihres Verbündeten, des ›Macho Camacho‹. Morales gelang es, das Komplott zum Scheitern zu bringen, und er konnte sich sogar vor einem Mordanschlag retten. Aber ab diesem Moment »kam es in der Politik von Evo zu einem grundlegenden Wandel«, fuhr Solón fort. »Er machte sich keine Gedanken mehr über die Umsetzung des Guten Lebens, sondern begann darüber nachzudenken, wie er sich an der Macht halten könne. Und an der Macht bleiben bedeutete, zu einer Vereinbarung mit den Agrarindustriellen von Santa Cruz zu kommen.«
Um sich mit der Oligarchie des Halbmondes gut zu stellen, musste der Präsident eine Reihe von Gesetzen und Dekreten zugunsten der Agrarindustrie verabschieden. Als erstes erlaubte er den weiteren Anbau genveränderter Soja. Danach die Agrarkraftstoffe. Danach die Ausweitung der Monokulturen in Richtung Brasilien. Und dieser Modus Operandi »bedeutete, dass mehr als 5.000 Hektar brandgerodet wurden für Viehzucht, Soja und Zuckerrohr für Ethanol«, meinte Solón. Morales tat dies, um die Wachstumsrate von fünf Prozent halten und damit seine Programme zur Eindämmung der Armut weiterführen zu können. Aber wie es auch bei Lula und Dilma der Fall gewesen war, verlor er durch diese Entscheidung an Unterstützung vonseiten im Umweltschutz engagierter Linker wie Solón.
»All die Einkünfte, die im Export-Boom mit dem Gas erzielt wurden, sind nicht genutzt worden, um den Produktionsapparat umzubauen und die Ökonomie zu diversifizieren. Investiert wurde in politische Maßnahmen, die Wahlstimmen bringen konnten, wie Fußballplätze in Dörfern, das Asphaltieren von Straßen und die Verteilung von Unterstützungszahlungen (Bonos) als Hilfe für die Ärmsten«, erläuterte Solón. »Und als es 2014 zur Krise kommt und der Gaspreis fällt, versucht Evo, den Fehler des Gas-Extraktivismus durch andere Extraktivismen zu kompensieren: Bergbau, Wasserkraft sowie agroindustrielle Produktion und Viehzucht.«
Quinoa war der Beweis, dass Evo trotz seines Versuchs, einen Modus Vivendi mit der Oligarchie von Santa Cruz zu finden, keineswegs die Bäuer*innen des Altiplano und die Pacha Mama vergessen hatte. Dahinter stand die Idee, den Ratschlägen der FAO, der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, zu folgen, bäuerliche Lebensmittel auf den internationalen Markt zu bringen und damit einen Ausweg aus der Armut zu ermöglichen, ohne die traditionelle Kultur zu zerstören. Aber sobald man sich einmal auf den globalen Markt der Commodities begibt, lassen sich die Folgen nur schwer unter Kontrolle halten. Das haben wir bereits in anderen Kapiteln gesehen. Mit derartig hohen Preisen sprang alle Welt auf den Quinoa-Karren auf. Quinoa wurde in Europa und den USA angebaut, und auch das Nachbarland Peru ließ sich von dem neuen Fieber des begehrtesten Korns des Planeten anstecken. In nur einem Jahr stieg die Produktion in Peru von 44.000 auf 114.000 Tonnen. Der größte Teil der Zunahme fand jedoch nicht auf dem peruanischen Altiplano statt, wo die Indigenen wie in Potosí seit Jahrtausenden das Superkorn anbauten. Es waren die großen Agrarunternehmen an der peruanischen Küste, die vor allem in der Gegend von Arequipa auf Tausenden von Hektar Land Quinoa anpflanzten. Mithilfe von Pestiziden und Dünger schafften sie es, mit zwei Ernten pro Jahr Erträge zu erzielen, die für die Quechua der Anden unvorstellbar waren. In einem Rausch der Überproduktion, den Eduardo Galeano mit beißender Ironie beschrieben hätte, stürzten die Quinoa-Preise nach ihrem Höhenflug ins Bodenlose. Der Preis eines Quintals sollte bald wieder bei den vierzig US-Dollar von vor dem Boom liegen. Wie im Fall der Tourist*innen auf dem Salar de Uyuni drohte die weltweite Suche nach authentischer Erfahrung und einem Vorgeschmack auf das Sumak Kawsay der Quechua das Objekt der Begierde zu zerstören.
Der Ausflug des Quinoa-Preises in die Stratosphäre und seine Rückkehr hatten heftige Auswirkungen auf die bäuerlichen Gemeinschaften in San Agustín. »2016 stieg der Preis für einen Quintal auf bis zu 2.400 Bolivianos, das war eine gute Nachricht. Plötzlich fiel er und dann stieg er wieder; jetzt liegt er bei 750 Bolivianos (etwa hundert US-Dollar)«, sagte der Bürgermeister. »Das bedeutet etwa 50 Bolivianos für die Produzent*innen.« Die Volatilität des Preises war also nur ein Teil des Problems. Die Quechua-Bäuer*innen, die mit ihren Jahrtausende alten Anbautechniken die Quinoa zu einem Superlebensmittel gemacht hatten, bekamen nur sieben von den hundert US-Dollar, die auf dem internationalen Markt gezahlt wurden. Unabhängig davon, in welcher Phase sich der Preiszyklus gerade befand. Der Ton des Bürgermeisters wurde immer verzweifelter: »Wir werden einen Betrieb haben, um die Quinoa zu waschen, und wir wollen industrialisieren, Kekse herstellen. Aber unsere Sorge ist, dass es dafür keinen Markt gibt.«
In einer nahe gelegenen Schule wurden von jungen Quechua-Student*innen und Start-Ups entworfene Snacks auf Quinoa-Basis ausgestellt, von denen einige weitaus attraktiver waren als eine Tüte Kartoffelchips. »Dies ist ein Labor. Wir haben den ersten Abschluss für industrielle Lebensmitteltransformation eingeführt, mit Lebensmitteln, die wir in unserer Region produzieren«, verkündete Professor Jorge Quispe, während die jungen Quinoa-Kreativen danebenstanden. »Wir haben Köstlichkeiten aus roter, weißer und schwarzer Quinoa, Kekse, Kuchen und Energieriegel. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Chemie.« Aber auch sie machten sich Sorgen, wie sie die Produktion hochfahren und mit dem neuen globalen Quinoa-Snack-Geschäft konkurrieren könnten – mit der neuen Linie von Quinoa-Chips mit Knoblauch von PepsiCo Lay’s zum Beispiel.
Aber damit nicht genug. Die Region des Salar de Uyuni in Potosí hatte es auch nicht geschafft, sich auf den Märkten der reichen Länder als Kornkammer der Quinoa Real, die nur in bestimmten Gebieten der Hochebene produziert wird, zu etablieren. Bei Whole Foods Market in New York und den Genossenschaften in Barcelona wussten die Käufer*innen nicht, woher die dort angebotene Quinoa stammte. »Die Leute kaufen süße Quinoa als sei es Quinoa Real«, sagte Hugo Bautista. »Wir haben es nicht geschafft, den Unterschied klarzumachen.« Es war noch nicht einmal gelungen, die Exporteure zu verpflichten, die Ware mit dem Etikett ›Product of Bolivia‹ zu versehen.
Bautista hatte auf eigene Faust versucht, eine Herkunftsbescheinigung einzuführen. Aber »statt uns zu unterstützen hat die Regierung uns Steine in den Weg gelegt. Sie sagten, sie könnten uns mit der Bescheinigung helfen, wenn wir auch Oruro, wo der Präsident geboren wurde, mit draufschreiben würden.« Die Herkunftsbescheinigung war nicht möglich ohne die Empfehlung der Andengemeinschaft (Comunidad Andina de Naciones). Dafür hätte der Antrag vom Staat, vom bolivianischen Außenministerium gestellt werden müssen. »Statt eine Entscheidung zur Unterstützung der Quinoa Real zu treffen, wurde politisch entschieden. Wie immer umgab sich Evo Morales mit Leuten, die nur an Politik und nicht an technische Strategien dachten; deshalb ist er gestürzt«, war sein Resümee.
Wie Pablo Solón war auch Hugo einer der Vielen, die von Morales’ Projekt enttäuscht waren. Aber es war nicht schwer, das Dilemma von Evo zu verstehen. Die Ausweitung der Bescheinigung auf die Produzent*innen von Oruro hätte dazu beigetragen, mehr kleine Produzent*innen vor der Konkurrenz des peruanischen Agrobusiness zu schützen. Schließlich kam die Hälfte der bolivianischen QuinoaProduktion nicht aus der Region Potosí. Darüber hinaus gingen die Meinungen in der Wissenschaft auseinander. Einige glaubten, dass die Quinoa Real des Salar de Uyuni anders sei, dass sie mehr Eiweiß und gesundheitsfördernde Eigenschaften habe, während andere Expert*innen keinen Unterschied zwischen der süßen Quinoa und der Quinoa Real sahen.
Dass Morales im Osten auf den Export von Sojabohnen und agroindustriellen Produkten setzte, basierte wie im Falle Brasiliens auf der Notwendigkeit, jene ausgezeichneten Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, die Bolivien in den Jahren der Höchstpreise im Superzyklus verzeichnet hatte. Das Modell, durch den Abbau von Rohstoffen an Devisen zu kommen und die Erträge dann umzuverteilen, hatte die extreme Armut (mit einem Einkommen von weniger als einem US-Dollar pro Tag) von 39 auf 15 Prozent der Bevölkerung gesenkt. Als Luis Arce sich mit der MAS erneut bereit machte, die Macht zu übernehmen, und Evo nach seinem einjährigen Exil in Mexiko und Argentinien nach Bolivien zurückkehrte, ging die Debatte weiter. Wenn wir jedoch den spektakulären Horizont jenseits der Quinoa-Felder, der Lamaherden und der Flamingos betrachteten, schien uns die schwierige Wahl zwischen einer Politik des Wachstums oder des Umweltschutzes viel leichter zu sein. Die riesigen Vulkane standen wie gräuliche Dreiecke vor dem blauen Himmel über dem Salar. Aus einigen stieg eine weiße Rauchfahne auf, ein Zeichen, dass sie aktiv waren. Aber auf keinem lag Schnee. »Vor zehn Jahren hätte zu dieser Jahreszeit jeder eine Schneeschicht gehabt. Jetzt nicht mehr«, sagte Hugo. Wie in Puno und Apurímac waren die Debatten der Linken über Entwicklungsmodelle angesichts des Klimawandels ein unnötiger Luxus.
Die im September gesäten Quinoapflanzen ragten bereits mit ihren dicken grünen Blättern aus der Erde. Aber viele waren durchlöchert. »Wir haben eine Falterplage. Es sieht so aus, als sei alles gut, aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, hast du nach zwei Tagen wegen dieser Falter alles verloren«, klagte Jorge Bautista Huanca, ein Quechua-Bauer, der seine zwei Hektar große Parzelle mit der Hand pflügte. Die Motten hatten mehrere Ernten vernichtet. »Früher war das nicht so. Das passiert, weil die Temperaturen gestiegen sind.« Neben der Hitze und der Wasserknappheit war die Unvorhersehbarkeit des Wetters ein Problem. Auf die einzigartigen klimatischen Bedingungen des Altiplano von Potosí, von denen Hugo gesprochen hatte, war kein Verlass mehr. »Es kann diese Woche regnen und nächste Woche Winterwetter sein, niemand weiß das. Früher war das vorhersehbar, man wusste, wann es frieren konnte, aber jetzt ist das nicht mehr so«, sagte Jorge, dessen Gesicht eine stoische Ruhe ausstrahlte, so widerstandsfähig wie die Quinoa. Aber das, was sich hier anbahnte, würde auch er nicht aushalten. »Im Januar und Februar brauchen wir Regen, im März oder April können wir ihn nicht brauchen. Aber das Wetter hat sich verändert und ein Frost zerstört alles, wenn er zu spät kommt.«
Zurück in La Paz wollte ich ein paar der neuen Quinoa-Gerichte der Haute Cuisine kosten, im Restaurant Gustu des großen dänischen Küchenchefs Claus Meyer, im wohlhabenden Süden der Stadt. Meyer, Besitzer des Restaurants Noma (zwei Michelin-Sterne) in Kopenhagen, war einer der ersten Förderer der Quinoa Real vom Salar de Uyuni. Er war überzeugt, dass die Spitzengastronomie die Gemeinschaften der Kleinbäuer*innen unterstützen müsse. Das war zu Beginn des Jahrhunderts, und mit der kulinarischen Empfehlung von Restaurants wie dem Noma begann der Höhenflug des andinen Korns. Als ich dort zu Abend aß, gab es auf der Karte des Gustu jedoch kein einziges Quinoa-Gericht. »Wir führen keine Quinoa mehr, weil sie ein Produkt ist, das in Bolivien und auf der ganzen Welt bereits überall verwendet und in Massenproduktion hergestellt wird«, erklärte mir Marsia Taha, die bolivianische Chefköchin des Gustu. »Bolivien ist nicht mehr das Land mit der höchsten Quinoa-Produktion. Peru auch nicht. Die großen Produzenten sitzen in den USA und Europa. Von daher wollen wir andere Körner des Altiplano fördern, die nicht so bekannt sind. Alles konzentriert sich auf Quinoa, aber es gibt zehn oder fünfzehn weitere Körner in den Anden«, fügte sie hinzu. Es schien ein mutiger Gegenangriff auf die globale Monokultur und den modeabhängigen Geschmack zu sein. Aber das Gustu hat nur sechs oder sieben Tische.