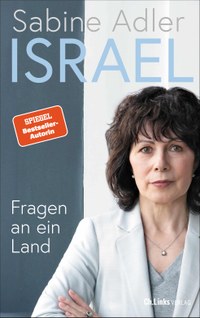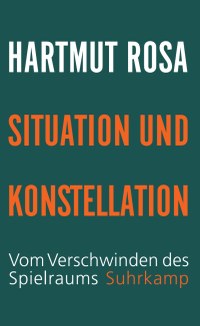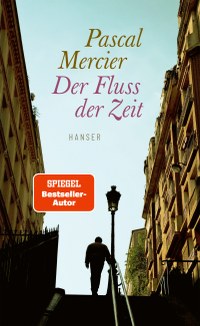Dies ist unser Land
Ist ein Zusammenleben noch möglich?
Mit säuselnder Stimme preist die Angestellte der Leihwagenfirma am Flughafen Ben-Gurion ein sensationelles Upgrade an. Sie zeigt auf einen nagelneuen SUV. Als ich dankend ablehne und lieber bei einem leicht lädierten Kleinwagen bleibe, ist sie pikiert. Die Kratzer und Beulen sind genau richtig, denn in Israel kann man nichts weniger gebrauchen als ein makellos lackiertes Auto, das wie ein Magnet sämtliche zwei- und vierrädrigen Fahrzeuge anzieht, die einem urplötzlich aus allen Himmelsrichtungen in die Quere kommen können.
Mein erster Weg führt mich gleich nach der Ankunft nach Jerusalem. Auf der notorisch verstopften Autobahn fährt heute kaum jemand, denn es ist Samstagnachmittag. Ich bin zum Schabbat bei Ruth Goldman eingeladen, die mich gern mit »my very good friend« begrüßt. Sie geht inzwischen auf die 98 zu. Freundinnen wurden wir vor 15 Jahren. Wenn sie aus ihrem wechselvollen Leben erzählte, tat sie das so anschaulich, dass ich ihr stundenlang zuhören konnte und immer mehr wissen wollte. Um zu verstehen, wie sie weiterleben konnte nach ihrer Zeit in Auschwitz, Kinder bekommen, ein Medizinstudium beginnen, und es schaffte, eine Praxis als Ärztin zu eröffnen. Bis heute imponiert mir ihr Wille, an ihrem Traum festzuhalten und ihn sich zu erfüllen. Wie sehr sich das für sie lohnte, wird an ihrem langen Arbeitsleben deutlich. Noch mit über 90 besuchte sie Patienten, wann immer sie jemand um Rat bat. In Rente zu gehen, wäre ihr niemals eingefallen. Mit mir aber sprach sie hauptsächlich über die Schoah.
Ruth hatte jede Menge Fragen an mich, die Deutsche. Und ich stellte fest, dass ich viele nicht beantworten konnte, mein Wissen nicht annähernd an ihres heranreichte. Sie machte mir wegen des Verhaltens der überwiegenden Mehrheit der Deutschen während des Nationalsozialismus niemals Vorwürfe, weil sie es ablehnte, Individuen mit Gruppen gleichzusetzen. Sie trieb das Verbrechen der Nazis um, Juden zu töten, nur, weil sie Juden waren. Sie verstand es nicht. Waren die Deutschen doch eine Nation gewesen, die Ruths Eltern, wie viele andere Juden auch, für ihre Kultur und Lebensart bewundert hatten. Wenn sie die Erinnerungen quälten, rief Ruth mich mitunter an. Oft begannen solche Telefonate mit der Aufforderung: »Tell me, why …«. Sie erzählte mir ihre Albträume und von dunklen Stunden. Wir vertrauten einander auch in sehr privaten Dingen. Immer erkundigte sich Ruth nach meiner Familie, den Eltern, die zu jung waren, um Täter gewesen zu sein. Sie vergaß keinen Namen meiner Nächsten. Obwohl uns Jahrzehnte trennten, standen wir uns nah. Über die schreckliche gemeinsame Geschichte hinweg, die uns letztlich verband.
Wenn wir uns trafen, setzten wir unsere Gespräche dort fort, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Einfach nur geplaudert haben wir sehr selten. Ruth und Plaudern, das schloss sich aus. Ich kann mich nur an wenige Gelegenheiten erinnern, bei denen sie über ihre Liebe zu Hunden sprach. Meine Schwärmerei für Pferde war nur einmal Thema. Reiten sei doch genau genommen gar kein Sport, der Mensch würde schließlich nur im Sattel sitzen und das Tier sei die ganze Zeit in Bewegung, sagte sie, sah mich an und prustete los.
Obwohl Ruth oft und ausführlich über ihre Zeit in Auschwitz sprach, erfuhr ich immer neue Details aus ihrer Schreckenszeit dort. Meist waren es Begebenheiten, die die Güte und Sorge der Menschen um sie herum beschrieben. Oder aber die Kälte und Grausamkeit von Deutschen, so schenke ihr einmal ein Aufseher in einem Außenlager, in dem sie monatelang Zwangsarbeit verrichten mussten, mit gönnerhafter Geste zwei rohe Kartoffeln. Ob und wo sie die hätte kochen können, war ihm egal. Dass sie später ein entspannteres Verhältnis zu Deutschland hatte, lag vor allem an dem Bekenntnis der Bundesrepublik, Israel zur Seite zu stehen. Diese Solidarität empfand sie zu keinem Moment als Selbstverständlichkeit.
In ihrem letzten Lebensjahr wurden unsere Telefonate kürzer, aber immer endeten sie mit ihrer Bitte, nach Israel zu kommen, sie zu besuchen. Wie oft hatten wir uns am Telefon ausgemalt, was wir zusammen unternehmen würden. In die Hafenstadt Eilat ans Rote Meer wollten wir fahren, um zu beobachten, wie dort im Frühjahr Unmengen von Störchen, Flamingos, Pelikanen, Greif- und Singvögeln nach ihrem langen Flug über den afrikanischen Kontinent Rast machen. Oder in die Wüste Negev, wo sie mir ein hochmodernes Schulungszentrum für Soldaten zeigen wollte. Weil Ruth oft vor Armeeeinheiten über den Holocaust gesprochen hatte, kannte sie einige Offiziere, die ihr den Neubau in der Wüste gern gezeigt hätten. Doch ab Frühjahr 2024 war daran nicht mehr zu denken. Ruths Fuß hatte sich so stark entzündet, dass sie ins Krankenhaus musste. Ihrer Meinung nach eine Lappalie. Sie hasste es, sich in die Hände von Ärzten begeben zu müssen, obwohl sie doch selbst Medizinerin war. Doch sie lag falsch.
Als sie nach Hause zurückkehren konnte, schränkte sich ihr Bewegungsradius beträchtlich ein. Während unserer immer noch regelmäßigen Telefonate sprach sie nie über das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023. Und über den inzwischen eskalierten Krieg nur am Rande. Könnten die Ereignisse sie retraumatisiert haben? Oder ließ sie sie nicht mehr an sich heran? Bei meinem Besuch freut sie sich anfangs riesig über das Wiedersehen. Im Laufe des Schabbatnachmittags spricht sie mich mit meinem Nachnamen an, als würden wir uns nur flüchtig kennen. Ihre Tochter Dorit, die mit ihrem Mann Jehuda und Sohn Ilan das Wochenende bei Ruth verbringt, hatte mich gewarnt. Ihre Mutter würde mitunter Realität und Träume vermischen, nicht mehr wissen, in welcher Zeit sie sich gerade befindet. Mitunter nickt Ruth ein. Als sie einmal aus einem kurzen Schlaf hochschreckt, besteht sie darauf, sich für den Besuch umzuziehen. Dabei trägt sie bereits ein hübsches Sommerkleid. Weil alles Zureden umsonst ist, fährt Dorit sie mit dem Rollstuhl ins Schlafzimmer und hilft ihr beim Aus- und Ankleiden.
Ilan, der Enkelsohn, den sie ganz besonders ins Herz geschlossen hat, erzählt mir währenddessen, wie froh er ist, die Geschichte seiner Großmutter bis ins letzte Detail zu kennen, weil er sie gefühlt tausend Mal gehört hat. Denn wenn sie jetzt Episoden daraus erzählt und ins Stocken gerät, kann er ihr weiterhelfen. Dann fühlt sie sich verstanden, und die Traurigkeit über die nachlassende Erinnerungsfähigkeit verschwindet. Als hätte sie mit dem Kleid auch die Stimmung gewechselt, sitzt Ruth nach dem Umziehen munter im Rollstuhl und strahlt, als Ilan vorschlägt, Musik zu hören. Dass die jüdischen Folkloretitel auf seinem Handy angeklickt werden können, geht nur, weil ich als nichtjüdischer Gast das Gerät bedienen darf. Bis Sonnenuntergang dauert es noch einige Stunden und solange ist die Nutzung von Telefonen, Elektrizität, ja sogar Büchern oder Schreibutensilien verboten. Eine Einschränkung, die für mich, trotz der Anwesenheit der Gläubigen, nicht gilt.
Ilan, Ende 20, gibt zu, dass es guttut, regelmäßig für mehr als 24 Stunden nicht erreichbar zu sein und ganz im Hier und Heute zu leben. Aber je weiter es auf den Sonnenuntergang zugeht, desto hibbeliger wird er. Immer häufiger blickt er auf die Wohnzimmeruhr, vergleicht sie mit der im jüdischen Kalender genannten Zeit für das Schabbat-Ende und schaltet das Telefon pünktlich auf die Minute wieder an. Rosi, die Pflegerin, klingelt an der Wohnungstür, denn nun übernimmt sie wieder die Versorgung. Ruth, vom Besuch erschöpft, will nur noch schlafen. Unsere Verabschiedung fällt kurz aus. Was sage ich einer Freundin, die ich wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen werde, die es so, wie sie früher war, leider schon nicht mehr gibt? Darf man zeigen, dass man schon jetzt trauert? Auf keinen Fall! Ich wünsche ihr ein letztes Mal gute Nacht.
Auch Dorit und Jehuda machen sich auf den Heimweg, ohne Ilan, denn der ist mit einem seiner Cousins verabredet. Er hat eine Menge davon. Es ist aber nicht Avi, mit dem ich mich am nächsten Tag treffe. Avi lebt im Westjordanland, wo jüdische und palästinensische Ortschaften dicht an dicht liegen. Ich habe mich sehr genau erkundigt, wo man seinen Fuß hineinsetzen darf, bevor es zu spät ist. Unser Treffpunkt ist Newe Daniel. Dass sich die Tore zu der 1982 gegründeten Siedlung wie von Zauberhand öffnen, ohne dass ich das Auto stoppen müsste, verdanke ich Abraham, der von allen aber nur Avi genannt wird, und der mich beim Wachdienst angekündigt hat, wo er nun wartet. Mit seinem Cowboy-Hut, dem dichten schwarzen Vollbart und der Waffe am Gürtel wirkt der junge Mann wie einem Western entsprungen. Sein amerikanisches Englisch tut ein Übriges. Avi ist zwar nicht in den USA geboren, aber seine Mutter Sarah, die ältere Tochter von Ruth, und auch sein Vater Levi.
Weil Newe Daniel fast 1000 Meter über dem Meer liegt, bläst hier oft ein kräftiger Wind – im Sommer eine Wohltat, im Winter fegt er die Straßen leer, an vielen Tagen traut sich dann kaum jemand vor die Haustür. Und obwohl das Dorf die allermeisten Siedlungen ringsum überragt, gibt es eine zweistöckige Aussichtsplattform, von der man weit in die Landschaft bis ans Mittelmeer blicken kann. Auch nach Bethlehem und Jerusalem mit dem Ölberg, den Hochhäusern und der weiß flimmernden Altstadt. Schon, wer sich in grauen Vorzeiten zu Fuß dorthin auf den Weg machte, kam hier entlang, überquerte Newe Daniel, damals nur ein Berggipfel. Pilger zogen durch diese Gegend, womit Avi bei seinem Thema ist.
Aus seinem Rucksack holt der 30-Jährige einen Stapel laminierter Karten. Alle zeigen das gleiche Stück Land: Judäa und Samaria, wie er und die meisten israelischen Siedler das Westjordanland nennen. Schauplatz einer Jahrtausende alten Geschichte. Avi beginnt bei Abraham, seinem Namensvetter, dem Urvater der Juden, und dessen Sohn Isaak, den er Gott opfern soll. Wo, auf welchem der Berge, werde Gott ihn wissen lassen. Abraham soll aus Be’er Scheva in der Negev-Wüste gekommen und in Richtung Jerusalem unterwegs gewesen sein. »Wir wissen, dass dies schon seit Ewigkeiten eine Hauptverkehrsstraße ist. Hier sind unsere Vorväter Abraham, Isaak und Jakob gewandert. Die ganze jüdische Geschichte hat sich auf diesen Hügeln und Bergen abgespielt, nicht dort unten in Tel Aviv oder im Norden von Israel.«
Zeugnisse der alten Verkehrsverbindung sind bis heute erhalten gebliebene Meilensteine aus der römischen Zeit. Wir stehen vor Stein Nummer zehn. Die anderen, Nummer neun bis 13 wurden entsprechend weiter entfernt gefunden. Avi hält eine Geschichtsstunde zum Anfassen. Wir verlassen die Schotterstraße und machen uns zu Fuß auf den Weg zu einem rund 2000 Jahre alten Mikwe-Bad, ein Beweis jüdischen Lebens in diesem Landstrich. Von diesen Tauchbecken für rituelle Bäder gibt es hier einige. Um sie herum haben Archäologen Tonscherben gefunden, die ebenfalls rund 2000 Jahre alt sein sollen. »Das bedeutet, dass die Pilger auf ihrem Weg in dieser Gegend Halt gemacht haben«, schlussfolgert Avi und erklärt weiter: »In den jüdischen Büchern, im Talmud, steht, dass man sich vor dem Betreten des Tempels reinigen muss, indem man ein rituelles Bad nimmt.« Es soll einen Streit unter den Rabbinern gegeben haben, wann und wo genau solch ein Bad genommen werden musste. Eine Version lautet: sobald man auf seinem Weg nach Jerusalem die Stadt zum ersten Mal sieht. »Also genau hier«, sagt Avi. Unter der Anhöhe, von der aus man erkennt, wie breit sich die Stadt in der Ferne inzwischen gemacht hat, öffnet sich eine kleine Höhle. Darin befindet sich ein viereckiges Becken mit Wasser. Unter der Oberfläche zeichnen sich mehrere Stufen ab. Über sie könnte man bis in die Mitte steigen. Die Stufen sind ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine der vielen Zisternen und auch nicht um eine Tränke oder einen Brunnen handeln kann, sondern um den Einstieg in eine Wanne aus Stein. Gefüllt wird sie ausschließlich mit Regenwasser, das vom Hang hineinläuft. »Nur in unserer Religion gibt es rituelle Bäder – ein Beleg dafür, dass dies unser Land ist.«
So geschichtsträchtig der Grund und Boden von Newe Daniel auch ist, so kurz ist die Geschichte dieses Ortes als Siedlung. Sie beginnt 1982 mit einigen Containern, die Juden aus Israel, Osteuropa, Frankreich, Kanada und den USA hier aufstellten. Inzwischen leben 400 Familien in geräumigen Häusern, umgeben von Gittern wie in einem Hochsicherheitsgefängnis.
Die Sperranlangen und die breiten asphaltierten Straßen stören Avi, weshalb er mit seiner Familie in eine Siedlung etwas entfernt gezogen ist. Nahe an der Natur, mit ungeteerten Wegen, improvisierten Häusern. Und ohne Zäune, was er wichtig findet, weil Gitter einen in falscher Sicherheit wiegen würden. Man schaue nur noch nach innen und würde die Gefahr von außen übersehen. Dies sei eine der Lehren aus den Hamas-Überfällen am 7. Oktober 2023. Eine andere, dass sie bei Raketenangriffen besonders wachsam sein müssten.
In den ersten Nächten nach dem 7. Oktober haben Avi und seine Nachbarn die Geschosse aus Gaza losfliegen sehen, bevor sie bei ihnen in den Bergen einschlugen. Doch die Männer gingen nicht mehr in den Schutzraum, sondern verteilten sich mit ihren Gewehren rund um ihr Dorf. Denn die Terroristen konnten auch deshalb vielerorts ungehindert angreifen, ohne auf Gegenwehr zu stoßen, weil alle Menschen in den Bunkern saßen. Seither gehen Wachdienst und Soldaten auf Streife und stellen sicher, dass niemand einen Raketenangriff ausnutzt, um in die Gemeinde zu gelangen. Auch ein halbes Jahr später, am 13. April 2024, als der Iran seine Raketen und Drohnen schickte, waren die Männer nachts draußen unterwegs. Sie glaubten ihren Ohren nicht zu trauen, als sie während des Angriffs Freudenschreie aus den umliegenden arabischen Gemeinden hörten. Avi sucht auf seinem Handy zwei Videos von Ramallah und Nablus, die ähnliches dokumentieren. »Einige Raketen schlugen tatsächlich in palästinensischen Gemeinden ein. Aber sie johlten vor Freude, dass Raketen auf den jüdischen Staat niedergehen.«
Als wir zu Avis Siedlung fahren, müssen wir auf der Schotterpiste stoppen. Ein Tor versperrt den Weg, das es vor dem 7. Oktober noch nicht gegeben hat. Ebenso wie das Wachhäuschen und die vielen Kameras, die seitdem jeden Winkel der Gemeinde ins Visier nehmen. Ein Container dient als Sicherheitszentrum, der Zutritt ist beschränkt. Immer zwei Personen behalten rund um die Uhr die zahlreichen Bildschirme hier im Auge. Das Geld für das Equipment kam von Spendern aus den USA. Einen Zaun wollen die Einwohner immer noch nicht bauen. Lieber organisieren sie im Schichtdienst Patrouillen, bei denen sie anfangs von 20 Reservisten der israelischen Armee unterstützt wurden. Jetzt sind es noch fünf. Zu ihnen gehört auch Avi, den die Armee nach dem 7. Oktober immer wieder für Reservistendienste verpflichtete.
Nichts von der technischen Hochrüstung fällt in dieser idyllischen Landschaft ins Auge. Es ist still. Die Straßen und Dörfer, die man im Tal erkennen kann, sehen friedlich aus. Wir begegnen vier Teenagern, Jungen von der Jeschiwa-Religionsschule in der Nähe, die in einer der Quellen in den Bergen baden waren. Überall gibt es natürliche Wasserlöcher, in die sich die Bewohner der Gegend an einem Seil hinunterlassen, um sich abzukühlen. Manchmal müssen sie auch mit den Zisternen für die Schafe vorliebnehmen.
Newe Daniel und etliche benachbarte Orte sind nach internationalem Recht illegale Siedlungen. Den Anfang machen meist Schiffscontainer, die einzelne Personen, eine Familie oder eine Gruppe auf einen Hügel setzen lassen. Dann wird der Grund und Boden für sich reklamiert. Laut Satzung erklären die teils religiösen, teils säkularen jüdischen Bewohner, dass sie mit ihren arabischen Nachbarn in Frieden leben und Gewalt vermeiden wollen. Einige betreiben ökologischen Landbau – auf palästinensischer Erde. Der frühere israelische Ministerpräsident Ehud Olmert bezeichnete solche Außenposten als eine Schande, weil sie der Roadmap zum Frieden mit den Palästinensern im Weg standen. Deshalb ordnete er nach seinem Amtsantritt im Jahr 2006 ihre Zerstörung an. Die Siedler wehrten sich oftmals heftig. So sehr, dass es mitunter der Armee nur gelang, ein kleines Haus oder einen Stall abzureißen. Hunderte von israelischen Demonstranten hinderten die Soldaten daran, ganze Siedlungen zu zerstören. Seit diesen frühen Protesten besitzen die Bewohner Waffen.
Anfang 2023 beschloss das von Benjamin Netanjahu geführte Kabinett die Legalisierung von neun Außenposten. 2025 waren es 22 weitere, mehr als je zuvor auf einmal. Doch damit die Entscheidungen Bestand haben, muss die Regierung nachweisen, dass sie auf einer Fläche errichtet wurden, die Israel als Staatsland betrachtet. Wenn die Außenposten auf privatem palästinensischem Boden errichtet wurden, ist es wahrscheinlich, dass der Oberste Gerichtshof die Legalisierung nicht anerkennt. Dann steht ein jahrelanges Tauziehen bevor. Die Netanjahu-Regierung möchte solche ausufernden Verfahren mit einer Reihe von Gesetzentwürfen abkürzen, die den Gerichten verwehren sollen, diese Kabinettsbeschlüsse aufzuheben. Einer der Gründe, warum sie so hartnäckig auf der vollständigen Umsetzung ihrer geplanten Justizreform besteht. Die Regierungskoalition, in der die Hardliner das Sagen haben, hatte bei ihrer Gründung erklärt, dass »das jüdische Volk ein ausschließliches und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel« hat, einschließlich des Westjordanlands. Während die internationale Gemeinschaft alle Siedlungen als illegal betrachtet, unterscheidet Israel zwischen Siedlungshäusern, die vom Verteidigungsministerium auf staatseigenem Land gebaut und genehmigt wurden, und illegalen Außenposten, die ohne die erforderlichen Genehmigungen errichtet wurden, oft auf privatem palästinensischem Land. Allerdings werden Außenposten manchmal mit der stillschweigenden Zustimmung des Staates errichtet. Insgesamt versuchten auf diese Weise mehrere aufeinanderfolgende Regierungen weit über 100 nicht anerkannte Siedlungen zu legalisieren.
Trotz des Gaza-Krieges ist der Bau-Boom in ganz Israel ungebrochen. Wenn dieses Tempo anhält, wird auch von den steinigen, grünen Hängen des Westjordanlands in wenigen Jahren nichts mehr zu sehen sein. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich, der selbst in einer illegalen Siedlung im Westjordanland lebt, erteilt immer neue Genehmigungen, so für Nahal Heletz bei Bethlehem, auf das man von Newe Daniel aus hinunterschauen kann. »Keine anti-israelische oder anti-zionistische Entscheidung wird die Entwicklung der Siedlungen stoppen. Wir werden weiter gegen das gefährliche Projekt der Gründung eines palästinensischen Staates kämpfen, indem wir vor Ort Fakten schaffen«, verkündete Smotrich im August 2024 auf der Plattform X. Für die israelische Organisation Peace Now, die den Bau von Siedlungen dokumentiert, ist es ein »großflächiger Angriff« auf das für Wein und Oliven bekannte Unesco-Weltkulturerbe mit den antiken Terrassen und Bewässerungssystemen. Die israelischen Siedlungen »zerstückeln den palästinensischen Raum«, kritisiert die Organisation, die sich vehement für eine Zwei-Staaten-Lösung ausspricht.