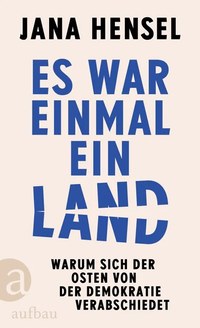Auf meinem Rechner sammele ich schon seit einigen Jahren Zuschriften »besorgter Bürgerinnen und Bürger«, die in mir so etwas wie den Pressesprecher der »islamischen Welt« sehen. Anders kann ich mir die Vielzahl von Nachrichten nicht erklären, die mich regelmäßig per E-Mail, über Social-Media-Kanäle, manchmal sogar ganz traditionell auf dem Postweg erreichen. Da ist zum Beispiel Herr A. Er schickt mir eine selbst erstellte Excel-Liste diverser Gräueltaten, die von Musliminnen und Muslimen weltweit begangen wurden oder begangen worden sein sollen, penibel sortiert nach Datum, Ort und Ausmaß der Brutalität. Er bittet mich um Stellungnahme bis zur kommenden Woche.
Meistens sind die Nachrichten kurz und knackig. »Ich werde dir 9/11 niemals verzeihen«, schrieb mir ein Unbekannter auf Facebook. Bis dato wusste ich noch nicht, dass ich höchstpersönlich für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich war, und erschrak für einen Moment über die Hinterlistigkeit, mit der ich sogar mich selbst betrog. Einige Zeitgenossen fordern mich auf, das Land zu verlassen, am besten bis morgen. Anderen reicht diese Vorstellung nicht, sie wünschen mir gleich den Tod.
Zum Glück gibt es mitunter kreative und einfallsreiche Zuschriften, die mich manchmal sogar zum Lachen bringen. Vor zwei Jahren erreichte mich in meinem Hochschulpostfach ein handschriftlich verfasster Brief von Herrn F., der sich als FDP-Mitglied vorstellte. Er begann den Brief damit, mehrfach zu betonen, dass er Afghaninnen und Afghanen Deutschunterricht gibt und zwar kostenlos. Herr F. schrieb, dass er weltoffen ist. Dass Hass und Gewalt durch nichts zu rechtfertigen sind. Das klang alles sehr schön. Doch meine langjährige Erfahrung als unbezahlter Pressesprecher der »islamischen Welt« lehrte mich, dass nach der Mitteilung solch aufopfernder Gesten am Anfang eines Briefes das Aber nicht weit entfernt sein kann.
Und tatsächlich, da kam die Einschränkung schon im nächsten Satz. Die Grenzen der Toleranz des Herrn F. waren nämlich nun erreicht. Er störte sich generell an den Muslim:innen. In seinem Brief beklagte er, dass das Kopftuch Alltag geworden sei und dass die Liste an Gewalttaten, die diese Menschen begehen, gar nicht in seinen Brief passen würde. Dafür hätte er auch keine Zeit. Aber mir eigens ein Bild zu malen, dafür schon. Dem Brief war eine selbst gemalte Zeichnung beigelegt. Sie zeigt eine Frau, einmal in Niqab und einmal in Burka. Dunkle Wassermalfarben auf DIN A4. Die Notiz zum Kunstwerk lautet: »Diese Dame hätte ich so nicht gewählt – es ist Frau Bundeskanzlerin Merkel.«
Das Bild habe ich eingerahmt und über meinen Schreibtisch gehängt. Es erinnert mich daran, dass die »Islamisierung Deutschlands« ganz nach Plan verläuft. Den Eindruck haben jedenfalls nicht wenige Menschen im Land. Einmal abgesehen von PEGIDA, den Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes, und der Alternative für Deutschland (AfD), fühlt sich fast die Hälfte »durch die vielen Muslime hier (…) manchmal wie ein Fremder im eigenen Land«. (Decker/Brähler, 2020, S. 64) 27,4 Prozent – in Ostdeutschland sogar 40,2 Prozent − plädieren dafür, Musliminnen und Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland zu verbieten. Der Vorwurf lautet Unterwanderung und Überfremdung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Einwanderungsverbot, weil muslimisch.
Zwanzig Jahre nach der Geburtsstunde der »Leitkultur-Debatte« und zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Thilo Sarrazins Hetzschrift, Sie wissen welche, steht die Warnung vor »dem« Islam als Gefahr für Gesellschaft, Demokratie und Rechtsstaat auf der Tagesordnung. Über die Kultur und Religion der Anderen wird leidenschaftlich debattiert und gestritten, in der medialen Berichterstattung und auf Demonstrationen gegen Migration und Asyl, in Polit-Talkshows über Terror und Gewalt, in wissenschaftlichen Studien über vermeintlich integrationsunwillige muslimische Jugendliche oder ganz beiläufig auf der familiären Weihnachtsfeier und in der Supermarktschlange.
Der Islam weckt Misstrauen. Er symbolisiert das Fremde, mit ihm ist eine Liste unzähliger Defizite assoziiert, die es zu korrigieren oder abzuwehren gilt. Er funktioniert wie eine Mülltonne, in die Probleme entsorgt werden können, um den Rest der Gesellschaft von seiner Verantwortung freizusprechen und das eigene Gewissen reinzuwaschen. Die Sozialpädagogin und Rassismusforscherin Iman Attia spricht deshalb auch von einer »Muslimisierung« gesellschaftlicher Probleme und Debatten. (…)
Kein Wunder also, dass einige meinen, sie würden Sexismus, Homofeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt und Terror abschaffen, indem sie gegen »den« Islam auf die Barrikaden gehen und die Einwanderung von »den« Musliminnen und Muslimen und »den« Geflüchteten ablehnen. Oder indem sie Frauen mit Kopftuch die Ausübung des Lehrerinnenberufs untersagen und gegen den Bau einer Moschee in ihrem Stadtviertel protestieren. Nicht gerade überzeugende Maßnahmen für mehr Demokratie, Freiheit und Sicherheit.
Der Islam ist der Sündenbock unserer Zeit, er ist wie ein verzerrtes Spiegelbild, in dem sich Europa selbst idealisiert: rational, modern, egalitär und entwickelt. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört, ohne zu verstehen, dass die Leidenschaft, mit der das geschieht, bereits beweist, wie abhängig das Land von »seinen Fremden« geworden ist. Ohne Islamdebatte kein Deutschland mehr. Und wer dazugehören will, betreibt »Islamkritik«, das gehört zum guten Ton. Mich hat das Wort schon immer irritiert. Es klingt so, als gäbe es »den« Islam als absolute Kategorie, eine Art Bauklotz, mit klaren Ecken und Kanten, in eindeutiger Farbe und immer gleichem Muster. Er muss kritisiert und korrigiert werden, dieser Islam, weil er sonst nicht zu den restlichen Bauklötzen passen würde, weil das Haus sonst zusammenbricht. Islamkritik, das heißt: Kritik am Islam ist überlebensnotwendig.
Während Islam und Kritik wie Pech und Schwefel aneinanderkleben, genießt das Christentum ein unsichtbares Privileg. Das Wort Christentumkritik gibt es nicht mal. »Das« Christliche verkörpert Menschenwürde und Nächstenliebe. Es wird mit Europa und Demokratie verknüpft. »Der« Islam bildet seine Antithese. Dem positiven Christlich-Europäischen steht das negative Islamisch-Orientalische gegenüber. Deshalb muss es offensichtlich das Wort Islamkritik geben, genauso wie den »politischen Islam«.
Einen solchen Straftatbestand forderte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz auf Twitter wenige Tage nach dem islamistischen Angriff in Wien im November 2020, »um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen«. Als dann auch noch im selben Twitter-Thread von der Einführung eines Imame-Registers die Rede war, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Das klingt nach Gesinnungsstrafrecht für Musliminnen und Muslime. Da müssten doch Alarmglocken läuten. Ich will mir nicht vorstellen, wie leicht ein Straftatbestand »politischer Islam« missbraucht werden kann. Ohnehin fehlt dem Begriff jede definitorische Trennschärfe.
Manch ein Experte behauptet, dieser ominöse politische Islam wäre eine viel gefährlichere Ideologie als der Wahabismus oder der Salafismus. Gefährlicher deshalb, weil seine Anhängerinnen und Anhänger sich tarnen, Integration nur vorspielen, sich bewusst distanzieren, sich nett und freundlich geben, aber in Wirklichkeit andere Pläne verfolgen würden. Wer so etwas sagt, lädt die Gesellschaft dazu ein, in allen Muslim:innen heimliche Islamist:innen zu vermuten. Mit einem solchen Pauschalverdacht, wie er in den letzten Jahren öfters laut wird, schert man alle über einen Kamm, die die gesellschaftliche und politische Bühne als Muslim:innen betreten.
Und tatsächlich: Im Juni 2021 stellte die umstrittene »Dokumentationsstelle Politischer Islam« in Österreich eine »Islam-Landkarte« vor. Über 600 Moscheen, islamische Gemeinden und Einrichtungen wurden kartografiert. In den Kurzbeschreibungen werden u. a. auch ethnische Zugehörigkeiten und weltanschauliche Ausrichtungen verzeichnet. Das alles soll angeblich Transparenz schaffen, fördert in Wirklichkeit aber nur Misstrauen. Rechtsextreme nutzten das Serviceangebot für ihre Zwecke. Sie montierten Warnschilder vor mehreren Moscheen in Wien mit der Aufschrift »Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe«. Und an die Tür einer Moschee in Salzburg schmierte jemand: »Der Führer ist wieder zurück«. Trotzdem hält die österreichische Regierung weiterhin an diesem Projekt fest. Um die Sicherheit von Muslim:innen geht es wieder einmal nicht.Längst wird der Begriff »politischer Islam« instrumentalisiert, um muslimische Menschen pauschal zu beschuldigen. Unter ihm kann all das zusammengeführt werden, was Islamkritikerinnen und -kritiker an muslimischen Menschen im Allgemeinen und an ihren kulturellen und religiösen Praktiken im Speziellen verdächtig und nicht kompatibel mit »dem westlichen Leben« finden. Die Debatten gehen nicht über das plakative, sog. islamkritische Vokabular hinaus. Auf das ist man angewiesen, das zieht im Wahlkampf, nicht nur ganz weit rechts, sondern bei allen, die sich von Islamthemen von Herzen gern gruseln lassen.
»Bei der Besessenheit mit muslimischen Menschen und dem Islam habe ich die Befürchtung, dass Sebastian Kurz das Kalifat in Österreich ausrufen möchte«, amüsierte sich die Journalistin Nour Khelifi im September 2020 in einer Kolumne auf Website sosmitmensch.at über den Fall. Auch sie fordert Bekenntnisse zu Demokratie und Rechtsstaat – und das zur Abwechslung einmal von Seiten österreichischer Parteien und Politikerinnen und Politiker, deren Nähe zu rechter Ideologie, zu Rassismus, Antisemitismus und Burschenschaften gerne unter den Teppich gekehrt wird. »Und da frage ich mich mal ganz ungeniert: Respektieren ÖVP und FPÖ die österreichische Verfassung?«
Das ist eine gute Frage, die sich ebenso auf Deutschland beziehen lässt. Und das nicht nur mit Blick auf die AfD und ihre Unterstützerkreise. Die wenigsten würden hierzulande einen Straftatbestand »politisches Christentum« einführen wollen, und ebenso wenig überraschend existiert auch dieses Wort in unserem Sprachgebrauch nicht. Dabei streben christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten politische Macht an. In Polen wollen sie Abtreibungen verbieten und ziehen LGBTQI+7-Aktivist:innen vor Gericht, weil sie auf einem Protestplakat den Heiligenschein der Madonna in Regenbogenfarben dargestellt haben. In den USA erklären radikale christliche Predigerinnen und Prediger die Linke zum satanischen Bösen, das bekämpft werden müsse. Auch in Deutschland bieten christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten sogenannte »Konversions-Therapien« an, um Homosexuelle zu »heilen«. Der norwegische Attentäter Breivik, der Anschläge in Oslo und Utøya beging und 77 Menschen ermordete, sah sich als moderner Kreuzritter. Von der sagenumwobenen Nächstenliebe ist jedenfalls nichts zu spüren, wenn Rechtsextreme auf christliche Symbolik zurückgreifen. Zum Beispiel auf die Reconquista Spaniens im 15. und 16. Jahrhundert, als jüdische und muslimische Menschen von der iberischen Halbinsel nach Nordafrika vertrieben wurden. In ihrem Namen Reconquista Germanica griff eine rechtsextreme Gruppe derartige Vertreibungsfantasien explizit auf.
So tief ist die hiesige Gesellschaft vom Feindbild Islam durchdrungen, dass sie Musliminnen und Muslime erst gar nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger mit legitimen politischen Forderungen nach Teilhabe und Schutz, etwa vor rechter Gewalt, wahrnehmen kann. Weder im Inland noch im Ausland. In Guantánamo wird von Folter an muslimischen Gefangenen berichtet. Im neuseeländischen Christchurch wurden Moscheen angegriffen und Muslim:innen ermordet. Auch in Indien erfährt die muslimische Minderheit Hetze und Anfeindungen auf offener Straße bis hin zu brutalen Pogromen. In Myanmar und in China nimmt die Verfolgung genozidale Ausmaße an. Das erregt hier nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie jene Fälle, in denen die Tatpersonen selbst Musliminnen oder Muslime sind.
Antimuslimischer Rassismus wird geleugnet oder kleingeredet. Doch das Problem ist real, und es kann tödlich enden. Auch in Deutschland. Das hat der Mord an Marwa El-Sherbini am 1. Juli 2009 aufs Schrecklichste gezeigt. Sie saß im Dresdener Landgericht, um gegen den Angeklagten auszusagen, der sie auf einem Spielplatz als Terroristin und Islamistin beschimpft hatte. Im Laufe der Strafverhandlung warf sich der Angeklagte plötzlich auf die im dritten Monat schwangere Frau und ermordete sie mitten im Gerichtssaal mit 18 Messerstichen. Elwy Ali Okaz, der Ehemann, eilte ihr zur Hilfe wurde von einem Polizisten mit dem Täter verwechselt und selbst angeschossen.
Der Fall hat sich mir tief ins Bewusstsein gegraben. Hier war eine Mitbürgerin, die in Sicherheit und Würde leben wollte. Die es nicht duldete, beschimpft und gedemütigt zu werden. Wer hätte gedacht, dass sie ausgerechnet dort ermordet werden würde, wo sie Gerechtigkeit durch den Rechtsstaat einforderte? Zu wenigen in diesem Land sagt der Name Marwa El-Sherbini etwas. Oft vergessen wir die Namen der Opfer, während sich die Täter medial verewigen und so ihren Weg in die Köpfe Gleichgesinnter finden, ihnen zeigen, dass es möglich ist zu töten, und sie dazu ermutigen, es ihnen nachzutun.
Den 1. Juli hat der Rat muslimischer Studierender & Akademiker (RAMSA) zum Tag gegen antimuslimischen Rassismus ausgerufen. An diesem Datum finden bundesweit Veranstaltungen statt, um auf diesen paradigmatischen Fall aufmerksam zu machen und die Stimme gegen den grassierenden Hass auf Musliminnen und Muslime zu erheben. Denn Anschläge auf Moscheen und Unterkünfte, genauso wie Beschimpfungen und körperliche Angriffe auf offener Straße sind für viele muslimische Menschen, besonders für Frauen mit Kopftuch, an der Tagesordnung. Allein im Jahr 2020 zählte die Kriminalstatistik 1026 islamfeindliche Straftaten. Das ist ein Anstieg von 8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der durch Gewalttaten Verletzten zu. 2019 starben zwei Menschen in Folge eines Übergriffes. Antimuslimischer Rassismus kann töten.
Doch der gesellschaftliche Aufschrei bleibt aus, obwohl die Gefahr von rechts hoch ist und das Leben von Muslim:innen ebenso wie das von Schwarzen Menschen, von Jüd:innen, Sinti:zze und Rom:nja und vielen anderen People of Color bedroht. Für ihre Bedürfnisse, ihre Sorgen und Ängste, ihre Forderungen nach Repräsentation und gleichberechtigter Teilhabe gibt es kaum Gehör. Stattdessen überschatten Misstrauen, Islamismusvorwürfe und eine Integrationsdebatte nach der anderen das alltägliche Leben.
Sobald Musliminnen und Muslime davon berichten, dass sie Rassismus erfahren, macht sich Genervtheit breit. Da wird relativiert, bagatellisiert und geschimpft, was das Zeug hält. Wer es wagt, antimuslimischen Rassismus beim Namen zu nennen, der wird belächelt und als ideologisch verblendet dargestellt. Dem wird vorgeworfen, Fürsprecher des Islamismus zu sein. Der wird aufgefordert, sich selbst von Gewalt und Terror zu distanzieren. Als wäre die Tatsache, dass man die Diskriminierung von muslimischen Menschen beanstandet, ein Beweis dafür, dass man Gewalt, die von Musliminnen und Muslimen ausgeht, ganz wunderbar finden würde. Oder als könnten sie überhaupt gar keine »echten« Opfer sein.
Es muss doch möglich sein, das, was muslimische und als solche wahrgenommene Menschen an Hass und Ausschluss erfahren, konsequent zu verurteilen, ohne reflexhafte Abwehr, kulturelle Vorurteile oder den Hinweis auf die Verbrechen islamistischer Terrorgruppen. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir es nicht schaffen, Rassismus ohne Wenn und Aber zu kritisieren und Opfer zu unterstützen?
»Seit ich denken kann«, habe ich einmal in einem Gastbeitrag auf Zeit Online geschrieben, »fühle ich mich in diesem Land wie ein Problem. Ich muss erklären, woher ich komme, woher meine Eltern kommen, die Großeltern und die Urgroßeltern. Ich muss beweisen, dass ich kein böser Muslim bin, sondern die freiheitlich-demokratische Grundordnung achte. Immer wieder stehe ich unter dem Druck, meine Zugehörigkeit unter Beweis zu stellen. Aber das Integrationsversprechen löst sich einfach nicht ein. Egal, wie gut Deutsch man spricht, wie sehr man sich gesellschaftlich einbringt, man wird nicht als einer von hier gesehen.« Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das Problem nicht bei mir liegt. Es ist der Blick, der mich zum Fremden macht. Es sind die Schimpfnamen, die mir das Gefühl der Unzulänglichkeit geben und mein Leben einengen, die meiner Existenz nur einen kleinen begrenzten Rahmen zugestehen. Dieser Raum, auf den ich verwiesen werde, und diese Sprache, in die ich gefangen genommen werde, reichen nicht aus, um zu sein, wer ich bin. Das Vokabular der Dämonisierung, mit dem ein Mensch aufwächst, hinterlässt Spuren im Bewusstsein, im Handeln und Denken über sich und die Welt.
Dafür steht der Titel dieses Buches: Muslimaniac. Darunter verstehe ich eine jahrhundertealte Diagnose, die Muslim:innen zum Problem erfindet – sexuell, gesundheitlich, kulturell, religiös, politisch. Sie werden beobachtet, erforscht, inspiziert, korrigiert, abgewehrt. Sie gelten als Außenseiter und Eindringlinge, als gewalttätige Fremdlinge. Sie werden in kolonialhistorischen und zeitgenössischen Debatten misstrauisch beäugt und pathologisiert, mit Krankheit und Gefahr in Verbindung gebracht, herabgewürdigt und deklassiert.
Die Figur des Muslimaniac steht für eine strukturelle Paradoxie: Musliminnen und Muslime sollen Loyalität unter Beweis stellen, sich integrieren und anpassen, sich zu Rechtsstaat und Demokratie bekennen, den Schritt aus der Tradition in die Moderne machen und sich »nach westlichem Vorbild« weiterentwickeln. Die Liste an Forderungen ist lang, doch das Versprechen auf Gleichheit und Gerechtigkeit löst sich nicht ein. Es besitzt nur eine Alibifunktion. Das Idealbild eines »guten«, »integrierten« Muslims dient dazu, »böse« Muslime ins Visier zu nehmen. Doch wer »gut« und wer »böse« ist, das liegt in der Hand der mehrheitsdeutschen Autorität.
Leseprobe : Kampf gegen Klischees
Egal, ob man in Deutschland geboren wurde und sich überhaupt in jeder Hinsicht integriert: Muslim bleibt immer Muslim – fremd, gefährlich, rückständig. Und als Muslimin ist man entweder unterdrücktes Opfer oder erotische Projektionsfläche

Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images
Articles & Services

Stimme gegen antimuslimischen Rassismus
„Muslimaniac“ nennt Keskinkılıç die Erfindung der Muslime als Problem: ein schillernder Begriff, in dem sich gesellschaftliche Konstruktion und Besessenheit mit dem leidenschaftlichen, ironischen Geist des Ausbruchs aus den Stereotypen mischen

Hochaktuelle Debatte
„Der Begriff ,politischer Islam‘ wird instrumentalisiert, um Muslim*innen kollektiv zu verdächtigen und Grundrechte zu beschneiden. Ihm fehlt es an Trennschärfe, um Missbrauch zu verhindern. Ohnehin haftet dem Begriff die Doppelmoral verbissen an.“

Mit anderen Augen
„Ozan Zakariya Keskinkılıç räumt mit seinem Buch gründlich auf mit gängigen Pauschalurteilen und Halbwahrheiten über ,den‘ Islam. Ohne Bitterkeit, dafür bissig und humorvoll seziert er die Obsession vieler Deutschen mit Muslim*innen [...].“
Ozan Zakariya Keskinkılıç | Fachgespräch
Fachgespräch zwischen Prof. Dr. Kai Hafez, Lamya Kaddor, Ozan Zakariya Keskinkılıç und Rima Hanano zu den „Aktuelle Herausforderungen in der Prävention von Islam- und Muslimfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus“
BlackRockTalk | 4Blocks & der Berliner Muslim
Karakaya spricht im Rahmen von BlackRockTalk mit ihren Gästen über die Authentizität der Serie „4Blocks“ und in diesem Zusammenhang auch über den „Berliner Muslim“. Unter den Gästen ist auch der Politikwissenschaftler Ozan Zakariya Keskinkılıç
Antimuslimischer Rassismus | jup! Berlin
Vorurteile und Übergriffe gegenüber Muslim*innen und Jüd*innen sind in Deutschland weit verbreitet. Aber wie erleben ihn Betroffene selbst? Wir haben mit drei Berliner*innen über ihre Erfahrungen gesprochen
Identitätspolitiken in der Kunst | DAGESH
Identitätspolitiken sind aktueller denn je. Sind sie ein wichtiges Werkzeug der Selbstermächtigung, um sich gegen Strukturen von Ausgrenzung und „Unsichtbarmachung“ zu wehren oder spalten sie Gesellschaft und Communities?