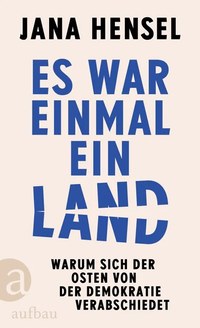Einleitung
Der Riss in der Gesellschaft
Sind Empfindungen reine Privatsache? Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Wie viel Nähe ist angenehm und mithin erlaubt? Und wo liegt die Grenze des Sagbaren? Welches Sprechen tangiert die Würde von Menschen – und welches bewahrt sie? Gehört das generische Maskulinum abgeschafft? Ist das ›N-Wort‹ auch als Zitat eine Zumutung? Wer entscheidet das im Zweifelsfall? Sind Betroffene näher an der Wahrheit als Nicht-Betroffene, weil sie Gewalt – ob verbal oder physisch – am eigenen Leibe erfahren haben? Ist Verletzlichkeit die neue Stärke?
Ob MeToo oder Black Lives Matter, ob die Debatten über gendergerechte Sprache, Trigger-Warnungen oder Meinungsfreiheit, ob der Kampf um Anerkennung benachteiligter Gruppen oder die Empfindlichkeiten jener, die um den Verlust von Privilegien fürchten: Offenbar sind wir mehr denn je damit beschäftigt, das Limit des Zumutbaren neu zu justieren. Doch fährt sich der Diskurs hierüber zunehmend fest: Liberale und Egalitäre, Rechte und Linke, Alte und Junge, Betroffene und Nicht-Betroffene stehen sich unversöhnlich gegenüber. Während die einen sagen: Ihr stellt euch an, seid hypersensible »Schneeflocken«!, entgegnen die anderen: Ihr seid verletzend und beleidigend, an eurer Sprache klebt Blut!
Der Effekt dieser Frontalstellung ist eine zunehmende Erosion der demokratischen Diskurskultur und ein kaum noch zu kittender Riss, der sich mitten durch die Gesellschaft zieht.
Umso dringender ist zu fragen, wo ein Ausweg gefunden werden kann. Ich schlage vor, einen Schritt zurückzutreten und frei von Polemik eine Entwicklung zu beleuchten, die mit der Genese des modernen Subjekts unauflöslich verbunden ist: die zunehmende Sensibilisierung des Selbst und der Gesellschaft.
Aktive und passive Sensibilität
»Sensibel«, das meint: empfindlich, fühlbar, empfänglich. Positiv wird der Begriff meist im Sinn eines ausgeprägten Einfühlungsvermögens verwendet, negativ bezeichnet er die Überempfindlichkeit eines Subjekts, das dem Leben nicht gewachsen ist. Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, dass diese Spannung eine lange Tradition hat.
Schon im Mittelalter unterschied man eine aktive Sensibilität, die sich in einem moralischen Sinn empfindsam auf die Welt ausrichtet, von einer passiven Sensibilität, die empfängt, auf Außenreize reagiert.1 Die aktive Sensibilität meint so viel wie »mit Empfindung begabt«2 und ist, verallgemeinernd gesagt, die tugendhafte, edle, gute, für die göttliche Wahrheit empfängliche. Im 18. Jahrhundert wurde sie als moralisches Gefühl systematisch ausgearbeitet: als, vereinfacht gesagt, natürliche Gabe des Menschen, das Gute aus sich heraus zu tun.
Die passive Sensibilität hingegen bezeichnet allgemein das, »was empfunden werden kann«3. Im positiven Sinn wurde diese passive Seite (insbesondere während der Epoche der Empfindsamkeit) mit Rührung gleichgesetzt. Überwiegend aber verstand man sie negativ im Sinne von Weinerlichkeit, Überspanntheit, auch (etwa bei Thomas von Aquin) sexueller Willfährigkeit. Die Materialisten im 18. Jahrhundert bezeichneten die passive Sensibilität als »sensibilité physique« und meinten damit die Reizbarkeit der Nerven.
Dass aktive Sensibilität und passive Reizbarkeit oft miteinander einhergehen, zeigt sich mit Blick auf die Gegenwart deutlich: Was für verwerflich und falsch gehalten wird, ist meist das, was auch die Gemüter reizt und umgekehrt – und zwar, wenn auch auf verschiedene Weise, quer durch alle politischen Lager. Während rechte Kräfte empfindlich auf gesellschaftliche Transformationen wie etwa den vorgeblichen »Genderwahn« reagieren und nicht selten mit gezielter Hassrede oder auch konkreter physischer Gewalt agieren, sind linksliberal Denkende dünnhäutig, wenn ihre Vorstellung von gesellschaftlichem Fortschritt hinterfragt wird, was mitunter zu systematischen Boykotts von Personen, gar zu Kündigungen führt.
Doch ist diese Verschaltung von Moral und Reizbarkeit keineswegs neu, sondern hat philosophische Vorläufer: So verabscheute der empfindsame Rousseau die Reizüberflutung der Stadt aus tiefster Seele. In der beschaulichen Pariser Peripherie entwickelte er seine Moral des von Natur aus guten, empathischen Menschen, den es vor schädigenden zivilisatorischen Einflüssen zu schützen gelte (vgl. Kapitel III). Das ländliche Idyll von Montmorency war, wenn man so will, Rousseaus Safe Space.
Dass die Sensibilität ein zweischneidiges Phänomen ist, stellt für das Verständnis der Gegenwart und damit auch für dieses Buch eine wegweisende Einsicht dar. Die Sensibilität ist nach außen und nach innen gerichtet. Bindend und trennend. Befreiend und unterdrückend. Auf den Punkt gebracht: Die Sensibilität trägt eine gewaltsame Seite in sich, was sich bereits in ihrer historischen Genese zeigt. Das Herausbilden von Sensibilität setzt nämlich Zwang voraus. In seinem berühmten Werk »Über den Prozeß der Zivilisation« (1939) zeichnet der Soziologe Norbert Elias eindrücklich die Transformation menschlichen Verhaltens nach, das sich durch fortschreitende Disziplinierung – angefangen beim Essen und Schlafen bis hin zu komplexen sozialen Situationen – zunehmend verfeinert und den Menschen für eigene wie fremde Grenzüberschreitungen sichtlich sensibler werden lässt. Die wesentlichen Methoden dieser Verfeinerung sind, so Elias, die »Dämpfung der Triebe«, »Affektregulation« und die Ausbildung eines kontrollierenden Über-Ichs. Anders gesagt: Um sensibel zu werden, müssen wir uns zähmen, »Fremdzwänge (...) in Selbstzwänge verwandeln«4 und regulierende Scham- und Peinlichkeitsgefühle ausbilden (vgl. Kapitel I).
Was Norbert Elias beschreibt, ist ein komplexes Ineinandergreifen von ›kalter‹ Disziplinierung und ›warmer‹ Sensibilisierung, von Normierung und Scham, von Selbstkontrolle und empfindsamer Weltwie Selbstwahrnehmung. Deutlich stellt der Soziologe heraus, dass der Mensch den kulturellen Anforderungen kaum genügen kann, ohne selbst Schaden zu nehmen; eine Beobachtung, die sich mit zentralen Einsichten der Psychoanalyse deckt: Die zunehmende Zivilisierung hat eine dunkle Seite, die sich auch in ihrer Fragilität zeigt.
Entsprechend ist die Sensibilisierung als historische Entwicklung gewiss nicht bruchund widerspruchslos. Im 20. Jahrhundert zeugen zwei verheerende Weltkriege und die Shoah eindrücklich von der Grausamkeit, die im Menschen wohnt und unter bestimmten Bedingungen hervorbricht. In seinem Buch »Verhaltenslehren der Kälte« analysiert der Historiker Helmut Lethen hellsichtig die Handlungsanleitungen zur Distanz und inneren Verpanzerung zwischen den Weltkriegen. Die Schriften von Ernst Jünger aus dieser Zeit dienen Lethen als Beleg. Gleichzeitig geben Jüngers Aufzeichnungen tiefen Einblick in die psychischen Mechanismen, die den Menschen nicht nur zu unvorstellbarer Gewalt befähigen, sondern ihn auch Unvorstellbares aushalten lassen (vgl. Kapitel IV).
Damit wäre ein zentraler Punkt berührt, den dieses Buch nach und nach freizulegen versucht: Auf ebenjene ›Kälte‹ der genannten Traditionslinie ist entscheidend zurückzuführen, dass der Appell an die Widerstandskraft in unseren Tagen hart und unsensibel oder, mit Klaus Theweleit gesprochen, männlich klingt. Theweleits berühmter These zufolge lebt der Faschismus in der Verpanzerung des Mannes und der gewaltsamen Abwehr der Frau fort: Das Faschistische sei beschreibbar als eine »Ausgeburt entfesselter Männergewalt«5, als »Normalfall des Mannes unter kapitalistischen/patriarchalischen Bedingungen«6. Aus Theweleits »soldatischem Mann« der ersten zwei Weltkriege ist heute der »toxische Mann« geworden.
Resilienz und Sensibilität: ein, so scheint es, unvereinbarer Gegensatz, der sich im Widerstreit der politischen Positionen spiegelt. Widerständig zu sein wird gleichgesetzt mit Gefühllosigkeit. Mit der Unfähigkeit, etwas an sich heranzulassen. Resilienz, so die weit verbreitete Auffassung gerade im linken politischen Spektrum, ist eine männliche, neoliberale Selbstoptimierungsstrategie, die unvereinbar ist mit Empathie und Solidarität.
Die Herkunft des Wortes ›Resilienz‹ scheint dieser Deutung durchaus recht zu geben. Das lateinische resilire meint zu Deutsch: zurückspringen, abprallen. Ursprünglich stammt das Wort aus der Physik und bezeichnet die Eigenschaft von Körpern, nach der Verformung durch eine Außenstörung in ihren Ausgangszustand zurückzukehren.
Doch wird zu zeigen sein, dass Resilienz und Sensibilität keineswegs notwendig in Opposition stehen. Das tun sie nur, solange sie verabsolutiert werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, ob die ›Kältelehren‹ nicht doch Punkte enthalten, die es gerade heute wieder zu entdecken gälte. So offenbart sich bei dem Versuch, die Schriften Jüngers mit Freud zu lesen, dass sich unterhalb der Kriegsund Gewaltverherrlichung ein Lebensdrang artikuliert, der bei traumatischen Erfahrungen höchster Ohnmacht rettend sein kann (vgl. Kapitel IV und V).
Auch das Werk Friedrich Nietzsches zeugt bei näherem Hinsehen nicht einfach von Verpanzerungsfanatismus. Hohe Verletzlichkeit und plastische Widerstandsfähigkeit gehen in seinen Schriften eine unauflösliche Verbindung ein (vgl. Kapitel II). Solche Berührungspunkte zwischen Sensibilität und Resilienz gilt es in diesem Buch herauszuarbeiten: Denn wenn es gelänge, die Resilienz mit der Kraft der Empfindsamkeit in ein Bündnis zu bringen, wäre der Konflikt, der gegenwärtig die Gesellschaft spaltet, in etwas Drittem aufgehoben.
Dass die Beziehung von Sensibilität und Abwehrkraft im allgemeinen Sinn grundsätzlich viel dialektischer ist, als es auf einen ersten Blick scheint, zeigt sich auch im Zivilisationsprozess selbst. Urbanisierung und Technisierung machen den Menschen dünnhäutig und reizbar; sein Schutz ist die psychische Abschottung. Bereits am Anfang des 20.Jahrhunderts diagnostiziert der Soziologe Georg Simmel eine »Blasiertheit«7 des Großstadtmenschen, der sich von den vielen Reizen der Außenwelt wie auch gegen etwaige Ansprüche abschirmt, um ihnen überhaupt standhalten und einen Raum innerer Freiheit ausbilden zu können. Paul Valéry stellt eine ganz ähnliche Diagnose: »Nach einer Phase der Verfeinerung« sei die Sensibilität beim modernen Menschen »im Abnehmen begriffen«, die ständige Reizüberflutung führe schlussendlich zur »Abstumpfung«8. Eine Feststellung, die sich heute als zutreffender denn je zu erweisen scheint: Schauen doch weite Teile der Bevölkerung, anstatt ihre Umwelt auch nur aus den Augenwinkeln wahrzunehmen, starr und stur auf ihr Smartphone.
Überreizung und Desensibilisierung sind zwei Seiten einer Medaille:9 Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die Verwerfungen der Gegenwart noch einmal in einem anderen Licht. Teile der Gesellschaft reagieren auf neu formulierte Ansprüche von Minderheiten mit einer ähnlichen Blasiertheit wie Simmels überforderte Großstadtmenschen. Umgekehrt sind auch die wache (woke) Wahrnehmung von diskriminierenden Implikationen und die entsprechende Beherrschung von politisch korrekten Sprachcodes bisweilen von blasierter Arroganz gezeichnet, die sich wie ein Schutzfilm über die eigene Verletzlichkeit legt.
Historisch ist zu beobachten, dass gerade auf Phasen extremer Gewalt entscheidende Sensibilisierungsschritte folgen. So haben die schwersten weltumspannenden Verbrechen des 20. Jahrhunderts, in denen die Kältelehren ihren schrecklichen Höhepunkt fanden, zu dem menschheitsgeschichtlich vielleicht größten Sensibilisierungsschub geführt. Hervorgegangen aus der Erfahrung zweier Weltkriege und der systematischen Ermordung der europäischen Juden ist immerhin, unter anderem, 1949 das deutsche Grundgesetz, dessen erster Artikel lautet: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Weder der Staat noch ein anderer Mensch, dies besagt der Satz, hat das Recht, die menschliche Würde anzutasten, das heißt: zu berühren.
Tastsinn und Takt, Feinmotorik und Fingerspitzengefühl kommen in dieser so sinnlichen Formulierung von der unantastbaren Würde zusammen. Verhärtungs- und Verpanzerungsansprüche gehören ab jetzt – und zwar aus guten Gründen – in ein vergangenes Kapitel der Geschichte. Die Sensibilität ist es, die von nun an die Geschicke bestimmt und den Schutzraum des Subjekts über dessen Leiblichkeit hinaus ausweiten soll. Tatsächlich ist mit dem Schutz der Würde, von dem das Grundgesetz spricht, weit mehr gemeint als nur der Schutz vor körperlicher Gewalt. Ja, was die menschliche Würde genau ist, was sie berührt, gar verletzt, ab wann ein Mensch einem anderen, im buchstäblichen Sinn, zu nahe tritt, die Grenze des Respekts überschreitet, ist keineswegs für alle Zeiten festgesetzt und klar umgrenzt, sondern, je nach Grad der gesellschaftlichen Empfindsamkeit, hart umstritten und höchst wandelbar. Stand bis vor wenigen Jahren handfeste Gewalt im Zentrum des Sexualstrafrechts, kann seit der Reform im Jahr 2016 auch ein falsch gedeuteter Wille rechtliche Konsequenzen haben. Galt es für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte als unproblematisch, von »Frauen« und »Männern« zu sprechen und ihnen bestimmte biologische Merkmale zuzuweisen, wird dies heute als »transfeindlich« empfunden, also diskriminierend gegenüber Menschen, die in keine dieser Kategorien hineinpassen. War es bis in die 1990er Jahre hinein unverdächtig, mit Schokolade überzogene Zuckerschäume mit einem diskriminierenden Ausdruck zu bezeichnen, ist das ›N-Wort‹ heute klar als rassistisch und verletzend, als eine Form unzumutbarer sprachlicher Gewalt anerkannt.
[...]