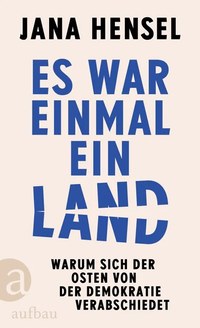Im Oktober 2018 wurde der Rekord für das teuerste Haus in Großbritannien gebrochen: Ein Penthouse im Londoner Luxuswohnkomplex One Hyde Park wurde für 160 Millionen Pfund verkauft. Zunächst war die Identität der Käuferin oder des Käufers ungeklärt. Die Immobilie war über eine Mantelgesellschaft in der Steueroase Guernsey erworben worden, wo Unternehmen nicht verpflichtet sind, offenzulegen, wem sie gehören.
Aber einige Tage später wurde das Geheimnis gelüftet. Wie sich herausstellte, verkaufte der millionenschwere Immobilien-Tycoon Nick Candy das Penthouse – über ein Joint Venture zwischen seinem Bruder Christian Candy und dem ehemaligen Premierminister von Katar – an keinen anderen als sich selbst, nur um sein Eigenkapital daraufhin wieder freizusetzen, indem er bei der Credit Suisse eine Hypothek im Umfang von 80 Millionen Pfund aufnahm.
Zusammen verfügen Nick und Christian Candy über ein Vermögen von 1,5 Milliarden Pfund. Mitte der 1990er Jahre hatten sie ihren ersten Durchbruch, als ihnen ein Familienmitglied ein Darlehen in Höhe von 6.000 Pfund gewährte, mit dem sie eine Wohnung in London kauften, renovierten, weiterverkauften und dabei einen Gewinn von 50.000 Pfund machten. Wie viele Immobilienentwickler zu dieser Zeit, nutzten sie diese Gewinne, um eine Reihe von Wohnungen in London zu kaufen und weiterzuverkaufen. So ritten sie auf der Welle des Immobilienbooms mit und verdienten sich dabei dumm und dämlich. Heute sind die beiden Brüder berühmt für ihren sagenhaften Reichtum, ihre aggressive Steuervermeidungstaktik und ihre lange Liste prominenter Kundinnen und Kunden, darunter Kylie Minogue und Katy Perry.
Wie war es möglich, dass die Candy-Brüder in einem Zeitraum von nur zwanzig Jahren allein durch Investitionen in britisches Wohneigentum 6.000 Pfund in 1,5 Milliarden Pfund (das sind ausgeschrieben 1.500.000.000) verwandelten konnten?
Die Immobilienblase
Die Candys sind nicht die einzigen, die ihr Vermögen mit den explodierenden Londoner Immobilienpreisen gemacht haben. Tatsächlich belegen sie auf der Liste der wohlhabendsten Bauträger Großbritanniens nur Platz 52. Ganze 163 der 1.000 reichsten Menschen des Landes haben ihr Geld mit Immobilien verdient, was sie zur größten Vermögensquelle auf der Reichenliste der Sunday Times macht. Aber nicht nur die Wohlhabenden haben von den steigenden Hauspreisen profitiert: Alle, die vor dem Boom der 1980er Jahre ein Haus gekauft hatten, erlebten einen Mitnahmeeffekt.
Dieser Anstieg der Immobilienpreise begann in den 1980er Jahren im Rahmen des Bestrebens der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher, eine »Property-Owning Democracy« – also eine auf Privateigentum gegründete Demokratie – zu errichten. Im Jahr 1980 verabschiedete ihre Regierung die sogenannte »Right to Buy«-Gesetzgebung, die es den Mieterinnen und Mietern von Sozialwohnungen erlaubte, dem Staat ihr Haus zu einem Preis zwischen einem und zwei Dritteln seines Marktwertes abzukaufen.
In den ersten sieben Jahren der 1980er wurden auf diese Weise 6 Prozent der britischen Sozialwohnungen verkauft. Aber die Privatisierung der Sozialwohnungen Großbritanniens allein hätte nicht ausgereicht, um Thatchers Vision einer Nation von Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern zu realisieren. Die Menschen benötigten Hypotheken – und das erforderte eine Veränderung des britischen Finanzsystems. Also deregulierte Thatcher den Bankensektor.
Wenn Banken Kredite vergeben, dann erzeugen sie neues Geld. Dieses einzigartige, vom Staat gewährte Privileg macht eine Bank zu einer Bank und unterscheidet sie von anderen Finanzinstitutionen wie etwa Bausparkassen. Wenn ich zum Beispiel 100 Pfund in eine Bausparkasse einzahle, dann wird sie vielleicht 10 Pfund dieses Geldes für sich behalten und 90 Pfund an eine andere Person verleihen. Dabei wird kein neues Geld geschaffen, sondern nur existierendes Geld von A nach B bewegt.
Banken hingegen können Geld verleihen, ohne zuvor eine entsprechende Einlage entgegengenommen zu haben. Die Staaten haben ihnen nämlich das Recht eingeräumt, unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen Kredite in der Landeswährung zu vergeben. Eine Bank kann also 90 Pfund verleihen, ohne tatsächlich über Einlagen von 90 Pfund zu verfügen. Wie viel die Banken verleihen können, wird durch die Zentralbanken reguliert: Einige Zentralbanken verlangen, dass die Banken Mindestreserven bei ihnen halten. Außerdem müssen alle Banken sicherstellen, dass sie bestimmte Kapitalanforderungen erfüllen.
Bis zu den 1980er Jahren galten für diese Form der Geldschöpfung noch viele weitere Restriktionen. Vor 1981 waren die britischen Banken darauf angewiesen, eine bestimmte Summe bei der Bank of England zu halten, um Kredite in einer bestimmten Höhe vergeben zu dürfen, was die Kreditvergabe und damit die Geldmenge einschränkte – diese Regelung wurde daher auch »Korsett« genannt.
Als die Beschränkungen auf die Kapitalmobilität aufgehoben wurden, wurde es für die Banken viel einfacher, diese Regelungen zu umgehen, indem sie ihre Aktivitäten ins Ausland verlagerten. Des »Korsetts« hatte man sich so entledigt. Es fiel ihnen leichter, Kredite aufzunehmen, sei es bei institutionellen Investoren oder bei anderen Banken. Und sie nutzten die erleichterte Kreditaufnahme, um ihre eigene Kreditvergabe zu erhöhen. Die Banken begannen, eine viel größere Rolle bei der Vergabe von Hypothekenkrediten zu spielen: Im Jahr 1980 waren sie für nur 5 Prozent der Hypotheken verantwortlich – zwei Jahre später waren es bereits 35 Prozent.
»Mit dem Kauf eines Hauses erwarb man nicht mehr nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine Zukunft: eine Rente, eine Erbschaft für seine Kinder – aber auch dreißig Jahre ununterbrochene Hypothekenrückzahlungen.«
Eine weitere bedeutende Reform des Finanzsystems waren die Veränderungen, die an den britischen Bausparkassen vorgenommen wurden. Diese entstanden im 18. Jahrhundert in den neuen Industriestädten Großbritanniens, um diejenigen beim Hausbau zu unterstützten, die es sich leisten konnten. Ältere Menschen, die bereits Wohneigentum besaßen, legten ihre Ersparnisse in die Bausparkassen ein, die sie dann in Form von Hypotheken an die jüngeren Mitglieder verliehen. Die Bausparkassen wuchsen weiter, bis sie 1980 für 90 Prozent der britischen Hypothekenkredite verantwortlich waren, was ihnen – in den Worten der Bank of England – ein »virtuelles Monopol« auf dem Hypothekenmarkt verschaffte.
Um die Konkurrenz in diesem Sektor zu erhöhen, wurde im Jahr 1986 der Building Societies Act verabschiedet, der es den Bausparkassen erlaubte, wie normale Banken zu agieren. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes konnten nun auch sie durch die Vergabe von Krediten Geld erzeugen und auch sonst so ziemlich alles tun, was Banken tun konnten. Schließlich führten viele von ihnen jene Art von Subprime-Krediten ein, die später die Krise verursachen würden.
Während der 1980er Jahre gaben Banken und ehemalige Bausparkassen Hypothekenkredite in Millionenhöhe aus, um den Menschen den Erwerb von Eigenheimen zu ermöglichen.
Viele von ihnen nutzten diese Kredite, um die Sozialwohnungen zu kaufen, in denen sie lebten. Dieser Anstieg der Kreditvergabe führte zu einer Erhöhung der allgemeinen Geldmenge in Großbritannien, die von rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1985 auf 85 Prozent im Jahr 1990 anstieg, was der Zunahme der gewährten Kredite entsprach. In dieser Zeit waren also Unmengen an Geld um Umlauf – der Wohnbestand hingegen hatte sich nicht vergrößert. Die unvermeidliche Folge eines solchen Szenarios ist eine Inflation der Hauspreise.
Als die Finanzwirtschaft den Immobilienmarkt kolonisierte, wurde Wohneigentum zu einem spekulativen Vermögenswert. Zwischen den Jahren 1979 und 2008 verzehnfachten sich die durchschnittlichen Hauspreise, während die Verbraucherpreise nur um die Hälfte dieses Betrags stiegen. Mit dem Kauf eines Hauses erwarb man nicht mehr nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine Zukunft: eine Rente, eine Erbschaft für seine Kinder – aber auch dreißig Jahre ununterbrochene Hypothekenrückzahlungen. Der Boom endete natürlich in einer Krise. Aber bis zu dieser Krise transformierte das schulden- und konsumgetriebene Wachstumsmodell die britische Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
Eine Koalition fürs Kapital
Thatcher wusste, dass sich die öffentliche Unterstützung für die wichtigsten Elemente ihrer neoliberalen Agenda in Grenzen hielt – also versteckte sie ihre Bekenntnisse zu Privatisierung und Deregulierung im Kleingedruckten. Tatsächlich waren selbst jene politischen Vorhaben, für die Thatcher warb – vom Kampf gegen die Gewerkschaften bis zur Verschlankung des Staates – bei den Wählerinnen und Wählern nicht sonderlich beliebt.
Sie führte einen jahrelangen Kampf gegen die britische Arbeiterbewegung und wandte jede Menge politisches Kapital auf, um ihn zu gewinnen. Die nächste Aufgabe bestand darin, im Gegenzug das Kapital zu stärken. Dieser Sieg der Interessen des Kapitals über die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter wäre für sich nicht von langer Dauer gewesen. Was die Neoliberalen brauchten, um ihr neues System zu stabilisieren, war eine mehrheitsfähige politische Basis.
Die finanzielle Deregulierung und die Ausweitung des Immobilienbesitzes ermöglichten es den Konservativen in Großbritannien, Menschen mit mittleren Einkommen in Minikapitalistinnen und Minikapitalisten zu verwandeln, die von der Finanzialisierung der Wirtschaft profitieren würden. Indem der Thatcherismus einem großen Teil der Bevölkerung Zugang zu Kapitalerträgen verschaffte, erzeugte er eine Klasse von Menschen, die ein materielles Interesse daran hatten, dass die Wirtschaft so blieb, wie sie war, auch wenn die meisten Erträge des Wachstums nach wie vor dem obersten einen Prozent der Gesellschaft zufallen würden.
Thatcher stellte ihre Wohnpolitik als einen zukunftsweisenden Versuch dar, der das Land in eine Nation verantwortungsbewusster Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer verwandeln würde, die zur Verwirklichung ihres Traums von einem besseren Leben nicht auf die Unterstützung des Staates angewiesen sein würden. Als vernünftige und verständige Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich die Menschen dafür entscheiden, ihre hart erarbeiteten Ersparnisse in Wohnraum und Privatrenten zu investieren, denn diese würden – so lautete das Versprechen – kontinuierlich an Wert gewinnen.
Befreit vom übermäßigen Einfluss eines paternalistischen Staates würden die freien Märkte die Nation in den Wohlstand führen. Wenn man zu arm, zu dumm oder zu faul war, um die fantastische Gelegenheit zu ergreifen, die sich in dieser schönen neuen Welt bot, dann war man selber schuld. Die Rolle des Staates würde sich darauf beschränken, durch die Kontrolle der Zinssätze die Inflation einzudämmen, damit die Ersparnisse der Menschen nicht entwertet würden.
Die landläufige Kritik an Thatchers Vision lautet, dass ihre Verteidigung der individuellen Freiheit zwar durchaus wichtig gewesen sei, dass es aber ebenso wichtig wäre, sich um das kollektive Wohl zu kümmern – manchmal müsse die individuelle Freiheit dann eben eingeschränkt werden, um die Märkte zu regulieren und soziale Missstände wie Ungleichheit und Armut zu verringern. Das mag zwar zutreffen, jedoch akzeptiert dieses Argument die Voraussetzungen des neoliberalen Diskurses.
Wir können den Thatcherismus nicht begreifen, indem wir nur Thatchers Rhetorik betrachten – um zu verstehen, was sie mit ihrer Vision bezweckte, müssen wir uns ansehen, wer von diesen Veränderungen profitiert hat. Dabei wird zugleich kenntlich, wie die Sprache des Neoliberalismus dazu diente, zu verschleiern, was in Wirklichkeit vor sich ging: ein Transfer der gesellschaftlichen Ressourcen von den Menschen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten, zu jenen Menschen, die Vermögenswerte besitzen.
Die Konservativen transformierten die politische Ökonomie Großbritanniens, indem sie den Wohlhabenden ohne Gegenleistung Geld hinterherwarfen – und zwar in Form der Kapitalerträge, die sich aus der Wertsteigerung ihrer Häuser und ihrer Privatrenten ergaben. Für jene, die auf die Kredite zurückgreifen konnten, die für den Erwerb dieser Vermögenswerte erforderlich waren, kompensierten diese steigenden Vermögenspreise die sinkenden Löhne.
Menschen mit mittleren Einkommen sollten Thatchers Modell auf Grundlage der Annahme unterstützen, dass auch sie eines Tages zu den Wohlhabenden zählen könnten. Der Rest der Gesellschaft – also die Mehrheit – kam in diesem Modell jedoch nur als Arbeitskraft im Produktionsprozess vor. Thatcher mag von Freiheit gesprochen haben – zugleich schuf sie jedoch eine Gesellschaft, die auf Unfreiheit basiert: nämlich auf der vermeintlichen Wahl zwischen Niedriglohn und Mittellosigkeit.
Die ideologische Auseinandersetzung zwischen individueller Freiheit und kollektiver Gerechtigkeit diente den Neoliberalen als Deckmantel, um dahinter ungestört die Klassenstruktur der britischen Gesellschaft zu verhärten. Menschen mit mittleren Einkommen wurden in Minikapitalistinnen und Minikapitalisten verwandelt und zugleich eine marginalisierte Klasse prekärer, schlecht bezahlter und hoch verschuldeter Arbeiterinnen und Arbeiter erzeugt.
»Das Wohneigentum war der entscheidende Faktor, der Thatcher demokratische Unterstützung für ihr Programm einbrachte – und es ist seither ein wichtiger Indikator für das Wahlverhalten der Menschen geblieben.«
Doch während sich die Gesellschaft ökonomisch zunehmend polarisiert hat, scheint diese Trennung politisch in den Hintergrund gerückt zu sein. Indem der Thatcherismus das Eigentum an Vermögenswerten auf Haushalte mit mittleren Einkommen ausgedehnte, hat er das Bewusstsein der Menschen für die Trennung zwischen den Klassen geschickt vernebelt. Mit der Ausweitung des Wohneigentums und der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes hatte man die Mittelschicht überzeugt, sich auf die Seite des Eigentums anstatt auf die Seite der Arbeit zu stellen.
Ein zentrales Element des finanzgetriebenen Wachstumsregimes besteht darin, dass nicht mehr die Löhne, sondern das Privatvermögen und der Zugang zu Krediten die entscheidenden Faktoren für das Wohlstandsempfinden vieler Haushalte darstellen. Wenn Haushalte in Schwierigkeiten geraten, dann nehmen sie viel eher Kredite auf, als dass sie nach höheren Löhnen verlangen. In ihrer Zukunftsplanung verlassen sich diejenigen, die Eigenheime besitzen und über eine private Altersvorsorge verfügen, eher auf diese Vermögenswerte als auf den Sozialstaat.
Mit anderen Worten: Die Finanzialisierung der Haushalte der Menschen hat ihre Wahrnehmung der Wirtschaft radikal individualisiert, sodass sie bei der Verbesserung ihrer Lebensstandards eher auf ihr persönliches Finanzmanagement als auf kollektive politische Mobilisierung setzen. Anstatt dass die Menschen Lohnerhöhungen fordern – so hätte Thatcher ihre Politik kommentieren können – »sollen sie doch Häuser essen«.
Die Fassade bröckelt
Die Konservativen bauten unter Thatcher eine große und stabile Wählerbasis für ihre Politik auf, indem sie ein Bündnis zwischen den Besitzerinnen und Besitzern von Wohneigentum und dem reichsten einen Prozent der Gesellschaft schmiedeten. Menschen mit mittleren Einkommen konnten sich in dieser Zeit Eigenheime kaufen und ihre Ersparnisse an den Aktienmärkten anlegen, um an den Profiten des Kapitals mitzuverdienen.
Bankerinnen und Finanziers verdienten durch Hypothekenkredite und Verbriefung riesige Summen, während die Mittelschicht vom wachsenden Wohlstand profitierte. Die ersteren brachten das Geld mit, die letztere sorgte für Wahlerfolge. Zwar bilden diese beiden Gruppen keineswegs die Mehrheit der britischen Bevölkerung, jedoch haben sie sich als eine außergewöhnlich mächtige Minderheit erwiesen.
Das Wohneigentum war der entscheidende Faktor, der Thatcher demokratische Unterstützung für ihr Programm einbrachte – und es ist seither ein wichtiger Indikator für das Wahlverhalten der Menschen geblieben. Ob man ein Eigenheim besitzt oder nicht, ist nach wie vor eines der verlässlichsten Anzeichen für die Wahlabsichten: 2017 wählten 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Haushalten mit Wohneigentum die Konservativen und 51 Prozent der Mieterinnen und Mieter die Labour Party.
Als die Hauspreise nach der Finanzkrise zu fallen begannen, dachten viele, das wäre das Ende der britischen Immobilienblase. Wegen der extrem lockeren Geldpolitik sind die Hauspreise und die Verschuldung der privaten Haushalte jedoch auch nach 2007 weiter gestiegen. Das hat geholfen, die Fassade der »Property-Owning Democracy« aufrechtzuerhalten, während der Kern dieser Idee längst marode geworden ist. Die Eliten wollen diese Krise bewältigen, indem sie zu ihrem eigenen Schutz die arbeitende Bevölkerung spalten, also die Armen unter Druck setzen und gleichzeitig die Mittel- und Besserverdienenden in Schutz nehmen. Doch diese Strategie gerät zusehends ins Schleudern.
Die Ausweitung des Wohneigentums und der damit einhergehende Anstieg der Immobilienpreise, die zwischen 1980 und 2007 in Großbritannien zu beobachten waren, lassen sich in dieser Form nicht mehr wiederholen. Die Zahl der 25- bis 34-Jährigen mit mittleren Einkommen, die Wohneigentum besitzen, ist inzwischen rückläufig. Die Entwicklung der Hauspreise ist dermaßen von der Entwicklung der Löhne entkoppelt, dass es sich die meisten jungen Menschen überhaupt nicht leisten können, Wohneigentum zu erwerben. Viele von ihnen haben sich inzwischen an den Gedanken gewöhnt, dass sie nie ein Eigenheim besitzen werden.
Die jungen Leute wissen heute, dass sie vom Fortbestand des gegenwärtigen Systems wenig zu erwarten haben, auch wenn sich ihre Eltern weiterhin an den Status quo klammern mögen – in der Hoffnung, den Wert ihres Vermögens zu schützen. Doch da die Hauspreise fallen, die Rentenkrise eskaliert und die Löhne weiterhin stagnieren, wird auch diese Generation wahrscheinlich bald einräumen müssen, dass es eine bessere Wirtschaftsweise geben könnte.
Dieser Auszug aus Kapitel III von »STOLEN« erschien zuerst im Jacobin Magazin »Enteignet!« (Nr°5/2021).