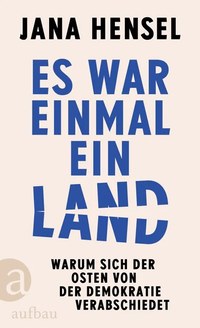Häufig reden wir über Politik, als hätte sie nichts mit uns zu tun. Als wäre sie eine Angelegenheit der Vergangenheit oder der Zukunft – aber keine, die uns im Hier und Jetzt betrifft. Als wären politische Machtfragen Kämpfe, die fernab von uns stattfinden. Als wären wir nicht Teil von politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Von Krisen und den politischen Maßnahmen, mit denen auf sie reagiert wird. Dabei kämpfen die allermeisten von uns jeden Tag. Ringen in ihrem Alltag um Halt und Wirksamkeit. Kämpfen gegen die Angst vor dem sozialen Abstieg, um die eigene Existenz. Kämpfen für Gerechtigkeit, für ihre Familie, für ihre Freund*innen, gegen Unterdrückung und für ein gutes Leben, für sich und für andere. Die wenigsten Menschen, denen ich begegne, sind gleichgültig. Im Gegenteil. Die Ohnmacht ist das Schlimmste. Überall, wo ich hinsehe, sehe ich Baustellen. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fühle mich wirksam im Kleinen, ja. Aber im Großen nie, sagt N. am Frühstückstisch.
Sie blickt an mir vorbei aus dem Fenster. Ich frage mich, wie oft sie schon kurz davor war, einfach aufzugeben und es dann doch nicht getan hat. Und umgekehrt: Wie viele eigentlich kurz davor sind, anzufangen, sich mehr einzumischen und der eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Was es bräuchte, um die vermeintlich sichere Ausweglosigkeit ins Wanken zu bringen. Wenn ich wüsste, jetzt, morgen passiert was, na klar, dann würde ich auf die Straße gehen. Aber irgendwie ist das alles so weit weg. Und mir geht es, auch wenn das ekelig klingt, ein bisschen zu gut, erzählt S. Mit Sätzen wie diesen bauen wir künstlich Distanz auf zwischen uns und der Politik, zwischen uns und den ökonomischen Verhältnissen, zwischen heute und dem Zeitpunkt, an dem es zu spät sein wird, zu reagieren, zwischen der Politik und dem Privaten. Wir erhalten einen fiktiven Normalzustand aufrecht, den niemand erklären, genau definieren oder fühlen kann. Aber wer nicht benennt, wo das Normale aufhört, kann eben auch keine Aussage darüber treffen, wo die Krise beginnt, die der Anlass für den Kampf und für den Aufruf zum Handeln ist. Und so managen wir den implodierenden Normalzustand zu Tode, auf den Moment wartend, in dem wir einschreiten müssen. Wir verpassen diese Momente, täglich, stündlich, minütlich.
B. sagt mir: Vor der nächsten Bundestagswahl sind meine Taschen gepackt. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, dass ich wegkann, wenn ich muss. Und: Ich habe Angst, dass meine Familie und ich nicht mehr sicher sind. Der Hass, der Rassismus … Wo soll ich denn hin, wenn ich nicht hierbleiben kann?, berichtet wieder ein anderer. Ich schweige – weil mir nichts einfällt, was ich darauf antworten könnte. Das ist er also, dieser Normalzustand. Viele haben vor dieser Normalität kapituliert, haben die Hoffnung auf Veränderung irgendwann für illusorisch erklärt. Diejenigen, die in den letzten Jahren alles darangesetzt haben, Veränderungen zu erkämpfen, mussten dafür ihre eigenen Grenzen immer und immer wieder überschreiten. Und die, die nicht in der privilegierten Situation sind, sich aussuchen zu können, ob sie politisch sein wollen, tun das erst recht. Weil ihre persönlichen Grenzen ständig von anderen überschritten werden. Beispielsweise, weil sie wegen rassistischer Übergriffe und Anfeindungen in politische Konfliktsituationen geraten und damit nie »dem Politischen« entgehen, weil es bei politischen Konflikten schlicht und einfach um ihr Überleben geht oder weil ihr Körper, ihre Freiheit und ihr Lieben politisch verhandelt wird.
Ich kenne so viele, die in den letzten Jahren ausgebrannt sind. Mit diesem Gedanken im Kopf frage ich H., was das Bewusstsein über all das mit ihr macht. Sie setzte sich schon gegen die Klimakrise ein, lange bevor ich überhaupt etwas davon gehört habe. Und dabei sind wir gleich alt. Irgendwann wurde es ihr zu viel. Das ist eine so unglaublich große Last auf meinen Schultern, und die werde ich nicht mehr los, nie, sagt sie. Tage nach unserem Gespräch schreibt sie mir: Unser Gespräch lässt mich nicht mehr los. Heute habe ich die Nachrichten angeschaut und musste mittendrin aufhören. Ich kann das nicht mehr. Alles in mir sträubt sich dagegen, mich dem weiter auszusetzen. Weil es mich zerreißt. Und trotzdem: Mein Gewissen zwingt mich dazu. Also werde ich wohl bald wieder anfangen, mich einzumischen. Manchmal übermannt die Realität uns. Ich glaube, fast jede*r von uns kennt solche Momente. A. und ich haben oft darüber gesprochen, aber häufig abstrakt statt konkret. Bis wir uns an einem Abend um kurz vor Mitternacht voneinander verabschieden und er eine Viertelstunde später wieder vor der Tür steht.
Ich komme gerade nicht so ganz mit der Situation klar, hat er mir zuvor in einer Nachricht geschrieben. Und dann versuchen wir, gemeinsam klar- und durch die Nacht zu kommen. Eine Nacht, in der keine Katastrophe stattgefunden hat – sondern »nur« mal wieder eine Wahl. Und ich erinnere mich an Momente als Teenagerin, in denen ich nach den ersten Wahlprognosen zur Bundestagswahl meine Eltern für all das verantwortlich machte, was ich in dem Säulendiagramm im Fernsehen auf mich zukommen sah. An Gespräche mit allen möglichen Menschen, die erst bekundeten, die Welt da draußen, die Krisen, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse – das gehe sie alles gar nichts an. Und aus denen im nächsten Moment die Erzählungen und Geschichten und mit ihnen die Hilflosigkeit, die Betroffenheit, die Wut, die Angst, der Schmerz hervorbrachen. All das ist meistens so viel näher an der Oberfläche, als wir zugeben wollen.
Zum Beispiel bei T., mit der ich über einen Bekannten spreche, der vor einer Weile arbeitslos geworden ist. Aber das wird schon gut gehen. Er muss sich ja nur kümmern, sagt sie. Bist du sicher?, entgegne ich. Nach einem kurzen Schweigen reden wir weiter – über Arbeitslosigkeit, Armut, die Angst vor dem sozialen Abstieg und darüber, was das bedeutet und was eine Gesellschaft, die das ignoriert, mit Menschen macht. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, frage ich: Hast du das Gefühl, dass du früher arm warst – und was bedeutet das für dich heute? Und ich höre, wie sie am Telefon anfängt zu weinen. Sobald wir uns für Menschen öffnen, entsteht eine tiefere Verbundenheit, als wir vermutet hätten. Einige Male laufe ich an C. vorbei, der vor meiner Bankfiliale steht, jeden Tag, und um Geld bittet. Irgendwann einmal bleibe ich stehen.
Ich habe nichts, sagt er. Und ja, vielleicht ist das okay so. Ich will nicht einmal großartig Hilfe. Aber schau sie dir alle an: Sie schaffen es nicht einmal, mich anzusehen. Jetzt schwemmt diese Krise über uns hinweg, und natürlich wird die Wirtschaft gerettet. Was ist mit den Hilfen für Arbeitslose, für Arme, für Geflüchtete? Ihr geht demonstrieren – aber was ändert das denn? Das ist doch kein Zufall, das ist ein Scheißsystem. C. hat die Situation so viel besser zusammengefasst, als ich es könnte. Er fragt mich, was ich so mache den ganzen Tag. Und ich erzähle ihm, dass ich »so politisches Zeug« mache und gerade an einem Buch schreibe, das sich im Wesentlichen an seine Analyse anschließen soll. Na ja, versuch es mal, entgegnet er. Ich glaub ja nicht, dass es was bringt. Es gibt verschiedene Nuancen dieser Aussage, und sie kommen häufig vor. Ich kann gerade nicht mehr. Ich habe die Schnauze so voll. Es gibt auch: Heute hat sich etwas für mich verändert. Ab jetzt mach ich etwas anders. In diesem Moment bin ich fest überzeugt, dass Veränderung möglich ist. Aber eben deutlich seltener.
Obwohl das »Ich« in diesen Sätzen eine Menge zu sagen hätte, reden wir über gesellschaftliche Krisen, als würden sie nur im Fernsehen und in Zeitungen existieren oder in Science-FictionRomanen. Oder wir verdrängen sie, wieder und wieder, als wäre Gleichgültigkeit eine Option. Aber das ist sie nicht – denn jede Krise betrifft sehr viele Menschen. Mal in unserer unmittelbaren Nähe, mal weiter von uns entfernt, mal uns selbst. Wie häufig, ist davon abhängig, in welcher gesellschaftlichen Position wir sind.