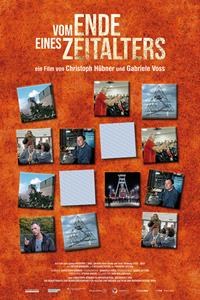C.H. und G.V., Sie sind für ihre filmischen Arbeiten immer wieder ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Oder sind Sie nie weggegangen? Was hat sie so fasziniert?
GV: Den ersten Film im Ruhrgebiet, „Huckinger März“, haben wir von München aus gemacht, wo wir beide damals studierten. Es ging um einen wilden Streik bei Mannesmann in Duisburg Huckingen, von dem wir in einem dokumentarischen Spielfilm erzählt haben. Das war 1973. Die Begegnung mit den Menschen im Ruhrgebiet hat dann Interesse für Weiteres geweckt. Mit Abstand von ein paar Jahren nahmen wir uns dann fünf Jahre für die Region vor. Daraus sind inzwischen mehr als 40 Jahre geworden, ohne dass es dafür einen Plan gab.
CH: Als wir ins Ruhrgebiet gegangen sind, war ein Impetus eine bestimmte Art der dokumentarischen Filmarbeit, so etwas wie ‚filmische Geschichtsschreibung‘. Dahinter stand auch die Vorstellung von Kontinuität. Es war ein starker Wunsch von mir, dass es eine Art kontinuierliches Drehen gibt, öffentlich gefördert, als Dokumentation des alltäglichen Lebens – wie lebt das Leben? Das hat mit den Menschen und der Region zu tun, aber auch mit dem Versuch, etwas aufzubauen – eine Art Zentrum filmischen Arbeitens. In einer Region, die immer im Schatten stand und vollgeladen war mit Klischees, Rauch und Ruß, Zechentürmen und Stahlabstichen. Dem wollten wir etwas entgegensetzen. Wir wollten uns auf die Menschen einlassen, die hier leben, auch wenn alles brüchig ist. Die Brüchigkeit findet sich auch in unseren Filmen wieder. Das Ruhrgebiet ist keine geglättete Region, es ist eher reizvolle Anarchie.
G: Gleichzeitig sind unsere Filme nicht nur im Ruhrgebiet entstanden. Obwohl manche Leute uns immer ‚Ruhrgebiets-Chronisten‘ nennen. Mindestens die Hälfte unsrer Filme ist nicht im Ruhrgebiet entstanden. Die Beschäftigung mit dem Ruhrgebiet war für mich wie eine Reise in eine nahe, aber fremde Welt. Andere fahren nach Afrika. Wir gingen ins Ruhrgebiet. Diese fremde Welt ist nicht mit einer einzigen Reise erschöpft. ‚Filmische Geschichtsschreibung‘ kann man in jeder Region machen. Wir haben uns das Ruhrgebiet ausgesucht.
Kann man sich eine Langzeitdokumentation wie Ihre Arbeiten zum Ruhrgebiet wie eine wissenschaftliche Forschung vorstellen, die immer neue Fragen entdeckt?
CH: Nein, wissenschaftlichen Kriterien können und wollen wir nicht genügen. Die LangzeitProjekte, die wir gemacht haben, ob in Bottrop mit „Prosper/Ebel“ von 1978 – 2022 oder mit „Champions“, der Fußballtrilogie von 1998 bis 2018, oder auch die „Emscherskizzen“ von 2006 bis 2015 zeigen: Es ist alles Wandel. Uns interessiert, was der Wandel mit den Menschen macht. Der junge Fußballer, der im ersten Film der Trilogie wie der Gewinner aussieht, ist im nächsten Film schon der Verlierer. Und am Ende aller drei Filme bleibt die Frage, was das überhaupt ist – ein Gewinner oder ein Verlierer. In Bottrop-Ebel sieht man wiederum, wie soziale Zusammenhänge, die sich durch die gemeinsame Arbeit untertage über Jahrzehnte gebildet haben, mit Schließung der Zechen langsam zerfallen. Was danach kommt ist eine offene Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben? All das wird sichtbar durch die Kontinuität der Projekte über Jahre – es ist tatsächlich so etwas wie filmische Geschichtsschreibung. Wir haben uns für bestimmte Projekte 10, 20 und im Falle des „Prosper/Ebel-Zyklus“ über 40 Jahre Zeit genommen. Natürlich immer mit Unterbrechungen. Und die Zuschauer müssen sich für unsere Filme auch viel Zeit nehmen, wenn sie diesen Wandel erfahren wollen – auch in kleinen, sehr konkreten Details.
Erfährt man in Ihren Filmen von den Herausforderungen, die man mit dem Begriff Strukturwandel umschreibt? Vom Arbeitskampf in den 80ern bis zum altersbedingten Auseinanderfallen der sozialen Netze.
G: Man erfährt sicherlich davon, obwohl wir nicht von Überschriften oder Themen ausgehen. Uns geht es um die Menschen, die ihr Leben meistern mit allen Schwierigkeiten. Wenn es eine Überschrift oder ein Motto für unsere Arbeit im Ruhrgebiet gibt, könnte man auf den amerikanischen Dokumentarfilmer Robert Flaherty zurückgehen, der sagt: „Aufgabe des Dokumentarfilms ist es, das Leben zu zeigen, wie es gelebt wird.“ Die Menschen in unseren Filmen erfahren den Strukturwandel, auch wenn sie ihn als solchen nicht explizit thematisieren. Sie sprechen eher von Veränderungen, von Verlusten, die sie bedauern, von Brüchen, von Hoffnungen, die sie sich für die Zukunft machen.
Ihre Protagonisten kennen Sie teilweise seit 40 Jahren. Sie folgen ihnen konsequent bis auf den Friedhof. Viele der Gräber sind schon wieder freigeworden. Wie geht Ihr Film mit dem Verschwinden seiner Protagonisten um?
CH: Den letzten Film zum Prosper/Ebel-Zyklus, den wir gerade fertiggestellt haben, kann man als einen Film über Vergänglichkeit sehen. Das dachte ich in dem Moment, als wir an den Gräbern von vielen vorbeigingen, die wir vor 40 Jahren in Ebel kannten. An manchen Stellen standen Schilder: „Gräber, die bis Ende 1998 belegt wurden, werden Anfang 2019 eingeebnet.“ Die „Nutzungsberechtigten“ wurden aufgefordert, ihre Gegenstände von den Gräbern zu entfernen. In dieser bürokratischen Sprache hatte das eine merkwürdige Anmutung.
G: Nicht viele Menschen, die auf dem Friedhof Dellwig beerdigt sind, wurden älter als wir jetzt sind. Dies habe ich mit einem gewissen Schrecken wahrgenommen, als wir dort drehten. Das Grab von Herbert Jaskulla, der im Jahr 2000 gestorben ist, das wir im Jahr 2020 noch filmten, wird Ende Dezember 2021 eingeebnet. Das Nicht-Sein, diese Möglichkeit, ist für mich im Moment noch unvorstellbar. Noch unvorstellbarer ist es für mich, dass mit Einebnung der Gräber einst alle Spuren von diesen Leben verschwunden sein werden. Da tröstet es mich, dass es immerhin unsere Filme gibt.
Sie zeigen wie mit Prosper V die letzte Zeche geschlossen wird, es gibt eine Seilfahrt in Realzeit bis in eine Tiefe von ca. 1200 Metern am Anfang ihres neuen Films. Sie zeigen wie ein Schacht mit Beton verfüllt wird. Irgendwo sagt ein RAG-Mitarbeiter: „Das werden wieder landwirtschaftliche Flächen, vielleicht mit einem Gedenkstein ...“
G: Der Mann sagt, dass an der Stelle von Schacht 10 in ein paar Jahren eine Wiesenfläche zu sehen sein wird, Waldaufforstung, vielleicht ein Gedenkstein an der Straße. Mehr nicht. Er mag sich diesen Zustand nicht vorstellen, aber es werde so kommen. Das Gelände werde der Natur wieder zurückgegeben, sagt der Mann. Einer der Berglehrlinge von Prosper, mit denen wir Anfang der 80er Jahre drehten, fuhr 1981 auf eben diesem Schacht zu seiner ersten Schicht untertage an. Erst kurz davor war der Schacht in Betrieb genommen worden. Und den Berglehrlingen wurde damals gesagt: „Hier werdet ihr den Rest eurer 40 Jahre verbringen“. Gemeint war das Arbeitsleben. Noch bevor 40 Jahre vergangen waren, wurde die Kohleförderung 2018 eingestellt. Ein Arbeiter, der die Schachtverfüllung überwacht, sagt zu uns, als wir in seiner Kabine drehen: „Jetzt machen wir die Zechen zu. Das ist ein bisschen komisch, wenn man so kommt und alles leer ist, die Kaue nicht mehr da ist. Aber das ist ja was Gutes für unsere Umwelt. Zwar bleiben da weniger Arbeitsplätze, aber man muss sich öfter im Leben durchschlagen.“
Richtet sich ihr Film gegen das Verschwinden? Ist er eine virtuelle Verlängerung des Arbeitskampfes ihrer Protagonisten in den 80ern?
CH: Nein, die Arbeitskämpfe sind ausgestanden, der Beschluss, die Zechen im Ruhrgebiet zu schließen, wurde schon im Jahr 2009 gefasst. Die Bergleute wissen davon seitdem. Die größte Sorge derjenigen, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren und die Zechen zumachen ist die, dass man das, was sie leisteten, vergessen könnte, dass außer musealen Gegenständen nicht viel von ihnen bleiben wird. Unser Film ist sicherlich ein Zeugnis gegen dieses Vergessen. Er ist ein Dokument dieser Zeit. Und er wird in Zukunft mit wachsendem zeitlichen Abstand wahrscheinlich noch einmal mehr daran erinnern, wie Menschen im Bergbau hier im Ruhrgebiet gearbeitet, gelebt und gedacht haben.
Neben dem Rückbau der Zeche selbst versuchen Sie auch zu zeigen, was in der ehemaligen Zechensiedlung Bottrop-Ebel passiert, die mit Öffnung des ersten Schachtes, Prosper I, gebaut wurde. Neue Wohngebiete entstehen zwischen den Reihenhäusern der Bergleute. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?
CH: Um diese neuen Häuser zu bauen, wurde von den großen Gärten hinter den alten Zechenhäusern, die den Bergleuten zur Selbstversorgung dienten, Bauland abgezweigt. Selbstversorgung gibt es kaum noch. Stattdessen sieht man Ziergärten und, wo früher ein weiter Blick über die Gärten der Nachbarn möglich war, stößt das Auge heute auf blickdichte, hohe Zäune oder Hecken. Ich glaube, darin drückt sich ein gewandeltes Lebensgefühl aus. Das Gemeinschaftsgefühl, wir gehören zusammen, das auch durch die gemeinsame Arbeit untertage gestiftet wurde, gibt es so nicht mehr. „Es war wie auf dem Dorf“, sagt jemand im Film. Und so gab es Gemeinschaft und auch Kontrolle. Heute ist jeder mehr für sich. Und das stellt neue Herausforderungen an eine gute Nachbarschaft.
Verkraftet der Stadtteil den Wandel? Wird er auch für Neuzugezogene attraktiv bleiben?
G: Das wird sich zeigen. Wir haben auch mit Neuzugezogenen gesprochen, die wünschten, dass man wieder mehr für die Gemeinschaft tut, dass man im Stadtteil neue Aktivitäten entwickelt, an denen alle teilhaben können. Die evangelische und katholische Kirche, die früher Treffpunkte für die Bürger waren, sind beide geschlossen. „Heute ist Ebel ein Stadtteil für junge Familien!“, sagt eine jüngere Frau zu uns. Vielleicht gehen Stadtteil-Aktivitäten in Zukunft eher von jungen Familien aus, die Kinder in der Schule und im Kindergarten haben. Dort lernen sich Alteingesessene und Neuzugezogene auch kennen. Interessant für den Wandel sind auch die Debatten um den Fußballplatz. In der Stadt Bottrop überlegt man, den Sportplatz zu schließen, weil zunehmend Individualsport betrieben werde. Dagegen protestieren die Ebeler. Man sieht im Film bei einer Bürgerversammlung, was sie stattdessen wünschen: eine Sportanlage, auf der Jung und Alt Sport betreiben können. Wir sehen im Film auch, wie sich die Rolle des Fußballs für den Stadtteil über die Jahre verändert hat.
Machen die Pläne der Raumplaner Sinn, die den Stadtteil im Rahmen des Projekts „Freiheit Emscher“ weiterentwickeln wollen, oder werden Visionen über die Köpfe und Bedürfnisse der Menschen hinweg entwickelt?
G: Es ist immer die Gefahr bei solchen Planungen, dass mit dem Blick von außen Zentren und Orte der Begegnung geplant werden, die dann von der Bevölkerung nicht angenommen werden. Aber es gab immer wieder Versuche in Form von Bürgerbefragungen, deren Wünsche in die Planungen einzubeziehen. Ob sie am Ende berücksichtigt werden, ist schwer vorauszusagen.
Das Ruhrgebiet galt nie als Kandidat für einen Schönheitspreis. Vielen seiner alten Bewohner, die von ihnen porträtiert werden, sieht man ein Leben voller harter Arbeit an.
CH: Ja, das hat uns am Ruhrgebiet aber auch gereizt. Es ist eine ausgeraubte, gebrauchte Landschaft und zeigt seine Wirklichkeit sehr offen. Man geht auch mit den anstehenden Problemen offen um. Es ist ein Gebiet, in dem lange Zeit das Wohl von Menschen, Landschaft und Natur nicht im Vordergrund stand. Ganz oben standen immer die Belange der großen Unternehmen von Kohle und Stahl. Mit dem Ende des Industriezeitalters und den Gefahren des Klimawandels, wandelt sich die Perspektive auf Menschen, Landschaft und Natur. Im Film ist zu sehen, wie man mit den Hinterlassenschaften des Kohlebergbaus umgeht. Der Umbau des ehemaligen Berne-Klärwerkes in Ebel zum öffentlichen Park mit Gastronomie ist geleitet von dem Gedanken, dass man Altes nicht immer verwerfen muss sondern damit auch etwas Neues schaffen kann. Das Publikum wird selber sehen, ob es diese Versuche gelungen findet oder nicht.
Sie müssen mit ihrer Kamera gar nicht lange warten bis die Gesichter und Stimmen durch das Erlebte und das Erzählen davon anfangen zu leuchten.
CH: In Alltagsgesprächen hat man oft das Gefühl, dass die Teilnehmer sich gegenseitig gar nicht wahrnehmen. Jeder ist mit sich beschäftigt, wartet darauf, dass der Andere fertig wird, damit er selbst etwas sagen kann. Uns geht es in unseren Filmen darum, das Gegenüber vor der Kamera wirklich wahrzunehmen. Wir merken sehr oft bei Dreharbeiten, wie groß das Bedürfnis nach Wahrnehmung und Gehört-Werden bei den Menschen ist, wohl deshalb, weil das nur selten geschieht. Damit das möglich wird, muss eine offene Situation entstehen, in der eine Atmosphäre der Konzentration, der Selbst-Sicherheit, des Inoffiziellen entsteht, ein Raum auch für Zögern, für Pausen, für das Suchen und Finden von Gedanken, die zu sagen sich lohnen. Man muss den Rhythmus des Anderen im Sprechen erspüren. Es ist eine Frage der Empathie, des Respekts, des Zuhörens und der Fähigkeit zur ‚Resonanz‘, zum ‚MitKlingen‘. Wenn jemand das Gefühl hat, in diesem Sinne wirklich wahrgenommen und gehört zu werden, dann entsteht Vertrauen, und Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, vom Anderen zugelassen zu werden in seine Welt. Diese Vertrauensbildung braucht allerdings auch Zeit. Und dann fangen Stimmen und Gesichter an zu leuchten und man erfährt vom Anderen etwas Eigenes, sehr Lebendiges.
Sind sie mit Ihrer Kamera auf der Suche nach einer besonderen Form von Würde?
G: Vielleicht kann man sagen, dass wir uns um eine Würdigung der Menschen bemühen, denen wir in unseren Filmen begegnen. Es sind ja oft Menschen, die normalerweise nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen. Ein Kohlehauer sagte damals in den 80er Jahren bei Dreharbeiten zu uns: „Wenn ich den Haufen Kohlen sehen sollte, den ich in meinem Leben gemacht habe, ich glaube, ich würde umfallen: So was kann ein Mensch machen!“ Tausende gibt es, die mehr oder weniger ungesehen auf den Hütten und Zechen die schwere Arbeit verrichteten und damit zum Wohlstand aller beitrugen. Viele Bergleute bezahlten bei dieser Arbeit mit ihrer Gesundheit oder sogar mit ihrem Leben. Was diese Menschen für alle geleistet haben, sollte man nicht vergessen und entsprechend würdigen, auch wenn man heute weiß, dass das Verbrennen fossiler Energien für den Klimawandel mit verantwortlich ist.
In einem aktuellen Spielfilm „Ein ganzes Leben“ nach dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler, den ein geschickter Vermarkter direkt als Jahrhundertroman einführt vermutlich weil er das Leben eines 80jährigen Protagonisten begleitet erzeugen Landschaftsbilder und Filmmusik das Pathos des Films, in ihrem Film hört man nur ab und zu eine Mundharmonika.
CH: Pathos ist nicht unsere Sache. Wir halten es lieber mit Roberto Rosselini, der sagte: „Um die Wahrheit zu sagen, darf man nicht unterstreichen.“ Pathos ist für mich wie ein ErsatzKlebstoff, der Dinge zusammenhält, die ohne Pathos auseinanderfallen. Und Filmmusik hat ja oft die Funktion, die Gefühle des Publikums in eine bestimmte Richtung zu lenken. Natürlich bauen wir unsere Filmerzählungen auch auf eine bestimmte Weise und lenken damit Wahrnehmung und Gefühle. Uns ist dabei aber immer auch wichtig, dass eine gewisse Freiheit bleibt, zu schauen und zu hören und eigene Gefühle zu entwickeln während des Schauens, oder auch mit Fragezeichen aus dem Film zu gehen: „War das jetzt traurig, was ich da gesehen habe? War es schön oder ist es ganz anders?“ Unsicherheit darf bleiben, es muss nicht alles eindeutig sein.
G: Die Mundharmonika, die man im Film hört, wird von einem zweiundneunzigjährigen ehemaligen Bergmann gespielt. Wir schauen zunächst zu, wie er spielt und dann erzählt er, wie er das Mundharmonika-Spiel von seinem Vater erlernte. Später im Film kommt die Musik noch ein-, zweimal, aber da wissen wir, woher sie kommt. Der Mann war Mitglied des Mundharmonika-Klubs von Bottrop-Ebel, der zu verschiedenen Anlässen in Ebel, aber auch in anderen Zechensiedlungen auftrat. „Musik war immer in Ebel“, sagt an anderer Stelle ein Trompeter, der zusammen mit seiner Frau auf einem Balkon in Ebel das „Glück-auf!“-Lied spielt. Welche Bedeutung die Musik hatte, haben wir selbst erfahren, als wir Anfang der 80er Jahre in Ebel filmten. Da gab es noch eine größere Blaskappelle, die zu Festen aufspielte und in Umzügen zu verschiedenen Anlässen durch die Ebeler Straßen zog. „Ebel konnte ohne Musik nicht leben“, sagt der Trompeter auf dem Balkon, „es war eine schöne Zeit.“ Aber auch diese Zeiten sind vorbei. Es wird etwas Anderes kommen. Die Zukunft hat schon begonnen.