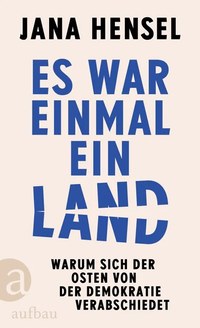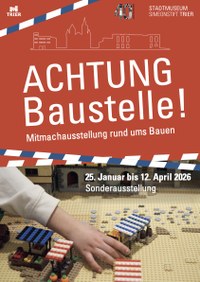Die französische Schriftstellerin Marie NDiaye ist die Tochter einer Französin und eines Senegalesen, den sie nie kennen lernte. Einige ihrer Romane und Theaterstücke sind ins Deutsche übersetzt worden. Für ihren Roman Trois femmes puissantes (Drei mächtige Frauen) erhielt sie soeben den renommierten Prix Goncourt. Als Schwarze und Frau kritisiert sie energisch das fremdenfeindliche politische Klima und nennt das Frankreich Sarkozys „monströs“; die herrschende Atmosphäre sei geprägt – so die Schriftstellerin –von „Überwachung und Vulgarität“, was sie und ihre Familie zum Umzug nach Berlin bewogen habe.
Darüber ärgerte sich der konservative Abgeordnete Eric Raoult, der überregional bekannt wurde, als er bei den Unruhen im Herbst 2005 über die Stadt Raincy ein Ausgehverbot verhängte. Jetzt schrieb er dem Kulturminister Frédéric Mitterrand einen Brief, in dem er von diesem verlangte, Goncourt-Preisträgern eine „Schweigepflicht“ und „ein Gebot zur politischen Mäßigung“, wie es für Beamte gilt, zu auferlegen.
Der Kulturminister antwortete recht zahm auf die Zumutung: „Die Sache“ beschäftige ihn “zwar als Bürger, aber nicht als Minister“, sagte Mitterrand Le monde. Sowohl der Brief des Abgeordneten wie auch die Antwort des Ministers lösten in den Medien einen Entrüstungssturm aus. Nicht nur oppositionelle Politiker wie die Sozialistin Martine Aubry und der Grüne Daniel Cohn-Bendit geißelten das Vorhaben als „Zensur“, sondern auch Mitterrands Amtsvorgänger Jean-Jacques Aillagon.
Der Schriftsteller Christian Salmon sah in Raoults Brief einen Angriff auf die verfassungsmäßig garantierte Meinungsfreiheit und erinnerte daran, dass Raoult bereits vor einem Monat dadurch auffiel, dass er die fadenscheinig begründete Ausweisung einer französischen Journalistin aus Tunesien nicht nur rechtfertigte, sondern die Journalistin obendrein als „psychotisch“, „hysterisch“ und „reif für die Psychoanalyse“ beschimpfte.
Aufgabe verfehlt
Trotz der heftigen Proteste nahm Raoult bis jetzt kein Wort zurück. Vielmehr rechtfertigte er die Attacke auf Marie NDiaye mit dem Hinweis, der Präsident sei „weder ein Fußabtreter noch ein Punching-Ball. Und wenn ein Intellektueller in die politische Auseinandersetzung eingreift, muss er die Konsequenzen annehmen.“
Der Goncourt-Preisträger Erik Orsenna verwies seinerseits auf die absurden Folgen einer Schweigepflicht: „In dem Moment, in dem ein Schriftsteller einen Preis erhält, hätte er kein Recht mehr, sich zu äußern, also Schriftsteller zu sein.“ Besonders heftig protestierten Schriftsteller und Intellektuelle wie Atiq Rahimi und Tahar Ben Jelloun, die aus Ländern stammen, in denen Verfolgung und Zensur an der Tagesordnung sind: „Wenn Schriftsteller einem Mäßigungsgebot folgten, würden sie ihre Berufung und ihre Aufgabe verfehlen, sich darum zu kümmern, was sie nichts angeht“ (Tahar Ben Jelloun).
Auffällig ist schon das Vokabular, dessen sich Raoult bedient. Er spricht von „literarischen Fahnenträgern“, „Respekt vor den Institutionen“, „Image des Landes“ und „nationaler Kohäsion“, was wiederum dazu passt, dass Eric Besson, der Minister für „Immigration und nationale Identität“, letzte Woche im Internet eine Debatte über „nationale Identität“ ankurbelte.
Marie NDiaye empfindet das Vorgehen von Raoult als „Beleiding“, reagierte aber gelassen auf die Attacken: „Herr Raoult ist immer an der Grenze zur extremen Rechten.“ Ebenso souverän reagierte der Senatspräsident Gérard Larcher und erinnerte an Voltaire: „Ich bin nicht einverstanden damit, was Sie sagen, aber ich werde bis ans Ende dafür kämpfen, dass Sie es sagen können.“