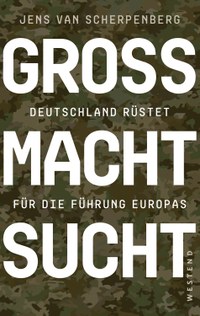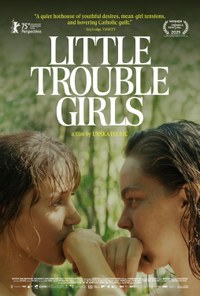Das Thema Vertreibung gehört zu jenen „Aufregerstoffen“, die bereits Wallungen provozieren, bevor die Diskussion überhaupt begonnen hat. Es fällt deshalb schwer, sich einen subtilen Beitrag in diesem Kontext vorzustellen. Dass Subtilität keinesfalls angestrebt wird, macht der Film Habermann schon mit der ersten Szene klar: Dort sieht man Menschen, die von einer Meute anderer Menschen misshandelt, bespuckt und beraubt werden. Die, die ins Gesicht geschlagen und auf den Boden gedrückt werden, tragen Armbinden mit einem N darauf. N steht für „nemec“ – Deutscher. Bei der tobenden Meute handelt es sich um Tschechen. Man hört sie Beschimpfungen ausstoßen, irritierender Weise auf deutsch mit schwerem Akzent. Einer ergreift von irgendwoher ein Hitler-Porträt, stellt es an eine Hauswand und bepinkelt es. Als nächstes packt einer eine schöne Frau und stößt sie mit dem Gesicht hinein. Der zuversichtliche Zuschauer mag denken, dass es sich bei den Szenen um eine ausgefeilte Strategie handeln könnte, nämlich die Larmoyanz der Deutschen („Auch wir waren Opfer!“) schon zu Anfang so zu bedienen, dass ihr sogleich die Puste ausgeht.
Hinterher schämt man sich für so viel Optimismus. Der Film ist gewissermaßen aus der Behauptung heraus aufgebaut, dass es ein überkommenes Bild der Ereignisse im Sudetenland von 1937 bis 1945 gäbe, das die Deutschen sämtlich böse und die Tschechen sämtlich gut darstelle. Mit großer Geste macht sich Habermann nun daran, das Gegenteil zu beweisen: Es gab gute und böse Menschen – sowohl bei den Deutschen als auch bei den Tschechen! Titelfigur August Habermann (Marc Waschke) war etwa ein „guter Deutscher“, es soll ihn wirklich gegeben haben.
Habermann ist ein wohlhabender Mühlenbesitzer, der stolz ist auf seinen deutschen Unternehmerstammbaum und den Tschechen Arbeit gibt. Sein bester Freund ist Tscheche, genauso wie das schönste Mädchen der Gegend, Jana (Hannah Herzsprung), das er, wir schreiben das Jahr 1937, heiraten möchte. Bei der Gelegenheit stellt sich heraus, dass die als Waisenkind im Kloster Erzogene einen jüdischen Vater hat, was Habermann nicht kümmert. Den tschechischen Bürgermeister, der als potentieller Mitläufer vorgestellt wird, dagegen schon. Wie überhaupt jede Figur ein vorgegebenes Argument bedient: Augusts kleiner Bruder Hans ist der überzeugte Nazi, der „heim ins Reich“ will; der Sohn der Hausangestellten das schwarze Schaf, das den Deutschen den Reichtum neidet; SS-Sturmbannführer Koslowski (Ben Becker), der 1938 einmarschiert, der perverse Nazi, der Jana schleimige Angebote macht, den guten August sadistisch zum Schicksal-Spielen zwingt und am Ende feige die Flucht nach Argentinien ergreift. Daneben gibt es tapfere tschechische Widerstandskämpfer, brave deutsche Frauen und was die Mottenkiste noch so hergibt.
Mut zum Gemeinplatz
Angekündigt als deutsch-tschechisch-österreichisches Projekt (Regie führte der in der Slowakei mit jüdischen Wurzeln geborene Regiealtmeister Juraj Herz), das sich derartig paritätisch abgesichert dem Tabu-Thema Vertreibung annimmt, verblüfft der Film durch seinen Mut zum Gemeinplatz: Nein, die Vertreibung war sicher keine gemütliche Angelegenheit. Dass ihr eine Geschichte vorausging, die weiter zurückreicht als ins Jahr 1937, lässt der Film wohlweislich weg. Offenbar hatte man Angst, dass solche Details aus einem „Aufregerstoff“ ein „Langweilerthema“ machen könnten.