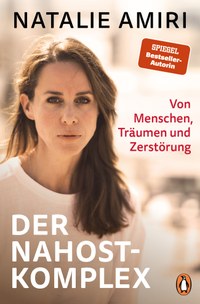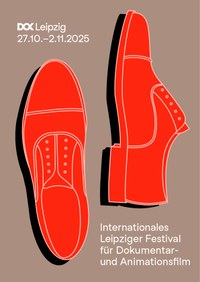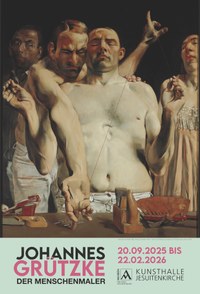Die Wahl war überraschend. Zum einen, weil man an der Preiswürdigkeit von Veiels Film über die RAF-Vorgeschichte von Gudrun Ensslin in ihrer Beziehung zu dem Schriftsteller Bernward Vesper und später Andreas Baader zweifeln muss. Zum anderen, weil die Enttäuschung über den ersten Spielfilm des klugen Dokumentarfilmers Veiel (Black Box BRD, Die Spielwütigen) gerade darin besteht, dass es ihm nicht gelungen ist, eine neue Perspektive auf die fürs Kino sattsam durchbebilderten Jahre des bundesrepublikanischen Terrors zu entwickeln.
Veiel schien geeignet, ja prädestiniert
Lange Jahre hat Veiel an dem Projekt gesessen, das durch Gerd Koenens Sachbuch Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus von 2003 angeregt wurde. In dieser Zeit ist Bernd Eichingers Geschichtsporno Der Baader-Meinhof-Komplex ins Kino gekommen, und allein die PR-Gewalt, mit der die auf Action getrimmte Nachstellung sämtlicher Tagesschau-Bilder zum Thema zwischen 1967 und 1977 durchgesetzt wurde, konnte den Wunsch befördern, anders und damit womöglich genauer über die RAF zu handeln.
Veiel schien ein dafür nicht ungeeigneter, wenn nicht prädestinierter Mann zu sein: Black Box BRD durchbrach 2001 die gängigen Rezeptionsmuster der RAF-Wahrnehmung, indem der Film dokumentarisch die Biografien des in Bad Kleinen getöten RAF-Mitglieds Wolfgang Grams und des 1989 bei einem Anschlag ums Leben gekommenen Deutsche-Bank-Chefs Alfred Herrhausen gegenüberstellte.
Wer wenn nicht wir hält sich mit solcherart Verästelungen nicht auf. Der Film schwenkt umgehend auf die Hauptstraße der Zeitgeschichtsillustrierung ein, die Der Baader Meinhof Komplex zum Exzess betrieben hat. Veiel gelingt es nicht, hinter die Bilder zukommen, die eine auf Ähnlichkeit setzende Fernsehfilmpsychologie geprägt hat und in der Koenens punktuelle Vorlage lediglich als die klassische Dreiecksbeziehung erscheint, mit der die Eventzweiteiler des Fernsehens heute Geschichte erzählen: Gudrun Ensslin (Lena Lauzemis) zwischen zwei Männern (August Diehl, Alexander Fehling). Das produziert Klischees wie die gefühllose Vesper-Mutter und NS-Dichter-Gattin (Imogen Kogge) und lässt letztlich nur die Qualität von Szenen- (Christian M. Goldbeck) und Kostümbild (Bettina Marx) leuchten.
Schön anzuschauende Tapete
Warum Gudrun Ensslin sich für den Untergrund und gegen Mann und Kind entschieden hat, erfährt man aus Wer wenn nicht wir nicht. Auch weil der Film keine Zeit hat, sondern einer durch Inserts deklarierten Chronologie hinterrennt. Das zeitgenössische Dokumentarmaterial (Vietnam, Kennedy, Eichmann, mit Jazz unterlegt) funktioniert nicht als Kommentar, weil die patinösen Fernsehaufnahmen der Zeit wie die Musik zur Revolte schon zigfach den Geist einer Epoche beschwören mussten und darüber zu einer schön anzuschauenden, aber nur mehr dekorativen Tapete geworden sind.
Die Mutlosigkeit von Wer wenn nicht wir, nicht nach Abstraktion oder Fiktionalisierung zu suchen, bedeutet der Umstand, dass von einer fast sechsstündigen Fassung am Ende 124 Minuten übrig geblieben sind. 124 Minuten, in denen man sieht, was man erwartet: die Fakten. Womöglich wäre der dem Schnitt zum Opfer gefallene Rest der interessantere Film.