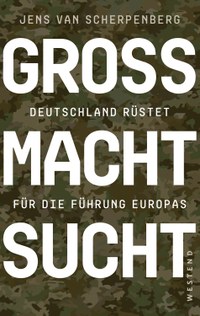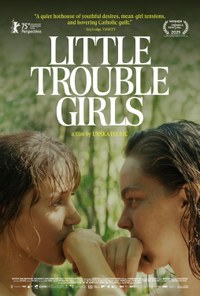Schon diese Sprache. „Potenzialanalyse“, „Performance-Entwicklung“, „weg vom Firefighting, hin zum Coaching“: Es wäre ein Leichtes, sich darüber lustig zu machen. Carmen Losmanns Film Work hard, play hard tut das nicht. Er schaut hin, hört zu. Die Bilder sind von aseptischer Klarheit, halten Abstand, malen Tableaus, der Schnitt bewegt sich wie auf Strümpfen. Nichts ist hektisch oder laut.
Es liegt eine große Ruhe auf dem Gesicht dieser Welt. Carmen Losmann, Absolventin der Kölner Kunsthochschule für Medien, hat sich für Work hard, play hard in die Bürowelten einer Elite-Arbeitnehmerschaft begeben, zu Großkonzernen wie Unilever oder Beratungsfirmen wie Accenture, in die Führungsgruppe der Angestelltenwelt.
Einer Großzahl im Peloton der Lohnarbeit mögen diese Welten fremd erscheinen: Arbeitsplätze, die Architekten schon nach den Zielen des Unternehmens planen („modern und dynamisch“); Heerscharen von Spezialisten, die am Angestelltenkörper stetige Verbesserung zu erwirken versuchen („Assessment-Center“); Freizeitspiele, Behaglichkeitsgefühle, Rundumreflektion.
Die Distanz, die Losmann zu ihrem Gegenstand hält, der Umstand, dass sie sich nicht auf persönliche Geschichten kapriziert, sondern Situationen mit austauschbaren Protagonisten zeigt, ermöglicht einen nüchternen, vorurteilsfreien Blick. Man kann in Work hard, play hard den Punkt ausmachen, an dem eine grundsätzlich positive Anstrengung, die zu anderen Zeiten, in anderen Kontexten als Weiterbildung oder Verbesserung gutgeheißen worden wäre, umschlägt in den Horror einer totalen Optimierung, in eine endlose Therapie, in deren „driver seat“ kein Mensch mehr sitzt.
Was der Zurichtung des Büroarbeiters in diesen Umgebungen, die Wohlgefühl versprechen, aber nicht ans Gemütliche des Zuhause erinnern sollen („keine braunen Farbtöne“), verlorengegangen ist, wenn es das je gab, ist das Subjekt. Die Ausdifferenzierung von Optimierung führt zur Blindheit fürs Ganze. Wenn die Spielleiter eines Betriebsausflugs vor den Monitoren sitzen, auf denen Kameras eine Schnitzeljagd unter Erde übertragen, dann sehen sie nur das Scheitern der Probanden: Sie verrechnen die Lustlosigkeit, mit der die Leute sich durch Tunnel bewegen, die an Sado-Maso-Filmsets oder Dschungelcamp erinnern, als Defizite – und nicht als das Nein gegenüber dieser Art Menschenformung.
Die runterreduzierte, sedierte Sprache, die in Work hard, play hard gesprochen wird, ist bereinigt von negativen Gefühlen: „Thema“ meint Problem, „Entwicklung“ steht für Schwächen, „Prozess“ für Veränderungsdruck. Dem Probanden aber, der dieses Spiel der Temperamentsentleerung zu perfekt beherrscht, wird am Ende bescheinigt, alles Negative zu vermeiden. Die Frau, die bekennt, das Arbeitsleben als Spiel zu betrachten und danach lacht, kriegt unser Mitleid und strenge Blicke der Prüfer – das ist die einzige Stelle im Film, an der die gewaltigen Anstrengungen des Apparats auffliegen könnten.
Carmen Losmann ist ein großer Film gelungen – eine Beschreibung einer Gegenwart, die sich dieser Beschreibung eigentlich entzieht. Dass der dokumentarisch-essayistische Ansatz der beste ist, kann man am Spielfilm ihres Kameramanns Dirk Lütter sehen. Die Ausbildung, letztwöchig gestartet, versucht ein ähnliches Thema als Spielfilm zu erzählen. Und scheitert. Es gibt in diesen Büros einfach niemanden, der „ich“ sagen kann.