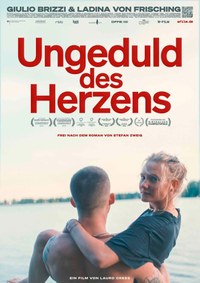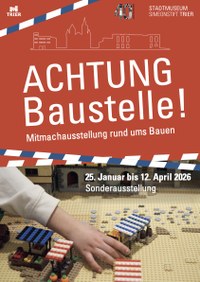Seit 100 Tagen haben die USA einen neuen Präsidenten, seit 100 Tagen wirft er einen solchen Schatten, dass die Opposition dabei zu verschwinden scheint. Von Ausnahmen abgesehen, stößt Barack Obama bisher kaum auf republikanische Gegenwehr. Acht Jahre George Bush fordern ihren Tribut. Die klare Niederlage von John McCain am 4. November 2008 erweist sich im Nachhinein als verheerende Niederlage, weil sie die Republikaner nicht als Verlierer, sondern als klar Geschlagene zurückließ. Sie müssen sich regenerieren und nach einer Botschaft suchen, die ihnen ein neues politisches Existenzrecht verschafft. Augenblicklich ein undankbares Unterfangen, denn wo ist die Alternative zur Politik Obamas? Der tut, was angesichts des Notstands der nationalen Ökonomie getan werden muss. Er hat dem Land das größte Konjunkturprogramm seiner Geschichte beschert und das in nur 25 Tagen nach seinem Amtseid. Er hat dem Staat eine Verantwortung übertragen, die dieser zuletzt in den Jahren des New Deal und während des Zweiten Weltkrieges schultern durfte. Er will trotz Rezession an seiner Gesundheitsreform festhalten, die Finanzmärkte regulieren und eine andere Klimapolitik auf den Weg bringen. Er gibt dabei nicht den aufopferungsvoll ringenden Apostel des Unvermeidlichen, sondern bleibt der glamouröse Star, den eine Aura der Leichtigkeit umgibt, als sei der Wahlkampf noch nicht vorbei. Das Weiße Haus ist genommen, das ganze Land noch lange nicht.
100 Tage Obama – keine Bildergalerie, sondern eine Bilanz aus Mediensicht
Als der Republikaner Ronald Reagan 1981 die Präsidentschaft übernahm, waren die Demokraten ähnlich paralysiert wie heute die Republikaner. Ihr nicht übermäßig von Glück und Geschick verfolgter Präsident Carter hatte ihnen eine fatale Bilanz hinterlassen. Besonders die im April 1980 als dilettantisches Kommandounternehmen gescheiterte Befreiung amerikanischer Geiseln in Teheran, führte ad absurdum, was der Erdnussfarmer mit apodiktischem Furor zum Motiv seiner Amtszeit erkoren hatte: Nach der Niederlage in Indochina sollte Amerika wieder in den großen Werte-Container greifen und davon leben. Die Welt führen dank moralischer Überlegenheit, als hätte es Vietnams verkohlte Wälder nie gegeben. Doch Carter sollte sich verheben. Er schlitterte in den großen Krach mit den Sowjets und regierte am Schluss nicht anders, als es Kennedy, Johnson, Nixon und Ford vor ihm getan hatten und Reagan wieder tat: Amerikanische Vormacht durch militärische Stärke begründen. Das übliche Rezept. Als der Sowjetunion Gorbatschows nicht ganz unerwartet der Atem ausging, hatte Reagan den erwünschten Erfolg.
Barack Obama ist auf völlig anderem Terrain unterwegs. Er muss die Vereinigten Staaten als Supermacht abwickeln, um sie als Weltmacht zu erhalten. Dass dabei Bescheidenheit und Respekt gegenüber den Partnern in Europa oder Lateinamerika unumgänglich sind, scheint dieser Präsident soweit verinnerlicht zu haben, dass er es nach außen hin zeigen kann, ohne an Souveränität zu verlieren. Aber irgendwann werden sich seine Gegner – und das sind nicht nur die Republikaner oder die Intimfeinde von Fox News – wieder gesammelt haben. Sie können darauf warten, dass Obama Erfolge schuldig bleibt und bleiben muss. Nicht nur im Irak und Afghanistan. Schon schrieb am vergangenen Wochenende der konservative Weekly Standard (er gehört zu Rupert Murdochs Medienkonzern) mit feinem Gespür für den politischen Hinterhalt: „Schön, alle lieben uns jetzt. Aber sollte eine Supermacht nicht auch gefürchtet werden?“