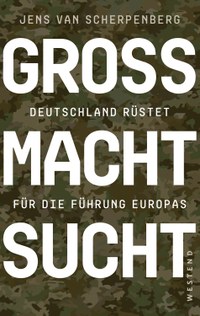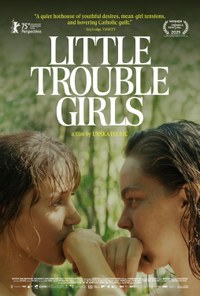Die Porsche-Arbeiter kündigen Betriebsbesetzungen an. Das zu kommentieren, erfordert einen längeren Umweg. Zunächst die Prämisse: Dass sich die Beschäftigten in Autowerken gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze wehren, kann man verstehen und auch unterstützen, obwohl sich berghohe Zweifel melden, die nur unsichtbar machen könnte, wer eine Tarnkappe über den Berg legte – die bloße Verdeckung würde nichts nützen.
Denn erstens belasten Autos die Schadstoffbilanz, und in Deutschland nehmen weder der Staat noch Unternehmen und Gewerkschaften die Chance wahr, aus der Autokrise den Beginn eines ökologischen Umbaus zu machen, einen solchen wenigstens zu fordern, neue Wege der Mobilität auszuloten.
Zweitens, selbst wenn man mit den vorhandenen Autos rundum zufrieden sein könnte, müsste doch ein Weg aus der Überproduktion heraus gefunden werden; in Europa soll fast jedes zweite Auto eines sein, das auch ohne die jetzige Wirtschaftskrise keinen Käufer finden könnte. Da müssen schon Kapazitäten abgebaut werden, und das heißt eindeutig, es sind zu viele Arbeitsplätze da. Man fragt sich, warum die Gewerkschaften auch angesichts dieser Spannung, die zwischen Realität und Unternehmerstrategie besteht, nicht angestrengter über den ökologischen Umbau nachdenken, ja warum sie ihre starre Ablehnung der Strategie, Arbeit und Einkommen zu trennen – Bürgergeld, Grundeinkommen –, nicht noch einmal überdenken.
Drittens, selbst wenn es vernünftig wäre, gar nichts weiter zu tun als so viele Arbeitsplätze zu retten wie möglich, wäre noch zu fragen, warum das mit Priorität in Deutschland geschehen sollte, statt dass man mit Entlassungen, die unvermeidlich sind, alle beteiligten Staaten in Europa, mindestens doch in Europa (aber eigentlich dürften uns auch die Arbeiterfamilien in den USA und anderswo nicht egal sein) ungefähr gleichmäßig belastet.
Trotzdem haben die Beschäftigten Unterstützung verdient, mag ihr Problembewusstsein auch noch zu wünschen übrig lassen – und wir geben nichts auf ein "Klassenbewusstsein", das nicht zugleich Problembewusstsein ist –, weil es erst einmal richtig ist, das Menschenrecht auf Arbeit ohne Wenn und Aber zu verteidigen. Weil die Gesellschaft immer wieder daran zu erinnern ist: Die in der Wirtschaftskrise bedroht sind und unterstützt werden müssen, sind die kleinen Leute und nicht die Manager, die auch heute noch mit hohen Abfindungssummen davon kommen.
Aber wenn man dann hört – unser Umweg ist zu Ende –, mit welcher Begründung die Porsche-Beschäftigten jetzt Werkbesetzungen planen, ist man doch etwas befremdet: Sie wollen nicht, dass Porsche mit VW zusammengelegt wird. Denn dann, sagen sie, könnten bei ihnen Arbeitsplätze entfallen. Also nicht nur die Autos und Methoden der Mobilität sollen bleiben, wie sie sind, sondern auch an der Struktur der Autoindustrie soll sich nichts ändern. Aber bisher hat noch niemand davon gesprochen, dass bei Porsche Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Hoch wahrscheinlich ist allerdings eine Senkung der besonders hohen Vergütungen der Porsche-Mitarbeiter auf das durchschnittliche VW-Niveau. Und das ist nun der Punkt, an dem Beschäftigte, die sonst alles mitmachen, die Geduld verlieren? Nein, halt, sie denken auch an den Gebrauchswert "ihrer" Autos: "Mit Polo-Teilen können Sie keinen Porsche bauen", hat Betriebsratschef Uwe Hück gesagt. Na wunderbar, sie kämpfen zwar nicht gegen die Klimakatastrophe, aber doch wenigstens gegen Poloteile.
"Betriebsbesetzungen" hört sich gut an, man denkt an das französische Vorbild und erwartet so etwas wie "revolutionäre" Aktivitäten. Aber der Kampf der französischen Arbeiter hat einen etwas anderen Charakter. In Tonneins, Südfrankreich, hat der Hebebühnenbauer JLG am Freitag der Forderung der Beschäftigten zugestimmt, 53 Mitarbeitern bei ihrer Entlassung im September jeweils 30.000 Euro Abfindung zu zahlen. Die Mitarbeiter bekommen damit eine Prämie von 14.000 Euro auf die fällige Abfindung von 16.000 Euro. Die Beschäftigten hatten gedroht, ihr Werk andernfalls zu sprengen. Hier hat nicht nur der Kampf, sondern auch das Kampfziel gestimmt.