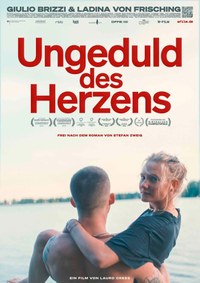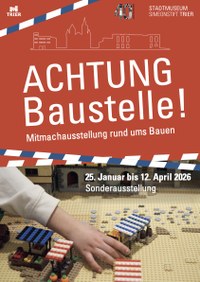Als die EU mit den beiden Osterweiterungen von 2004 und 2007 die späte Ernte des Sieges und Epochenbruchs von 1989/90 einfuhr, drohten die Scheuern zu bersten. Zehn neue Mitglieder aus Osteuropa in nur drei Jahren. Kein Wunder, dass die Ausdehnung in Brüssel, Paris oder Berlin als Überdehnung wahrgenommen wurde. Auch schien der Grat zwischen Freihandelszone und Politischer Union auf einmal ziemlich schmal – darauf zu wandern gefährlich. Man erlebte die Spaltung in ein altes und ein neues, in ein Amerika-skeptisches und Amerika-höriges Europa während des Irak-Krieges.
Als Hausordnung gedacht
Inzwischen wird die Osterweiterung als Geschichtstrophäe in den Vitrinen der Erinnerung verwahrt und ist im Tagesgeschäft kein Bonus mehr. Weder der künftige EU-Ratspräsident, noch die erste EU-Außenministerin kommen aus Osteuropa. Das verwundert, immerhin haben die zehn osteuropäischen EU-Debütanten erst dafür gesorgt, dass die Union kontinental wurde und als Megabund eine Weltmacht sein könnte, sofern sich der Koloss denn bewegen und nicht nur bestaunen ließe. Deshalb ja muss der Lissabon-Vertrag als Gebrauchsanleitung her, genau das ins Werk zu setzen. Er ermöglicht einer EU der 27 mehr Handlungsfähigkeit nach innen und außen, er gibt den Mächtigen der EU mehr Macht in der EU. Er verordnet kleineren Mitgliedern keine Ohnmacht, aber ein Ranking, das es so bisher nicht gab. Schließlich wird die Staatenunion von Frankreich, Deutschland oder Großbritannien nicht als klassenlose Gesellschaft verstanden, sondern als geordnete Hierarchie, in der die Rechte des Stärkeren sich den Interessen der Gemeinschaft stellen, aber nur bedingt unterwerfen. Von daher dekretiert der EU-Reformvertrag – allein durch die künftigen Abstimmungsmodalitäten – eine politische Ordnung, die den kleineren Staaten nicht gewährt, was die gern hätten, um diese Hierarchie aufzubrechen, sondern bekommen müssen, um sich darin trotz allem heimisch zu fühlen. Genau genommen fungiert der Reformvertrag als angepasste Hausordnung, die den Zuzug von außen auffängt und mit Regelwerk versieht.
Quasi die Beta-Version
Dass Präsidenten wie der Pole Lech Kaczynski oder der Tscheche Vaclav Klaus das als Zumutung empfinden, kann kaum verwundern. Sie fürchten, Statusverlust in der EU bedeutet Souveränitätsverlust in Europa. Ob sie sich in ihren Vorbehalten bestätigt fühlen, wenn zwei Politiker aus Westeuropa als erste die neuen Führungsämter der Europäischen Union übernehmen? Vielleicht mussten gerade aus Rücksicht auf die historische Sensibilität der Osteuropäer große und größere Kaliber wie Blair, Steinmeier, Juncker oder Kouchner als Kandidaten für die EU-Präsidentschaft leer ausgehen. Mit Herman Van Rompuy und Catherine Ashton kommt eher das kleinere Format zum Zuge, quasi die Beta-Version, die es in Riga und anerswo erlaubt, die Nichtberücksichtigung einer Politikerin wie der lettischen Ex-Präsidentin Vike-Freiberga nicht als Affront zu empfinden. Es ist nun einmal so – als die Wende von 1989/90 neue Mitglieder zuhauf in die EU spülte, wurde aus Osteuropa noch lange kein Kerneuropa. Von einer privilegierten Mitgliedschaft mit dem Anspruch auf Führungsmacht ganz zu schweigen.