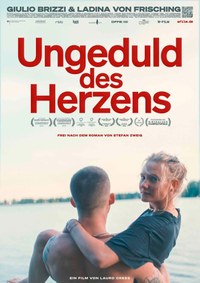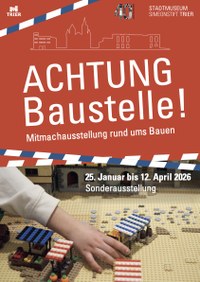Wer Fischstäbchen isst, rettet die Meere, wer Bier trinkt, rettet den Regenwald, und wer Porsche fährt, rettet das Klima. Wer heute Einkaufen geht, könnte glauben, die Rettung der Welt stehe unmittelbar bevor. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht seine „Verantwortung“ auf seiner Internetseite betont und nicht wenigstens ein Produkt auf den Markt gebracht hat, das moralischen Anforderungen genügt.
Dass der Kunde begreift, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden, darauf arbeiten Umweltorganisationen schon seit Jahrzehnten hin. Mithilfe des Drucks öffentlicher Empörung sollen Politiker dazu gebracht werden, verbindliche Standards und Gesetze zu etablieren. Der ethische Konsum enthält dagegen keine Forderungen an die Politik, sondern nur an Unternehmen. Die Idee hinter der Konsumentendemokratie ist simpel: wenn genug Leute faire, ökologische und klimaverträgliche Produkte kaufen, stellen die Unternehmen nur noch „gute“ Produkte her. Und tatsächlich, wenn es der Kunde denn wünscht, bekommt er Klimaschutz und Menschenrechte in den Supermarkt gestellt: „Gutes Gewissen“ ist das neue emotionale Attribut der alten Warenwelt.
Mal abgesehen von der Frage, ob es nicht zynisch ist, die Verwirklichung von Menschenrechten und Klimaschutz davon abhängig zu machen, ob dem Kunden beim Einkauf der Zustand der Welt durch die Rübe rauscht: Im Handel verläuft die Kommunikation auf jeden Fall nur zwischen Anbieter und Kunde. Angebot, Nachfrage und reale Probleme sind aber fast nie deckungsgleich, ums Ganze kann es dabei also nie gehen. So dient der ethische Konsum vor allem dem eigenen Wohlgefühl: Eine Befindlichkeitsweltrettung, die nicht weh tut, die nicht nach allgemeinen Lösungen sucht, sondern vielmehr individuelle Erlösung verspricht.
So gesehen ist ethischer Konsum ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Die Unternehmen bieten dem Kunden eine bequeme Infrastruktur fürs gute Gewissen, die Kunden lassen sie dafür mit allem weiteren in Ruhe. Man kann ethischen Konsum also als eine Art Ablasshandel bezeichnen, er dient der Wahrung eigener Besitzstände.
Es gibt ja auch nicht für jedes Produkt einen korrekten Ersatz, allenfalls die punktuell etwas bessere Alternative. Bio ist nicht gleich fair, fair ist nicht gleich bio – und wenn noch der CO2-Verbrauch dazu kommt, wird es vollends kompliziert. Der Kunde kann sich meist nur für ein einziges ethisches Kriterium entscheiden, kauft aber alles mit, was sonst noch so am Produkt hängt.
Ein paar Beispiele: Wer bei Lidl „bio und fair“ kauft, unterstützt gleichzeitig das Preisdumping des Konzerns, der Lebensmittelproduzenten weltweit in die Armut treibt. Wer „grünen Strom“ von einem herkömmlichen Anbieter bezieht, unterstützt Kern- und Kohlekraft. Wer sich Adidas-Turnschuhe aus recycelten Autoreifen kauft, spart vielleicht Ressourcen, akzeptiert aber die Bedingungen in den Sweatshops. Es gibt kein richtiges Einkaufen im falschen Weltwirtschaftssystem. Dieses aber zementiert der ethische Konsument, wenn er meint, die dringend nötigen Gesellschaftsdebatten den PR-Abteilungen der Konzerne überlassen zu können. Die sind ja nicht zuerst an der Rettung der Welt interessiert, sondern schlicht an dem, was sie früher schon interessierte: möglichst hoher Profit.
Kathrin Hartmanns Buch Ende der Märchenstunde. Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt, ist vor wenigen Wochen im Blessing-Verlag erschienen