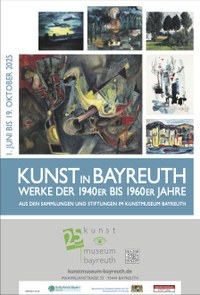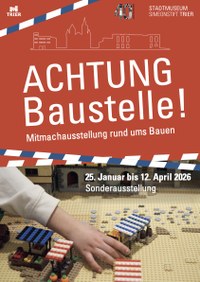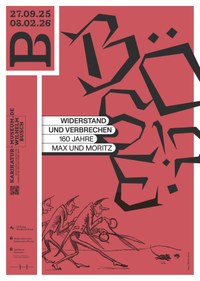Kunst in Bayreuth 1940 – 1970
1951 gründet sich in Bayreuth eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich vor allem durch ein Charakteristikum auszeichnet: Individualität. Der Name der Gruppe ist Programm: Freie Gruppe Bayreuth.
Bereits 2016/2017 stand die Freie Gruppe Bayreuth im Mittelpunkt einer Ausstellung des Kunstmuseums Bayreuth, der eine grundlegende Forschungsarbeit vorausgegangen war. Sie gab Aufschluss über beteiligte Künstlerinnen und Künstler und ihre Arbeit. Die Forschungsarbeit brachte zum Teil wunderbare Entdeckungen und Funde von verschollen geglaubten Kunstwerken zutage.
Zu dieser Ausstellung veröffentlichte das Kunstmuseum einen Katalog, in dem diese Forschungsergebnisse ausführlich dokumentiert werden und dessen Beiträge auch heute nichts an Aktualität verloren haben. Dank Katalog und Internetpräsenz erhält das Kunstmuseum seither viele Anfragen, Angebote, aber auch Schenkungen, die den Bestand des Hauses ergänzen und abrunden. Die aktuelle Ausstellung Kunst in Bayreuth – Werke der 1940er bis 1960er Jahre wirft einen Blick auf die Zeit nach dem Krieg. Welchen Stellenwert hatte die Kunst in den Zeiten der Entbehrung? Wie wurde die Kunst in den Jahren bis 1970, den Jahren des sogenannten Wirtschaftswunders, aufgenommen?
Die Ausstellung Kunst in Bayreuth – Werke der 1940er bis 1960er Jahre ist ein Dokument der Schaffensperiode der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Sie ist zudem ein Dokument des Zeitgeistes jener Jahre. Außerdem gibt sie einen Einblick in die Sammlungen und Stiftungen, die das Kunstmuseum Bayreuth beherbergt. Denn fast alle Ausstellungsstücke stammen aus diesem Bestand.
Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ist von Zerstörung und Mangel geprägt. Das Grauen des Krieges, die damit verbundene Zerstörung und Vernichtung werden zum Teil erst jetzt in ihrer ganzen Dimension realisiert. Gleichzeitig besteht ein Wunsch nach Veränderung sowie ein großer Nachholbedarf an zeitgenössischer Kunst und Kultur.
Die Kulturpolitik wird nach dem Zweiten Weltkrieg „zu einem wichtigen Instrument der Alliierten“, wie Philipp Schramm M.A. in dem Katalog zu der Ausstellung der Freien Gruppe Bayreuth schreibt. Damit kommen zwei Tendenzen zusammen: der große Nachholbedarf und das Interesse an zeitgenössischer Kunst sowie die Absicht, die Demokratie in Deutschland gezielt aufzubauen und zu stärken. Oberfranken wird zu einer neuen Heimat Für eine Vielzahl von geflüchteten Menschen wird Oberfranken während und nach dem Krieg zu einer neuen Heimat.
Zu ihnen zählen Hanna Barth (1911 Koblenz – 1961 Würzburg) und ihr Mann Herbert Barth, Gründer des Jugend-Festspieltreffens und Pressesprecher der Bayreuther Festspiele, Gerda von Freymann-Knispel (1905 Viljandi – 1981 Neustadt bei Coburg) oder Toni Farwick (1886 Warstein – 1979 Hagen). Andere kommen nach Bayreuth, da sie hier oder in der Region eine neue Arbeit finden, wie Gottfried Brockmann (1903 Köln – 1983 Kiel), Ferdinand Röntgen (1896 Barmen – 1966 Bayreuth) und Friedrich Böhme (1898 Dresden – 1975 Bayreuth). Wieder andere, zum Beispiel Herbert Bessel (1921 Hamburg – 2013 Altdorf bei Nürnberg), kommen durch das Studium nach Franken und finden hier eine persönliche wie auch künstlerische Heimat. Bemerkenswert ist, dass ein Großteil der vertriebenen Künstlerinnen und Künstler in Franken schnell Fuß fassen und sich einen Namen machen können. Dazu zählen Heinrich Faust (1910 Berlin – 1981 Bayreuth), Alfred Russ (1915 Reichenberg/Böhmen – 1996 Bayreuth), Anton Russ (1910 Reichenberg/Böhmen – 1984 Bayreuth), Werner Froemel (1927 Nysa – 2009 Bayreuth) oder Arthur Kittner (1904 Breslau – 1983 Bayreuth). Ebenso finden einige der hier Gestrandeten ein neues Betätigungsfeld, das sie wirtschaftlich unabhängig macht, wie im Fall von Arthur Seedorf (1903 Angermünde – 1986 Schwarzenbach a. d. Saale).
Freie Gruppe Bayreuth – lockerer Zusammenschluss an künstlerischen Individualisten
In Oberfranken angekommen entwickelt sich ein Netzwerk an Künstlerinnen und Künstlern. Sie wollen wieder arbeiten. Der Neuanfang der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth verspricht im August 1951 ein überregionales Publikum.
In ihrem Beitrag im Katalog zu der Ausstellung Freie Gruppe Bayreuth von 2016/2017 schreibt Dr. Beatrice Trost, dass die Freie Gruppe Bayreuth ein „Ausstellungskollektiv ohne Struktur und Regulation“ gewesen ist. Es war ein „lockerer Zusammenschluss“, getragen von der Idee, die verschiedenen Gattungen in der Kunst einem breiten Publikum nahezubringen. Es fehlte somit eine übergreifende Idee – heute würde man sagen: eine „Corporate Identity“ –, wie sie andere Künstlergruppen prägte.
Die treibenden Kräfte für die Gründung der Freien Gruppe Bayreuth sind Ferdinand Röntgen, genannt Ferd, und Friedrich Böhme. Gemeinsam mit Sawo Popowitsch Iwanow (1876/1877 – 1955 Bayreuth) und Rudolf Jakubek d. J. (1902 Königsberg a. d. Eger – 1968 Bayreuth) unternehmen sie tatkräftig alles in ihren Möglichkeiten stehende, um eine erste Kunst-Ausstellung in Bayreuth zu ermöglichen. Rund 30 Ateliers besuchen Ferd Röntgen und Friedrich Böhme in Oberfranken, um Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die erste Ausstellung der Freien Gruppe Bayreuth zu gewinnen.
Neben der Ausstellung der eigenen Kunst stehen hinter den Aktivitäten wirtschaftliche Interessen. Die Künstlerinnen und Künstler mussten von etwas leben. Wenngleich auch Tauschgeschäfte an der Tagesordnung waren. Kunst gegen Lebensmittel oder gegen einen Ofen, wie im Fall von Toni Farwick in Thurnau. 27 Zusagen erhalten Ferd Röntgen und Friedrich Böhme für die erste Ausstellung. 1951 ist es dann soweit: Zum ersten Mal präsentiert die Freie Gruppe Bayreuth vom 5. August bis 26. August 1951 Gemälde, Grafiken und Plastiken in der Graserschule. Der Termin ist bewusst gewählt, denn gleichzeitig hebt sich der Vorhang für die ersten Richard-Wagner-Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grünen Hügel.
Diese Ausstellung der Freien Gruppe Bayreuth wird ein Erfolg. Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, die Kunst der zum Teil jungen Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Zu ihnen zählen nun diejenigen, die es nach oder während der Kriegswirren nach Oberfranken verschlagen hat, wie auch Künstlerinnen und Künstler aus Oberfranken selbst. Darunter sind Karl Bedal (1914 Schwarzenbach a. d. Saale – 1999 Hof), Anton Greiner (1914 Bamberg – 2007 ebenda) oder Anton Richter (1900 Schwarzenbach a. d. Saale – 1962 ebenda).
Einen festen Ausstellungsort hat die Freie Gruppe Bayreuth nicht. Stattdessen nutzt sie in den kommenden Jahren immer wieder andere Schulgebäude in Bayreuth, um ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Einige der ersten Künstler sind der Gruppe über viele Jahre hinweg treu geblieben. Dazu gehört Caspar Walter Rauh (1912 Würzburg – 1983 Kulmbach), der bereits bei der ersten Ausstellung 1951 dabei ist und in den darauffolgenden 30 Jahren Teil der Ausstellungen sein wird. Ebenso bleibt Gerda Voith von Voithenberg (1909 Bayreuth – 2001 ebenda) der Gruppe lange verbunden.
Doch es gibt auch jene, die sich anderen beruflichen Herausforderungen zuwenden, wie Anton Russ. Oder sie verlassen Oberfranken und damit auch die Nähe des Ausstellungsortes Bayreuth, wie Gottfried Brockmann oder Toni Farwick.
Die Freie Gruppe Bayreuth und das liebe Geld
Nach dem Erfolg der ersten Ausstellung 1951, bei der es zahlreiche Ankäufe gegeben hat, verändert sich in den Folgejahren die Situation. Der wirtschaftliche Erfolg bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der Wiederaufbau steht im Vordergrund und fordert seinen Tribut. Dennoch setzt die Freie Gruppe Bayreuth ihre Ausstellungsreihe Jahr für Jahr fort und die Stadt Bayreuth kauft für ihre vielen Wände in Verwaltungsgebäuden in jedem Jahr einige Werke an.
Diesen kommunalen Besitz bewahrt heute vielfach das Kunstmuseum. Bis zuletzt genießt die Freie Gruppe Bayreuth einen ausgezeichneten Ruf in der Kunstszene und über die oberfränkischen Grenzen hinaus. In den sechziger Jahren kommen jüngere Künstlerinnen und Künstler hinzu, wie Hermann Rongstock (1942 Bayreuth – 2021 ebenda) und seine Frau Heike Rongstock-Tooren sowie Fritz Föttinger (1939 Bayreuth).
Ab den achtziger Jahren wird der Kunstverein die Ausstellungsaktivitäten übernehmen und damit ein neues Kapitel aufschlagen.