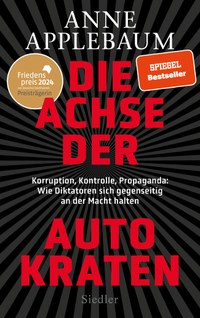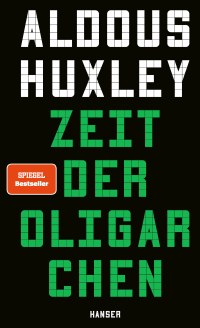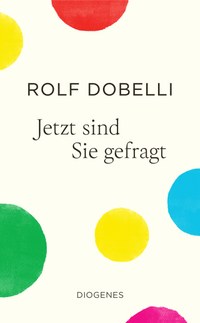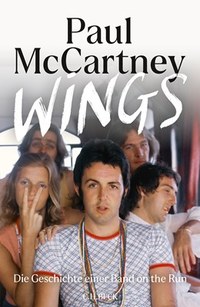Jeder von uns hat ein Bild von einem autokratischen Staat im Kopf. An der Spitze steht der Schurke, ihm zur Seite Armee und Polizei, die den Bürgern mit Gewalt drohen. Es gibt böse Mittäter und womöglich einige mutige Dissidenten.
Das ist jedoch eine Karikatur, die mit der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts wenig zu tun hat. Autokratien werden nicht von einem einzigen Bösewicht kontrolliert, sondern von raffinierten Netzwerken mit kleptokratischen Strukturen, einem komplexen Sicherheitsapparat aus Armee, Paramilitärs und Polizei sowie technischen Experten, die für Überwachung, Propaganda und Desinformation zuständig sind. Die Mitglieder dieser Netzwerke stehen nicht nur innerhalb des Landes untereinander in Verbindung, sondern auch mit den Netzwerken anderer Autokratien und manchmal sogar mit denen demokratischer Staaten. Korrupte, vom Staat kontrollierte Unternehmen in einer Diktatur machen Geschäfte mit korrupten, vom Staat kontrollierten Unternehmen in anderen Diktaturen. Die Polizeikräfte eines Landes unterstützen die Polizeikräfte anderer Länder mit Ausrüstung und Ausbildung. Die Propagandisten teilen ihre Ressourcen untereinander – Trollfarmen und Medien, die die Lügen eines Diktators verbreiten, können auch die eines anderen verbreiten – und haben gemeinsame Themen: den Niedergang der Demokratie, die Stabilität der Autokratie und die bösen Vereinigten Staaten.
Dazu müssen sich die Schurken nicht wie in einem James-Bond-Film in einer geheimen Zentrale treffen. Unser Konflikt mit ihnen ist auch kein Systemwettstreit mit klaren Fronten und kein »Kalter Krieg 2.0«. Die modernen Autokraten bezeichnen sich als Kommunisten, Monarchisten, Nationalisten und Theokraten. Ihre Regimes haben ganz eigene historische Wurzeln, Ziele und Stile. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem Kommunismus Chinas, dem Nationalismus Russlands, dem bolivarischen Sozialismus Venezuelas, der Dschutsche-Ideologie Nordkoreas und der radikalen Schia der Islamischen Republik Iran. Sie alle unterscheiden sich von Autokratien wie den arabischen Monarchien oder Vietnam, die weniger daran interessiert sind, die demokratische Welt zu untergraben; und sie unterscheiden sich von softeren Autokratien und hybriden, bisweilen auch »nichtfreiheitlich« genannten Demokratien wie der Türkei, Singapur, Indien, den Philippinen oder Ungarn, die je nach Anlass mit der demokratischen Welt auf einer Linie liegen oder nicht. Im Gegensatz zu früheren militärischen und politischen Bündnissen tritt diese Gruppe nicht als Block auf, sondern eher wie eine Kooperation von Unternehmen. Den Zusammenhalt liefert keine gemeinsame Ideologie, sondern nur die skrupellose Entschlossenheit, mit der sie sich selbst bereichern und ihre Macht erhalten. Deshalb spreche ich von der Achse der Autokraten.
Den autokratischen Führern von Russland, China, dem Iran, Nordkorea, Venezuela, Nicaragua, Angola, Myanmar, Kuba, Syrien, Simbabwe, Mali, Belarus, Sudan, Aserbaidschan und gut drei Dutzend anderen Ländern gemeinsam ist das Ziel, die Bürger ihres Landes von allen Entscheidungen auszuschließen, ihnen die politische Stimme zu verwehren, Transparenz und Rechenschaft in jeder Form zu verweigern und ihre Kritiker im Inund Ausland zu verfolgen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist ihre brutale und pragmatische Einstellung zu Reichtum. Im Gegensatz zu faschistischen und kommunistischen Führern der Vergangenheit, die Parteiapparate in ihrem Rücken wussten und ihren Reichtum nicht zur Schau stellten, leben die Führer der Achse der Autokraten oft in luxuriösen Villen und betätigen sich als Unternehmer. Ihre Bande untereinander und mit ihren Freunden in der demokratischen Welt sind keine Ideale, sondern Geschäftsbeziehungen, die der Aufweichung internationaler Sanktionen, dem Austausch von Überwachungstechnologie und der gegenseitigen Bereicherung dienen.
Außerdem unterstützt die Achse der Autokraten ihre Mitglieder beim Machterhalt. Die verhasste Regierung von Alexander Lukaschenko in Belarus wurde wiederholt von internationalen Organisationen wie der Europäischen Union oder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kritisiert und wird von ihren europäischen Nachbarn gemieden. Viele Güter aus Belarus können nicht in die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union exportiert werden, und die nationale Fluggesellschaft Belavia erhält in Europa keine Landeerlaubnis. Doch in der Praxis ist Belarus keineswegs isoliert. Mehr als zwei Dutzend chinesische Unternehmen haben im Land investiert und sogar einen chinesisch- belarussischen Industriepark nach einem Vorbild in Suzhou errichtet. Der Iran und Belarus haben 2023 den diplomatischen Austausch auf höchster Ebene aufgenommen. Kubanische Vertreter haben vor den Vereinten Nationen ihre Solidarität mit Lukaschenko bekundet. Vor allem Russland bietet Märkte, grenzüberschreitende Investitionen, politische Rückendeckung und wahrscheinlich auch polizeiliche und militärische Unterstützung. Als sich belarussische Journalisten 2020 weigerten, ein gefälschtes Wahlergebnis zu verbreiten, entsandte Russland Journalisten, um sie zu ersetzen. Im Gegenzug gestattete die belarussische Regierung Russland die Stationierung von Truppen und Waffen sowie die Verwendung dieser Stützpunkte im Krieg gegen die Ukraine.
Auch Venezuela ist theoretisch international isoliert. In Reaktion auf die Brutalität, den Drogenschmuggel und die Verstrickung des Regimes in die internationale Kriminalität haben die Vereinigten Staaten, Kanada und die Europäische Union seit 2008 ihre Sanktionen verschärft. Doch die Regierung von Nicolás Maduro erhält Kredite von Russland, das auch in die venezolanische Ölindustrie investiert, genau wie der Iran. Ein belarussisches Unternehmen lässt Traktoren in Venezuela montieren, und die Türkei ermöglicht dem Land seinen unzulässigen Goldhandel. Kuba hat seit Langem Sicherheitsberater entsandt und unterstützt die Regierung mit Militärtechnologie. Bei der Niederschlagung der Demonstrationen der Jahre 2014 und 2017 in Caracas, in deren Verlauf mehr als siebzig Menschen getötet wurden, kamen Wasserwerfer, Tränengas und Polizeischilde aus chinesischer Produktion zum Einsatz. Auch bei der Überwachung der Bevölkerung greift China dem Regime unter die Arme. Dank des internationalen Drogenhandels sind Regierungsmitglieder und ihre Angehörigen und Gefolgsleute bestens mit Versace und Chanel versorgt.
Die Diktatoren von Belarus und Venezuela sind in ihrer Heimat verhasst. Freie Wahlen würden sie verlieren, wenn es solche Wahlen denn gäbe. In beiden Ländern gibt es eine starke Opposition mit charismatischen Anführern und einer leidenschaftlichen Basis, die ihre Mitbürger inspirieren, Risiken auf sich zu nehmen, für eine Wende zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Im August 2020 demonstrierten in Belarus mehr als eine Million Menschen (bei einer Bevölkerung von zehn Millionen) gegen den Wahlbetrug. Auch in Venezuela gingen Hunderttausende auf die Straßen.
Wenn ihre Gegner nur das korrupte und bankrotte Regime Venezuelas oder das feige und brutale Regime in Belarus gewesen wären, dann wären diese Proteste vielleicht erfolgreich verlaufen. Doch ihre Gegner waren nicht nur die Autokraten im eigenen Land, sondern die Autokraten in aller Welt, die in zahlreichen Ländern Staatsbetriebe unterhalten, über die sie Investitionen in Milliardenhöhe tätigen können. Ihre Gegner waren Regimes, die Überwachungstechnologie in China und Bots in Russland kaufen. Vor allem aber kämpften sie gegen Führer, denen die Befindlichkeiten und Ansichten ihrer Landsleute und der internationalen Gemeinschaft gleichgültig sein können. Die Achse der Autokraten versorgt ihre Mitglieder nämlich nicht nur mit Geld und Waffen, sondern sie bietet ihnen etwas weniger Greifbares: Straflosigkeit.
Das unter den hartgesottenen Autokraten verbreitete Bewusstsein, dass ihnen die Welt nichts anhaben kann – das Bewusstsein, dass andere Länder keine Rolle spielen und sie sich nie der öffentlichen Meinung stellen müssen –, ist relativ neu. Selbst der Führung der Sowjetunion, der mächtigsten Autokratie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war sehr an der internationalen Wahrnehmung gelegen. Energisch behauptete sie die Überlegenheit ihres politischen Systems und widersprach jeglicher Kritik daran. Zumindest nach außen hin bekannte sie sich zu den nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichneten Abkommen und Übereinkünften zu Menschenrechten, Krieg und Rechtsstaatlichkeit. Als der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow 1960 in seiner berühmten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem Schuh auf das Pult einschlug, tat er das deshalb, weil der philippinische Gesandte erklärt hatte, den von der Sowjetunion kontrollierten Ländern Europas würden die »bürgerlichen und politischen Rechte« vorenthalten und sie seien »von der Sowjetunion geschluckt« worden. Chruschtschow fühlte sich genötigt, dem zu widersprechen. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts verhüllten die meisten Diktaturen ihre wahren Absichten mit ausgeklügelten und sorgfältig manipulierten demokratischen Darbietungen.
Inzwischen ist es den Mitgliedern der Achse der Autokraten gleichgültig, ob ihre Länder kritisiert werden. Einige, wie die Führer von Myanmar oder Simbabwe, stehen für nichts anderes als Selbstbereicherung und Machterhalt – man kann sie nicht beschämen. Die religiösen Führer des Iran verwahren sich selbstbewusst gegen jegliche Äußerung von Ungläubigen aus dem Westen. Die Regimes von Kuba und Venezuela behandeln Kritik aus dem Ausland als Beleg für eine gewaltige imperialistische Verschwörung. Die Führungen Chinas und Russlands fechten seit einem Jahrzehnt die Menschenrechtsforderungen internationaler Einrichtungen an und haben auf diese Weise viele Menschen in aller Welt überzeugt, dass es sich bei den Abkommen zu Krieg und Völkermord oder Vorstellungen wie »bürgerliche Freiheiten« und »Rechtsstaatlichkeit« um westliche Konstrukte handle, die in ihren Ländern keine Anwendung fänden.
In ihrer Gleichgültigkeit gegen Kritik aus dem Ausland greifen moderne Autokraten ohne jede Scham zu brutaler Gewalt. Die Militärregierung von Myanmar macht keinen Hehl daraus, dass sie in den Straßen von Rangun Hunderte Demonstranten getötet hat, darunter zahlreiche Jugendliche. Das Regime von Simbabwe schikaniert bei seinen Scheinwahlen die Oppositionspolitiker in aller Öffentlichkeit. Die chinesische Regierung brüstet sich mit der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong und ihrer »Antiextremismus«-Kampagne in Xinjiang, die Massenfestnahmen und die Internierung Hunderttausender muslimischer Uiguren in Umerziehungslagern bedeutet. Die iranischen Mullahs machen sich nicht die Mühe, ihre brutale Unterdrückung von Frauen zu verheimlichen.
Der internationale Demokratieaktivist Srđa Popović bezeichnet dieses Herrschaftsprinzip nach dem venezolanischen Führer als »Maduro-Modell«: Autokraten fürchten sich nicht vor Staatsversagen – um sich an der Macht zu halten, nehmen sie auch wirtschaftlichen Kollaps, Gewalt, Massenarmut und internationale Isolation in Kauf. Ähnlich wie Maduro scheint es Baschar al-Assad in Syrien oder Lukaschenko in Belarus gleichgültig zu sein, ob sie über ruinierte Volkswirtschaften und Gesellschaften herrschen. Bürgern der demokratischen Welt fällt es schwer, Regimes dieser Art zu begreifen, denn deren Hauptziel besteht nicht darin, das Wohl ihrer Bürger zu mehren. Ihr Hauptziel ist der Machterhalt, und dazu sind sie bereit, Nachbarländer zu destabilisieren, das Leben ihrer Bürger zu zerstören oder – wie ihre Vorgänger – Hunderttausende in den Tod zu schicken.