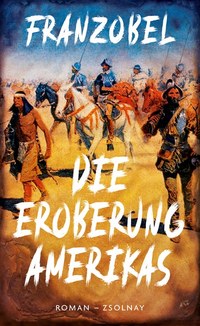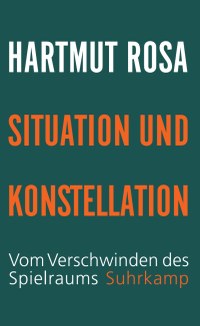Independence Day
Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein. Manchmal ist etwas Wahrheit, auch wenn es nicht erkannt wird. Geschichte wird geschrieben, ist parteiisch, voller Skurrilitäten. Sonnenkönig Ludwig der Vierzehnte etwa war ein gefräßiger, zahnloser Fettwanst, dem beim Essen Suppe aus der Nase spritzte. Albert Einsteins Hirn wurde von einem Pathologen gestohlen und vierzig Jahre durch die Provinz gekarrt. Papst Innozenz der Achte war so fett, dass kleine Monde um ihn gekreist sind. Nein, aber er musste im Bett von Dienern gewendet und von jungen Frauen gestillt werden. Abraham Lincoln wurde von einem Schauspieler erschossen, und George Washington starb, weil ihm Ärzte beim Aderlass zu viel Blut abgezapft hatten. Der Leiche Karls des Fünften wurde der kleine Finger gestohlen, und ... nicht zu fassen, was da alles ans Licht kommt ... Christoph Kolumbus hat Amerika nur aufgrund eines Rechenfehlers entdeckt.
Und solch historische Persönlichkeiten werden bei Festumzügen herumgeschleppt? Die Parade in Gettysburg erreichte ihren Höhepunkt. Musikkapellen spielten »The Star-Spangled Banner«, und Männer in historischen Uniformen stelzten im Stechschritt hinterdrein. Planwagen, ein Weißkopfadler aus Polyesterharz und aufgeblasene Präsident-Lincoln-Puppen.
Amanda Burmaster hätte nicht im Büro sein müssen, aber ihr Schreibtisch quoll über von Briefen von Kriegsveteranen, die ihre posttraumatischen Belastungsstörungen nicht länger mit Antidepressiva bekämpfen wollten, sondern Marihuana forderten.
Auf der Straße zogen Indianer vorbei. Motorradfahrer mit der Flagge der Konföderierten und Kinder mit »Moms with Guns«Schriftzügen auf T-Shirts. Im Bezirksgericht las die Sekretärin Veteranengeschichten, in denen von Kabul und Mossul die Rede war. Ein Schreiben wie das andere. Einer litt unter Panikattacken, der Nächste hatte mit Schlaflosigkeit zu kämpfen, ein anderer bekam Schreikrämpfe, wenn er Kinder sah, und dann war da ein Brief, der aus der Reihe tanzte. Dass sich ein Veteran einen Anwalt leistete, war ungewöhnlich. Einen aus Manhattan: »Trutz Finkelstein und Partner« stand in eleganten Lettern auf dem Kuvert. Sie öffnete den Umschlag, nahm den Brief heraus, las die Zeilen und verschluckte sich. Ihre Augen wurden Tischtennisbälle und hüpften fast aus den Höhlen. Dann las sie den Text noch einmal und merkte, wie ihre Hände anfingen zu zittern.
– Heilige Dreifaltigkeit! Wenn das durchgeht, können wir einpacken. Aber nein, das wird nicht durchgehen. Das darf nicht sein. Sie schüttelte den Kopf.
Draußen marschierte eine Delegation der Waffenlobby vorbei. Die meisten hatten den zweiten Zusatz der Verfassung auf ihren T-Shirts stehen, andere hielten halbautomatische Bushmaster, AR-15-Gewehre oder Deringer-Pistolen in die Höhe. Waffen, die ihnen nichts nützen würden gegen diesen Brief, den die verdatterte Sekretärin nun ein drittes Mal las. Trutz Finkelstein und Partner wollten dem Land das Fell über die Ohren ziehen, diese Verrückten verlangten nichts Geringeres als die Rückgabe der Vereinigten Staaten von Amerika an die Indianer, einschließlich Hawaii und Alaska. Das war ... ungeheuerlich! Wahnsinn! Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein. Manchmal ist die Wahrheit wahr, auch wenn sie nicht erkannt wird. Geschichte ist parteiisch, voller Skurrilitäten.
Doch bevor wir auf diesen Brief zurückkommen, machen wir einen Sprung durch Raum und Zeit und begeben uns zur Ursache dieses abstrusen Ansinnens, in eine Zeit, in der sich die medizinische Versorgung auf Zahnzieher und Steinschneider beschränkt hatte und Schusswunden mit Aderlässen und siedendem Öl behandelt wurden, in die Epoche der Eroberung Amerikas, zum Urverbrechen des Kolonialismus, der Conquista, und zwar zu einer Episode, mit der sich Trutz Finkelstein und Partner intensiv beschäftigt hatten, um ihre Klage zu begründen – zu Hernando de Soto, oder, wie wir ihn nennen: Ferdinand Desoto.
Geruch von Schnee
Put, put, put, das Näschen. Obwohl kein Engelsfurz den Abendhimmel zierte und die vom Meer kommende Brise wohltuend warm war, roch es nach Schnee. Davon ließen sich die mexikanischen Fischersfrauen, die weder wussten, dass sie Mexikaner waren, noch sich je als Fischersfrauen bezeichnet hätten, nicht irritieren.
– Put, put, put, das Näschen, und ich bin ein Häschen, hielt sich ein Mädchen einen Bommel an den Steiß und wackelte obszön mit dem Hintern. Nun packte sie zwei Fische und hielt sie sich wie Hasenohren neben das Gesicht. Sie schob die Vorderzähne vor, zog Nasenfalten, kniff die Augen zusammen und sagte etwas von Rammeln, Karnickel, Hasenstall und küsste einen Fisch. Alle lachten – die Dorfälteste so sehr, dass man fürchtete, sie würde sich das Unterkiefer ausrenken. Die Häsin ging in die Knie, wackelte mit dem Bommel und ignorierte den Geruch von Schnee.
Niemand beachtete das Kindergeschrei. Die Kleinen waren immer laut. Mal, weil eine Schildkröte aus dem Wasser kam, mal, weil sie ein Kapuzineräffchen entdeckten oder eine Qualle. Die Netze flickenden Frauen sahen lieber der närrischen Häsin zu. Sie genossen die Abendsonne und stimmten in den Refrain eines zweideutigen Liedes ein, das von Liebe, Eifersucht und Put, put, put, dem Hühnerverb, handelte, als die Schreie der Kinder hysterisch wurden. Endlich wandten die Weiber ihre Köpfe, doch da war es zu spät, sie kamen sich vor wie Feldhasen, die ein Bataillon mähender Sensenmänner zu spät bemerkt hatten. Ihnen wurde heiß vor Aufregung und kalt vor Schrecken.
Erst sahen sie die goldglänzenden Spiegelungen im glatten Meer, dann die bedrohlich aufgetürmten Wolken, schließlich Schiffe. Schiffe? Notdürftig zusammengezimmerte Hasenställe, die Schatten ausspuckten. Schatten? Bärtige, in Lumpen gekleidete Außerirdische, die durch die Brandung wateten und, kaum hatten sie trockenen Boden unter den Füßen, auf sie zuliefen. Es waren dutzende. Eine Horde Zombies. Helme, Brustharnische und Büchsenläufe funkelten, andere waren fast nackt. Und ehe die Frauen den Mund aufbrachten, um nach ihren Männern zu rufen, die besoffen in strohgedeckten Hütten dösten, waren die Gestalten auch schon da. Mokkabraune Kerle mit verwundeten Blicken. Die Typen umarmten die Frauen, die nun nicht mehr lachten, mit ausgemergelten, aber kräftigen Armen und drückten ihnen angefaulte Zahnstummel in die Wangen. Nein, Küsse.
Put, put, put, das Hühnerverb, sie rannten ihnen hinterher, warfen sie zu Boden, griffen ihnen in den Schritt. Die Frauen kreischten. Manche flohen oder versuchten, sich zu verstecken, wurden geschnappt, gedrückt und abgeschmatzt. Alle schrien. Als ihnen ihre Männer zu Hilfe kamen, ließen die Außerirdischen von den Frauen ab, liefen auf die verblüfften Fischer zu, umarmten auch sie und riefen:
– Hunger. Durst! Wir waren vier Jahre lang im Land der Wilden und freuen uns, wieder in der Zivilisation zu sein.
Zivilisation? Das Fischerdorf im Norden Mexikos hatte nicht einmal einen Namen. Seine Bewohner nannten es Tante Zwiebel, weiß der Teufel, woher diese Bezeichnung stammte.
Ohne sich lange aufzuhalten, fielen die Eindringlinge über die Vorräte her. Schamlos verschlangen sie rohen Fisch und Mais, sämigen, aber kalten Erbsenbrei, Wurzeln und Zwiebeln. Nur einer war tiefbewegt, weinte und versuchte das Geschehen den verwirrten Dorfbewohnern zu erklären. Cord Fenk, Sohn eines niederländischen Wurstmachers, Arzt, dessen Äußeres genauso wenig vertrauenerweckend wirkte wie das der anderen – zerschlissenes Leinenhemd, zerfetzte Hose, verfilzte Haare, Bart. Er sprach von der Ferdinand-Desoto-Expedition, Florida, Indianern, Kämpfen, Perlen, und dass man, stimmte die Rechnung, das Jahr 1543 schrieb, den 12. Oktober?
– Über den Tag streiten wir seit Monaten. Was ist in den vergangenen vier Jahren passiert? Gab es Krieg? Haben wir den Weltuntergang verpasst?
Er erwähnte Kaiser Karl den Fünften, in dessen Namen man Florida erobert hatte, und verkündete den Dorfbewohnern, dass sie sich glücklich schätzen könnten, weil ihnen als Bürger Spaniens ein goldenes Zeitalter bevorstünde. Spanien? Karl der Fünfte? Die Fischer hatten nichts von ihm gehört, sie verstanden ja nicht einmal die Sprache!
– Du glaubst doch nicht, die kapieren, was du sagst? Ein Soldat klopfte ihm auf die Schulter.
Und tatsächlich, Cord Fenk sah in verständnislose Gesichter. Zivilisation! Die Zivilisation würde nicht verstehen, was sie erlebt hatten. Vielleicht wäre es besser, diese Geschichte niemandem zu erzählen? Er sank in die Knie und dachte an die Eintöpfe Kastiliens mit Kichererbsen, Blutwurst, Speckstreifen und Meeraal, nach denen er sich seit Jahren sehnte. Was gäbe er jetzt für eine Flasche Rioja, Ibérico-Schinken und holländischen Käse.
Auch Paula, seine Verlobte, kam ihm in den Sinn. Was aus ihr geworden war? Nimm mir etwas mit, hatte sie gesagt, das Erste, was dir vor die Füße fällt. So wie in dem Märchen »Drei Nüsse für Aschenbrödel«. Und hatte er ihr etwas mitgebracht? Etwas anderes als Indianerwörter?
Er sah Soldaten, die den Fischern von ihren Heldentaten vorschwärmten, von schier aussichtslosen Kämpfen gegen Menschenfresser und wilde Tiere, von goldenen Palästen und Kisten voller Perlen in fernen Königreichen. Die Leute von Tante Zwiebel hingen an ihren Lippen, obwohl sie nichts verstanden, und Cord Fenk wusste, dass es so nicht gewesen war ... Er staunte über die Unbekümmertheit, mit der sich die anderen mühelos wieder in der Welt zurechtfanden, und ahnte, dass man das auch von ihm verlangen würde. Die Kommissionen in Spanien brauchten solche Geschichten, um weitere Expeditionen nach Westindien zu finanzieren. Sie würden ihn bitten, pragmatisch zu sein und die Wahrheit ein bisschen zu verbiegen. Davon, dass man ihren Führer Ferdinand Desoto vergiftet hatte, würde man nichts wissen wollen. Es würde keine Untersuchung geben, und kein irdisches Gericht würde den Mörder je belangen.
Fenk sah den am morastigen Boden liegenden Bommel, mit dem das Mädchen gerade noch gespielt hatte, und fühlte sich schuldig, schuldig, ein Zurückgekommener zu sein, dieses vierundfünfzigmonatige Abenteuer überstanden zu haben. Mehr als die Hälfte der Expeditionsteilnehmer war nicht mehr am Leben, er aber, Cord Fenk, hatte es geschafft. Zumindest seine Haut hatte er gerettet. Er dankte Gott, blickte zum Himmel, sah die Wolkentürme und fühlte erste Tropfen im Gesicht. Schnee? Nein, in Mittelamerika schneite es nicht, das war Hagel!
Während die kleinen weißen Körner alles bedeckten, landete ein weiteres Schiff am Ufer, wateten vier Indianer mit einem Baldachin an Land, unter dem ein würdevoller Mann einherschritt. Der Mensch trug eine für dieses Klima unpassende Robe, einen flachen Hut und eine goldene Kette, die ihn als Vertreter Spaniens auswies. Aber was war mit seinem Gesicht? Er hatte keins!
– Sind Sie Richter?, schrie ihm Cord von weitem zu. Wenn Sie gekommen sind, den Anteil des Königs zu fordern, waren Ihre Mühen vergeblich. Wir haben nichts erbeutet.
– Sind das die Männer der Desoto-Expedition? Der Ankömmling sprach mit ruhiger, sonorer Stimme. Er hielt einen Hund in Händen, einen bellenden Rauhaardackel. Mein Name ist Turtle Julius, ich bin Notar und suche einen Ambrosio Bastardo.
– Was hat der angestellt? Bastardo? Cord dachte an das rattenähnliche Gesicht dieses kleinen Gauners, der gemeinsam mit seinem Kumpan Cinquecento während der gesamten Expedition nur Unheil angerichtet hatte.
– Er ist zum Alleinerben des Grafen von Orgaz bestimmt. Ich bin seit fünf Jahren unterwegs, um es ihm mitzuteilen – er ist ein gemachter Mann. Abzüglich meiner Spesen beläuft sich sein Vermögen auf hundertachtundsiebzigtausend Golddukaten, Ländereien, Weinberge, zwei Schlösser samt Falknerei, ausgedehnte Wälder, vierzehn Mühlen, davon eine für Papier, eine für Draht, und acht Jagdhunde. Dieser nicht, der ist mir zugelaufen, er streichelte den Dackel. Im selben Moment begann das Tier zu kläffen, sprang aus Turtle Julius’ Händen, lief zu einem auffällig bunt gekleideten Menschen und hüpfte an ihm hoch.
– Ramses! Der Mann quietschte vor Freude. Der Hund bellte wie verrückt. Immer noch roch es nach Schnee.
Heiliger Bimbam
Holen wir kurz Luft und blicken in die Heimat jener Rückkehrer, die gerade über die Fischersfrauen hergefallen sind, die Extremadura, das Burgenland Spaniens ... also die am wenigsten entwickelte Region – sonst wäre Kastilien das Burgenland. Extremadura? Bereits der Namen verrät, die Landschaft und die Menschen sind extrem – mutig, hart und verschlossen. Nicht von ungefähr kommen so gut wie alle Konquistadoren aus dieser Gegend. Wenn man aber nach Desoto fragt? Risotto? Wer? Ferdinand?
Menschen machen alles lächerlich, sehen nur das Böse. Also ist auch die Eroberung Amerikas für viele ein Gemetzel verrohter Abenteurer, die in lächerlich aussehenden Ballonhosen und mit federgeschmückten Helmen ganze Völker ausgerottet, Landstriche verwüstet und Kunstschätze vernichtet haben sollen. Gräuel, bei denen einem die Luft wegbleibt. Aber ist der moderne Mensch in der Lage, das zu beurteilen?
Wir sind noch am Luftholen und fragen: Darf man den Geschichtsbüchern glauben? Geschichte wird von Siegern geschrieben, von denen, die Geld und Einfluss haben. Andere Sichtweisen werden abgewürgt oder lächerlich gemacht. Warum sollte es der indigenen Bevölkerung Amerikas besser gehen? Was waren das für Leute? Marihuana rauchende, Peyote fressende und Powwows veranstaltende Wilde, die mit Federschmuck um Lagerfeuer tanzten? Leute, deren Nachfahren Casinos betreiben und auf Minderheitenrechte pochen?
Die Chance ist gering, heutzutage einen Menschen des 16.Jahrhunderts zu treffen. Es wird niemanden geben, der bei der ersten Begegnung zwischen Weißen und Indianern dabei gewesen ist. Es wird sich keiner finden, der von einem eine butterweiche Menschenleber verspeisenden Kariben berichtet, von indianischen Kochtöpfen, aus denen Kinderbeine ragen. Niemand hat die Zeremonien, Drogenexzesse und Massenhinrichtungen erlebt oder den von Frauenbrüsten träumenden Mönch gekannt, der im Delirium Amazonenstämme erfand und dem größten Strom Südamerikas den Namen gab.
Eroberer prangen an Hausfassaden, auf Münzen, Bierdosen oder Briefmarken: Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Lope de Aguirre und noch ein paar Namen, durch die ein R rollt wie eine Erntemaschine über einen Hasenbau. Spanien nennt sie Entdecker oder »freundschaftliche Völkerverständiger«, dabei waren sie Brutalos, die unter dem Vorwand der Christianisierung unfassbare Grausamkeiten begingen.
Europa hält sich für das Zentrum der Welt, dabei stammen die wichtigsten Erfindungen aus Asien: die Schrift, das Zahlensystem, der moderne Pflug, das Schießpulver, bewegliche Lettern für den Buchdruck, Steigbügel. Was haben die Europäer erfunden? Die Zeit – und in ihrer Folge Mittel, sie zu überwinden. Die Europäer sind Eroberer. Alles haben sie in Beschlag genommen, ausgebeutet, und immer wurde ihnen die Zeit knapp. Das Christentum ist eine Religion der Endzeit, ein Glaube an die Zählung. Vierzig Jahre in der Wüste, drei Tage bis zur Auferstehung, und am Sonntag, dem 23. Oktober 4004 vor Christus, wurde, wie der Bischof von Armagh anhand der biblischen Genealogie errechnet hat, die Welt erschaffen ... Aber darf man, heiliger Bimbam, das Christentum für alles verantwortlich machen? Nein, sämtliche Völker werden von einem Willen zur Übernahme angetrieben. Schon der Homo sapiens hat den Neandertaler verdrängt, die Mongolen kamen bis Finnland und die Mauren bis zu den Pyrenäen.
Menschen waren meist vulgär, scheußlich und unmoralisch, haben einander bekämpft, gefoltert und getötet. Warum sollten die spanischen Konquistadoren anders gewesen sein? Ist die Geschichte des aus der Extremadura stammenden Ferdinand Desoto, der 1539 Florida erobern wollte, eine von Barbarei und Entmenschlichung? Oder war seine Expedition mitfühlend, vernünftig, human? In jedem Fall ist dieses erfolgloseste aller spanischen Unternehmen eine gute Geschichte, die Geschichte von einem Eroberer, seiner Frau und ihrem Geliebten, kein Green awayFilm, von einem Schiffbrüchigen, einem Arzt und zwei Gaunern.
Doch bevor wir uns in die dicke Luft der Eroberer begeben, zu dem niederländischen Arzt und Wurstmachersohn Cord Fenk zurückkehren und flacher atmen müssen, wechseln wir den Schauplatz und werden im Wortsinn ins kalte Wasser dieser Geschichte geworfen, wo wir einem Luftikus begegnen.
Elias Plim
»Mann im Wasser!«, schallte es vom Krähennest. Der Kapitän, von einem breitkrempigen Filzhut beschattet, kaute an einer verkohlten Hühnerkeule, warf den abgenagten Knochen über Bord und griff zum Fernrohr. Es dauerte, bis er in der azurblauen Fläche das kleine Objekt gefunden hatte, an das sich ein Körper klammerte. Mann im Wasser? Ein Schiffbrüchiger? Mitten im Weltmeer? Hundert Seemeilen nordwestlich von Madeira?
Der frischgewählte Korsarenkapitän, eine Narbe zerteilte sein Gesicht wie der Vertrag von Tordesillas die Welt in eine spanische und eine portugiesische Reichshälfte, ließ die Schaluppe fieren und gab Befehl hinzurudern, um den Mann zu retten. Als die Freibeuter das seltsame Objekt, diese Vorstufe eines Surfbretts, erreicht hatten und den durchweichten, leblosen Körper sahen, das mehlsuppengraue Gesicht, bekreuzigten sie sich an Brust und Stirn. Der Kerl war hinüber, hatte sich im Todeskampf an eine Tür geklammert und trieb nun wahrscheinlich Ewigkeiten durch die See, um irgendwann im Verdauungsstrakt von Haien zu landen. Aber war sein Bauch schon aufgetrieben? Hatte er die für Wasserleichen typische grünstichige Gesichtsfarbe? Wuchsen ihm Algen aus den Ohren? Nein.
Ein Pirat betastete die durchnässte Kattunhose, hoffte auf einen Geldbeutel oder Wertsachen. Als er ihm das Lederband vom Hals riss und mit Mühe die abgewetzte Inschrift »Elias Plim« auf dem Metallplättchen entzifferte, öffnete der bleiche Hautlappen die Augen, blickte seinem Retter und Räuber, den dabei fast der Schlag getroffen hätte, ins Gesicht, bekam einen katatonischen Anfall und fiel gleich darauf zurück ins Koma. Als man ihn in das Rettungsboot hievte, stieß sein Kopf gegen das Dollbord, und selbst da zuckte der Bewusstlose nur leicht.
– Elias Plim, sagte der Kapitän der Seestern, während er in eine Hühnerbrust biss. Elias Plim? Sprichst du Französisch, Spanisch, Italienisch? Bist du Engländer, Holländer oder ein Maure? Rede, Elias Plim! Woher kommst du? Oder bist du eine Meergeburt? Der französische Korsarenkapitän mit unaussprechlichem Namen – einer Mischung aus Giscard d’Estaing, Gérard Depardieu und Chateaubriand – gab dem Schiffbrüchigen eine Ohrfeige und brüllte: Antworte, Elias Plim! Wer bist du? Was machst du hier? Wieso willst du auf einer Tür über den Ozean? Hast du den Verstand verloren? Als ihm die Absurdität seiner Fragen bewusst wurde, trat er dem von zwei Seeleuten gestützten Schiffbrüchigen gegen das Schienbein und schrie aufs Neue:
– Wenn ich etwas nicht leiden kann, du Landfisch, dann Verstocktheit.
Ausgestattet mit einem von König Franz dem Ersten unterfertigten Freibeuterbrief, war der Kapitän mit der nussschalenförmigen Galeone unterwegs, um spanische Karavellen aufzubringen, die Gold von Westindien, wie man Amerika damals nannte, nach Sevilla brachten. Genau genommen waren sie also keine Piraten, auch wenn wir das Wort weiter verwenden, sondern Freibeuter oder Kaperer ... Auf alle Fälle waren sie die erfolglosesten Seeräuber aller Zeiten – Vorbilder für Enternix, Dreifuß und Baba im »Asterix«.
Seit mehr als einem Jahr waren sie nun unterwegs, ohne nur eine einzige Prise gemacht zu haben. Abgesehen von Fischern vor Madeira, von denen sie ausgelacht wurden, war ihnen niemand vor den Bug gekommen. Sämtliche Schiffe, die sie gekreuzt hatten, waren dickbauchige Kähne, die Sklaven von Westafrika nach Übersee brachten. Die Bedingungen auf diesen Kuttern waren derart grauenvoll, dass sich ein Gutteil der Sklaven aus dem Leben stahl, womit sie ihren Besitzer um sein Eigentum brachten, gegen das siebte Gebot verstießen und somit ewig in der Hölle schmoren mussten. Der Gestank der halbverfaulten Leichen im Unterdeck war derart erbärmlich, dass man diese Kähne hundert Meilen gegen den Wind roch. Manchmal breiteten sich Cholera und Typhus aus, rissen Löcher in die Mannschaften. Es soll vorgekommen sein, dass alle abkratzten und die Schiffe führerlos über den Ozean trieben, von Vögeln gekapert wurden und mit zugeschissenen Skeletten und fetten Kackvögeln ein derart skurriles Bild abgaben, dass jeder, der so ein Geisterschiff zu Gesicht bekam, um seinen Verstand fürchten musste. Trotzdem würde man im 16. Jahrhundert keine Seele finden, die sich ernsthaft über den Sklavenhandel, das sogenannte »kreolische Geschäft«, entrüstete.
Die einzigen Spanier, die der Seestern begegnet waren, segelten in Formation und waren zu viele, um sie anzugreifen. Die französischen Freibeuter hatten La Gomera umsegelt, waren vor Teneriffa und Madeira gelegen, bis zu den Azoren geschippert, aber egal, wo sie kreuzten, die Spanier schienen an ihnen vorbeizukommen wie an einem von Ameisen bewachten Burgtor. Und ausgerechnet jetzt, da sie beschlossen hatten, ihr Glück in der Karibik zu suchen, stießen sie auf diesen Schiffbrüchigen.
Elias Plim, der Luftikus, hatte minutenlang gehustet, bestimmt sechs Liter Seewasser ausgespien. Nun blickte er auf die holländische Flagge am Besanmast, sah die eingerollte Blutfahne und hörte französische Flüche, die wie »Erde« und »Gülle« klangen. Froschfresser! War er gerettet? Ein Blick auf die Besatzung sagte alles. Plims Vorstellung von Piraten war nicht von Hollywoodfilmen geprägt, und auch wenn hier niemand ein Tuch am Kopf trug, weder Holzbein noch Eisenhaken oder Augenklappe vorzuweisen hatte, wusste er, diese bärtigen Gentlemen mit den wenigen Zähnen in den zerrissenen Mündern, den zerschlissenen Kleidern, abgewetzten Stulpenstiefeln waren kein Alumni-Verein auf Sommerfrische, sondern Seeräuber. Selbst der mit den Resten des Huhnes beschäftigte Kapitän machte keinen seriösen Eindruck.
Elias Plim war vor dem Ertrinkungstod gerettet, dafür aber auf einem Korsarenschiff gelandet. Er sah Männer mit gegerbten Gesichtern Segel flicken und Taue spleißen, andere hockten auf Fässern und würfelten mit der Langeweile um die Wette. Ein paar waren so betrunken, dass sie nicht mehr stehen konnten, andere putzten ihre Säbel oder machten sich an den Kanonen zu schaffen. Nur der Kapitän versuchte mit einer Karte, ihre Position auszumachen. Er warf einen Blick zu seinen Männern und schüttelte den Kopf.
– Ästhetik, ihr verlauster Haufen! Wir sind Franzosen, bekannt für Stil und Eleganz. Und ihr? Wie seht ihr aus?
War Plim also gerettet? Schaurige Geschichten hatte er gehört. Piraten ließen ihre Gefangenen Kakerlaken schlucken, nagelten sie an den Ohren an die erste Rah, brandmarkten sie mit rotglühenden Eisen oder ließen sie kielholen. Aber war er ihr Gefangener? Er sah Männer mit Kübeln voller Pech und Schwefel, und als ihn jemand an den Ohren zog, fürchtete er bereits das Schlimmste.
Wir schreiben also das Jahr 1537. Die Welt war größer geworden. Zuerst hatte die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gensfleisch die Kommunikation revolutioniert, dann erlebte ein Mönch mit starkem Bartwuchs und Beichtzwang bei der Notdurft sein »Turmerlebnis«, das der katholischen Welt gewaltig auf den Kopf fallen sollte. Anfangs verweigerte der erleichtert Erleuchtete jeglichen Kotau, dann soll er das Kirchenportal zu Wittenberg geschändet haben ... Tatsächlich hat Luther seine Thesen gar nicht an das Kirchentor geschlagen, was bei der damaligen Alphabetisierungsrate auch völlig unsinnig gewesen wäre, sondern hat sie dem Erzbischof von Mainz geschickt. Der englische König forderte vom Papst die Annullierung seiner Ehe, was dieser ablehnte, weil ihm der Bart des Angelsachsen nicht gefiel. Damit war dem christlichen Abendland ein Rasiermesser angesetzt, das ihm ein Jahrhundert später mit dem Dreißigjährigen Krieg in die Gurgel fahren sollte. Und alles nur, weil der wohlbeleibte Tudor mit seiner verhärmten Spanierin keine Söhne zuwege brachte. Im Reich des Habsburgers Karl des Fünften, eines gichtkranken, humorlosen Fanatikers mit einem so veritablen Unterkieferproblem, dass es nicht einmal Tizian beschönigen konnte, machte den Menschen die Inflation zu schaffen, von der niemand verstand, dass sie mit den steigenden Silberund Goldlieferungen aus der Neuen Welt zusammenhing. Die Portugiesen ärgerten sich über ihre Rechenkunst, die unzweifelhaft bewiesen hatte, dass Kolumbus’ Route unrentabel war, weil der Weg nach Indien in westlicher Richtung viel zu weit war. Wer hatte ahnen können, dass die Königin von Kastilien mathematischen Dilettanten vertraute, dem Genueser auf den Leim ging, und dieser das Glück hatte, auf einen unbekannten Kontinent zu stoßen?
Der Preuße Kopernikus hatte die Erde zu einem kleinen, lächerlichen Trabanten der Sonne degradiert. Der Straßburger Satiriker Sebastian Brant sah die Gesellschaft als Schiff voller Narren, und Rabelais arbeitete an seinem »Pantagruel«. In der Medizin kritisierte ein verfetteter Schweizer die vorherrschende Viersäftelehre, Machiavelli schrieb an einer Komödie, und die meisten großen Geister rückten den Menschen und die Antike in das Zentrum ihres Denkens, zumindest beriefen sie sich auf griechische Philosophen, die keiner kannte. Die katholische Kirche entwickelte Methoden, um ihre Macht gegen die Reformierten zu behaupten, und an der Lambertikirche zu Münster hingen noch die Eisenkäfige mit den verrotteten Leichen der ein Jahr zuvor zu Tode gefolterten Wiedertäufer.
Aus heutiger Sicht war das 16.Jahrhundert vor allem eines: brutal. So als hätte die Mafia sämtliche KZ-Aufseher zu einem Wettbewerb in Sachen Grausamkeit herausgefordert. Da wurden Menschen gevierteilt, bei lebendigem Leib zersägt oder mit zerstoßenen Gliedern auf ein Rad geflochten. Dass man zur Steigerung des Spektakels den Unglücklichen zuvor noch mit glühenden Zangen die Brustwarzen ausgerissen und flüssiges Blei, Teer und Schwefel in die Wunden gegossen hat, sei nur nebenbei erwähnt. Brutal? Nein, ungeheuerlich, menschenverachtend, maßlos grausam.
Verglichen mit den willkürlichen Herrschern war die Inquisition ein altruistischer Anglerverein, dabei folterte, verbannte und verbrannte auch das Heilige Offizium. Schlimm, dass damit das Denunziantentum fröhliche Urständ feierte, Unschuldige der Wahrsagerei, Bigamie, Sodomie, Dämonenanrufung, Beleidigung von Kirchenglocken, Hostienschändung, Nichteinhaltung der Fastenregeln oder anderer Abstrusitäten beschuldigte, sich niemand mehr seiner Haut sicher sein konnte – und zwar wortwörtlich. In der Neuen Welt machte die indigene Bevölkerung Bekanntschaft mit den Lehren Christi und wurde abgeschlachtet. Als ob das nicht genug wäre, wüteten auf dem Balkan noch die Türken. Ganz Europa zog sich zusammen wie Schnecken im Salz, und das Salz waren die Osmanen.
Daneben fand ein ganz normales Leben statt, mit Liebeskummer, Geldsorgen, Heiratsplänen, Kochrezepten. Menschen erfreuten sich an der Lektüre des »Amadis de Gaula« ... bewunderten die Bilder Arcimboldos und Hieronymus Boschs ... staunten über apotropäische Figuren an Häuserfassaden, machten Bekanntschaft mit Kartoffeln, Kakao und Tabak, stachen sich an der Ananas, ärgerten sich über die unverschämten Teuerungswellen und sahen im unbeständigen Klima ein Vorzeichen des Jüngsten Gerichts.
Von all diesen Entwicklungen wusste Elias Plim wenig. Er hatte sich noch nie für Politik interessiert und immer in Phantastereien gelebt. Zudem verstand er die französische Sprache schlecht, wusste nicht, was ihn hier auf dem Korsarenschiff erwartete. Mit seinen zwanzig Jahren hatte er schon so viel erdulden müssen, dass er sich jetzt lieber stumm stellte.
– Wie der Einfaltspinsel bisher überlebt hat, ist mir ein Rätsel. Ein Pirat tätschelte seine Wange, versetzte ihm einen Klaps, aber Plim atmete auf, als er sah, dass die Pechund Schwefelkübel zum Ausräuchern des Ungeziefers im Unterdeck verwendet wurden.
–Trink! Der Kapitän mit dem unaussprechlichen Namen reichte ihm eine bauchige, schilfumflochtene Weinflasche. Dein Glück, dass wir Flaute haben, sonst wärst du jetzt Fischfutter. Wir unterhalten uns später. Seine Narbe glänzte in der Sonne, und zwei Zähne blitzten im Gesicht.
– Sollen wir ihn zum Reden bringen? Ein Pirat packte Plims Haar, riss ihm den Kopf nach hinten.
– Noch nicht. Der Kapitän war von der Mannschaft gewählt worden, weil er schussfest und tapfer war, geschickt verborgen hatte, dass er Grausamkeiten verabscheute. Den Männern reichte sein Herumnörgeln an ihrer Kleidung, sein Beharren auf Schönheit und Ästhetik.
[...]