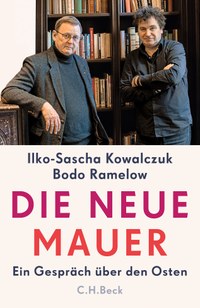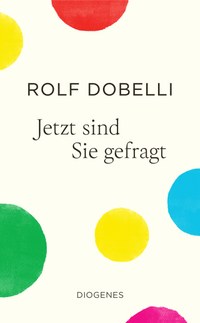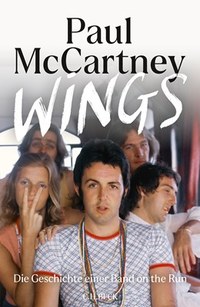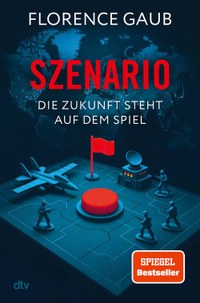Vorbemerkung
Die Demokratie in Deutschland und Europa ist in großer Gefahr. Westeuropa hat sich seit 1945 neu geordnet, 1990 kam Osteuropa mit großen Hoffnungen dazu. Der Aufbruch von 1990 hat sich in Sorge, Frust und Angst gewandelt, und ständig wird gezündelt. Der Aufstieg von Extremisten und Oligarchen nun auch in der westlichen Welt verunsichert viele Menschen. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die Vorgänge in den USA lassen erahnen, was noch kommen könnte. Wir denken gar nicht daran, den Demokratie- und Verfassungsfeinden das Feld zu überlassen. Demokratie und Freiheit sind das Wichtigste, das wir haben.
Natürlich, es gibt viel zu verändern, zu verbessern, die soziale Ungerechtigkeit hat demokratiezersetzende Ausmaße angenommen. Viele globale Probleme sind inzwischen existenzbedrohend. Für uns in Deutschland und Europa steht an erster Stelle die Bedrohung der liberalen Demokratie durch den Kreml. Putins Krieg gegen die Ukraine ist kein Stellvertreterkrieg, sondern ein Krieg, bei dem es um Freiheit versus Unfreiheit, Demokratie versus Diktatur geht – und nicht nur um Territorien und Ressourcen.
Als uns der Verlag ansprach und fragte, ob wir in einem Gespräch über einige grundlegende Probleme unserer Zeit diskutieren wollen, waren wir sofort bereit dazu. Uns war bewusst, dass wir in manchen Fragen unterschiedlicher Auffassung sind. Aber tatsächlich überwiegen die Gemeinsamkeiten, nämlich die Sorge um unsere Demokratie und die Zukunft Europas. Das Gespräch dreht sich im Wesentlichen um den Osten, weil wir glauben, dass viele Entwicklungen in Ostdeutschland wie unter einem Brennglas zeigen, was sich anderswo ähnlich vollzog – nur später und langsamer – oder noch vollziehen könnte.
Wenn wir heute, 35 Jahre nach der deutschen Einheit, in einen echten Einheitsprozess einsteigen wollen, der das Wort Einheit als neue Gemeinsamkeit begreift, dann müssen wir umdenken. Wir sollten die Unterschiede zwischen Ost und West weder einfach hinnehmen noch einebnen, vielmehr sollten wir die Unterschiedlichkeit als unsere besondere Stärke verstehen. Deutschland ist eines: vieles! Das steht nur scheinbar im Widerspruch zum Buchtitel.
Im Osten beobachten wir eine vielfache Abkehr von demokratischen Grundwerten, im Westen stehen viele den Sorgen in den neuen Bundesländern zunehmend gleichgültig gegenüber. Die Bundestagswahlergebnisse lassen auf den ersten Blick einen tiefen Riss erkennen, der quer durch das Land geht. Aber die neue Mauer verläuft nur scheinbar entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, in Wirklichkeit ist sie in den Köpfen.
Mit Sorge blicken wir deshalb auf den 14. September 2025, wenn bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen rund 12,5 Millionen Wahlberechtigte – knapp zwei Millionen mehr als in den neuen Bundesländern zusammen – zur Wahl von Bürgermeistern und Landrätinnen aufgerufen sind.
Wir haben dieses Buch zusammen erarbeitet, weil wir glauben, dass Demokraten trotz aller Differenzen fest zusammenstehen müssen, um die Demokratie zu stabilisieren und um autoritäre Verhältnisse zu verhindern. Unterschiedliche Auffassungen müssen und sollen klar benannt werden, der Widerspruch und der Austausch von Argumenten gehören in der freiheitlichen Demokratie zu den grundlegenden Werten, die Meinungsfreiheit überhaupt erst begründen.
In einer Zeit, in der die politische Debatte auf so vielen Ebenen der Gesellschaft empfindlich gestört zu sein scheint, sehen wir unser Gespräch als ein Zeichen der Ermutigung. Wir danken dem Verlag C.H.Beck, namentlich dem ehemaligen Cheflektor Detlef Felken, für die Idee und das Zustandekommen dieses Bandes. Ohne die tatkräftige Arbeit von Thomas Karlauf wäre aus unseren mehrtägigen Gesprächen kein lesbares Buch geworden. Ganz herzlichen Dank dafür!
Ilko-Sascha Kowalczuk / Bodo Ramelow
Berlin und Erfurt am 6. Mai 2025, 35 Jahre nach den ersten freien und demokratischen Kommunalwahlen in der DDR
Die Gesprächspartner stellen sich vor
Ilko-Sascha Kowalczuk
Ich bin in Ost-Berlin geboren und groß geworden. Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn man in Greifswald aufwuchs oder in Dresden. Zu meinem Alltag gehörte, dass ich wusste, was sich in meiner Heimatstadt West-Berlin in den Clubs abspielt, was in den Kinos läuft. Wir hatten ein wenig Westgeld, und meine Oma hatte ein Konto in West-Berlin. Mit einem Teil meines Wesens lebte ich immer im Westen. Und nicht nur ich, sondern fast alle Menschen, die ich kannte – das war nichts Besonderes. Das Besondere war eher der Kontext, aus dem ich kam.
Ich kam aus einem sehr politisierten, staatsnahen Elternhaus. Mein Vater, Ilko Bohdan, war ein kluger, vom Kommunismus und vom Sozialismus sehr überzeugter Mann. Mein Großvater väterlicherseits hingegen, Ilko, war ein ukrainischer Freiheitskämpfer, ein Nationalist, der für eine unabhängige Ukraine kämpfte, und dafür wurde er 1921 zum Tode verurteilt. Er konnte am Vorabend der geplanten Hinrichtung befreit werden und wurde ins Ausland, nach Böhmen, nach Leitmeritz / Litoměřice gebracht. In Böhmen gab es eine große ukrainische Diaspora mit etwa 800.000 aus der Ukraine Geflüchteten. Außerdem residierte im nahen Prag ein ukrainischer Bischof, was für meinen strenggläubigen Großvater wichtig war.
Er kam 1934 wenige Monate vor der Geburt meines Vaters bei einem Eisenbahnunglück ums Leben. Dieser Großvater war permanent Thema bei uns. Wir haben auch ukrainische Weihnachten gefeiert und am 6. Januar immer Piroggen gegessen. Als ich anfing, mich mit 15, 16 Jahren vom DDR-Staat zu emanzipieren, sagte meine Tante, die Tochter meines ukrainischen Großvaters, die in Rostock Russischlehrerin war: »Wenigstens dein Großvater wäre stolz auf dich.«
Mein anderer Opa kam aus Schlesien, aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ein Bruder von ihm ist als Leutnant oder Oberleutnant der Wehrmacht zu Weihnachten 1943 vom Essen aufgestanden mit den Worten: »Der Herrgott wird uns das nie vergeben, was wir im Osten machen«, ist ins Nachbarzimmer gegangen und hat sich erschossen. Mein Opa überlebte den Weltkrieg und wurde harter Antikommunist, weil sie ihm in der DDR alles genommen haben, obwohl er nur ein einfacher Soldat war.
Meine Mutter schleppte irgendwann 1961 meinen Vater an. Mein Vater wollte ursprünglich Priester werden, auch vor dem Hintergrund seines zum Tode verurteilten Vaters. Dann trat er aus der Kirche aus und wollte bei der Stasi arbeiten. Aber die haben ihn nicht genommen: »Du sagst ja nicht mal deiner Mutter, dass du in der SED bist, so feige biste.« Mein Vater war ein Überzeugungskommunist. Und weil er ein relativ bekannter Fußballspieler in Ost-Berlin war, war er der Einzige, der in den Kneipen in Friedrichshagen als Kommunist einen Platz an den Stammtischen hatte. »Wenn alle Kommunisten so wären wie Ilko, dann würde es was mit dem Kommunismus werden.« Das stimmte zwar nicht, zeigt aber, dass mein Vater trotz seiner Überzeugungen durchaus anerkannt war; er war ein guter Mensch, der immer für andere da war und der seine politischen Überzeugungen nicht versteckte. Er war aufrecht und ehrlich.
Meine Mutter sagte häufiger zu ihm, er solle sich doch etwas mehr zurückhalten; wenn es mal anders käme, wäre er der Erste, der am Baum hinge. Auch das kam anders.
So wie ich von meinem Vater erzogen wurde, war klar, dass ich als kleiner Junge den Sozialismus mit allem, was ich hatte, verteidigen wollte. Mit zwölf Jahren habe ich gesagt: Ich möchte Offizier werden. Überall herrschte Personalmangel, insbesondere bei den Sicherheits- und Armeebeurufen. Wer sich da frühzeitig meldete, wurde sofort erfasst. Obwohl man sich eigentlich erst mit 14 melden konnte, hat man mich gleich vorgemerkt. Mit 14 wurde ich ins FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen, das war ein feierlicher Akt. Wenig später habe ich mit diesem »Kollektiv« an einer Fahrt nach Suhl teilgenommen.
In dem Ikarus-Bus wurde an uns 14-Jährige Alkohol ausgegeben, alle im Bus durften rauchen, in Suhl durften wir dann auf Flugtauben schießen. Es waren sehr üble zwei Tage, total skurril. Ich hatte vorher schon Bauchschmerzen, aber in Suhl wurde ich dann endgültig geheilt. Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich Angst davor hatte, nein zu sagen, vor allem auch Angst, meinen Vater zu enttäuschen. Aber dann habe ich nein gesagt. Damit brach meine ganze bisherige Welt zusammen.
Viel schlimmer war: Ohne dass ich mich im Geringsten verändert hatte, ohne dass ich mich auch nur einen Schritt bewegte, wurde aus einem hoffnungsvollen künftigen Kader ein Staatsfeind gemacht. Die ließen nicht locker. Anderthalb Jahre lang musste ich in der Schule, vor dem Wehrkreiskommando, vor der Partei, vor der Staatssicherheit, oft in Anwesenheit meiner Mutter, immer wieder aufs Neue meinen Sinneswandel erklären. Manchmal musste ich stundenlang vor denen stehen, vor Menschen, die ich überwiegend nicht kannte.
Irgendwann gab es ein letztes Gespräch. Da hat man mir in Gegenwart meiner Mutter prognostiziert, dass ich über kurz oder lang in den Verwahranstalten des sozialistischen Strafvollzugs landen werde. Warum ich so undankbar wäre, da ich doch wissen müsste, was ich den Staat bereits gekostet hätte. »Schreiben Sie mir eine Rechnung«, sagte ich, wie meine Mutter mir später berichtete, »ich werde diesem Staat das auf Heller und Pfennig zurückzahlen.« Meine Mutter glaubte, wir würden nun weggesperrt werden.
Das Schlimmste an dem ganzen Vorgang: Mein Vater war so enttäuscht von mir, dass unsere Beziehung in eine Dauerkrise geriet. Er verriet mich an den Staat, dem er diente, obwohl er so intelligent war. Ich zweifelte nie an seiner Liebe mir gegenüber, aber es kam zum Bruch, weil ich nicht mehr mitmachen wollte, wie er sich das vorgestellt hatte. Auch ihn setzten Partei, Stasi und Staat nun unter Druck, aber dafür hatte ich natürlich keine Augen – ich war selbst in einer tiefen Lebenskrise mit 14, 15, 16 Jahren, obwohl mein Leben noch gar nicht richtig angefangen hatte. Im Prinzip prägte dieser Einschnitt mein ganzes weiteres Leben.
Erst als 2005 unser ältester Sohn Max zwölf wurde, ist mir die ganze Dimension bewusst geworden, die ich damals durchleben musste. Es war wie eine Retraumatisierung. Mit meinem Vater konnte ich mich ab dem Herbst 1989 ansatzweise mehrfach aussprechen, 1992 kam er bei einem Unfall ums Leben. Ihm tat alles sehr leid, was ich ihm abnahm. In einer Therapie in den 2000er Jahren konnte ich die Liebe meines Vaters spüren, und zugleich entdeckte ich dabei, wie stark mich mein ukrainischer Großvater im Griff hatte: Ich fühlte mich seiner Mission sehr stark verbunden.
Wohlgemerkt, ich war kein Widerständler. Ich versuchte zu gefallen, ich versuchte irgendwie wieder anzukommen in der DDR. Ich versuchte Kompromisse zu machen und verhielt mich opportunistisch. Das hat aber alles nicht funktioniert, weil der Staat von mir nichts mehr wissen wollte. Ich konnte zunächst kein Abitur machen. Ich bin Maurer geworden und war anschließend Pförtner. Das war eine lehrreiche Zeit mit vielen Privilegien in der Diktatur: Ich hatte Zeit, und niemand wollte etwas von mir.
Aufgefangen haben mich meine vielen Freunde, die überwiegend aktiv in Kirchen unterwegs waren. Ich war entschlossen, in der DDR die DDR zu verändern, endlich sozialistisch, also freiheitlich zu machen. Viele gingen weg, ich nicht. Daher machte ich immer wieder Kompromisse, absolvierte auch den Grundwehrdienst, eine sehr schlimme Zeit. Ich hasste nicht nur die ganzen Mitmacher der Diktatur, ich hasste auch mich selbst wegen meiner Kompromisse.
1989 bin ich dann befreit worden, befreit von meinen Ängsten, befreit von meinem Opportunismus, befreit von meinem Mitmachen. Ich war aber auch Teil der Freiheitsrevolution, engagierte mich und hörte nie wieder auf, mich politisch einzubringen. Nie wieder hätte ich das Recht, politisch pessimistisch zu sein, so schwor ich mir damals. Nie wieder hätte ich das Recht, nicht für Freiheit und Demokratie zu kämpfen!
In der DDR war ich zwar nicht das, was ich im Rückblick gern dort gewesen wäre. Aber dafür bin ich in der Bundesrepublik auch nicht das geworden, wovon ich träumte. Also: alles gut.
Bodo Ramelow
Ich sage immer, Ostdeutsche und Westdeutsche sprechen die gleiche Sprache, sind aber völlig anders sozialisiert, und daraus entstehen spannende Dinge.
Als ich 1990 nach Thüringen kam, dachte ich, ich hätte manches von der DDR verstanden, weil ich seit Anfang der Achtzigerjahre regelmäßig in die DDR gereist war, meist privat über den kleinen Grenzverkehr. Auf diese Weise konnte man ohne Voranmeldung in die DDR reinfahren, bekam seinen Stempel in die Stempelkarte und durfte 48 Stunden bleiben. Für Leute aus Marburg, wo ich damals lebte, war Salzwedel der äußerste Punkt, den man erreichen konnte. Die Familie meines Vaters stammte von dort.
Ich bin bei Verwandten untergekommen, habe Dorffeste erlebt und abends in der Konsumkneipe gesessen. Als Wessi, der alle Arbeiterlieder kannte und textsicher war, habe ich in der Konsumkneipe revolutionäre Lieder gesungen.
Die DDR war für mich damals eine fremde Welt, eine Welt, die seltsam funktionierte. Wenn zum Beispiel der Postbote kam, in diesem Dorf mit 90 Einwohnern und einer Hauptstraße, dann sagte mein Halbbruder zu mir: »Das ist Stasi-Müller!« Damit konnte ich gar nichts anfangen. Die nächste Postkarte an meinen Bruder habe ich adressiert: Platz der Revolutionäre 1. Ich wollte als Wessi einfach mal dummes Zeug machen. Es ist aber nichts passiert, die Postkarte wurde anstandslos zugestellt.
Als ich 1992 Stasiunterlagen über mich anforderte und feststellen musste, dass es über mich gar nichts gab, war ich tief enttäuscht. Stasiakten sind der letzte Dreck. Meine damalige Sekretärin, die völlig unbelastet war, konnte gar nicht aushalten, was sie da alles über ihren Vater und ihre Familie zu lesen bekam. Ich musste sie erst mal in den Arm nehmen und sie trösten.
In Gotha sind 1990 Stasiakten frei auf dem Marktplatz verteilt worden, ohne dass jemand an die Folgen dachte, die das für Menschen haben konnte. Bei einer meiner Mitarbeiterinnen, die beim MfS hauptamtlich als Schreibkraft tätig gewesen war, aber nie einen Tag für die Stasi gearbeitet hat, stellte sich heraus, dass der eigene Ehemann der IM war. Der DGB hat sie wegen falscher Angaben fristlos entlassen. Ich war der zuständige Gewerkschaftssekretär und habe ihr Rechtsschutz gewährt.
In diesem Zusammenhang habe ich angefangen, mich mit Stasiakten zu beschäftigen. Dabei habe ich durch Zufall einen OibE enttarnt, ohne dass ich wusste, was ein OibE ist – ein Offizier im besonderen Einsatz; ich hatte das Wort noch nie gehört. So bin ich etwas tiefer in diese Materie eingedrungen, die mich ursprünglich gar nicht interessiert hat, und habe begriffen, wie dürftig meine früheren Vorstellungen über die DDR waren. Aufgrund meiner verwandtschaftlichen Beziehungen hatte ich geglaubt, die DDR ganz gut zu verstehen. Als ich dann herkam, stellte ich fest, ich hatte gar nichts verstanden.
Im Spätsommer 1989, wenige Wochen vor dem Mauerfall, war ich mit meinen Kindern wieder einmal bei meinem Halbbruder. Seine Kinder kommen mittags aus der Schule, und mein Halbbruder fragt: »Wer hat denn heute in der Schule gefehlt?« Der ist aber fürsorglich, denke ich bei mir, fragt seine Kinder nach den Mitschülern. Erst ein Jahr später habe ich begriffen, dass er etwas ganz anderes wissen wollte, nämlich ob Mitschüler mit ihren Eltern abgehauen waren und jetzt vielleicht in der Prager Botschaft saßen.
Mit meiner Schwägerin, die beim FDGB arbeitete, habe ich manchmal über Gewerkschaftsarbeit geredet. Ich habe nichts von dem verstanden, womit sie sich beschäftigte. Der sogenannte Freie Deutsche Gewerkschaftsbund war nur dem Namen nach eine Gewerkschaft, überhaupt nicht vergleichbar mit dem westdeutschen DGB. In der DDR war die Gewerkschaft Träger der Sozialversicherung, also der Renten- und Krankenversicherung, und Träger des FDGB-eigenen Feriendienstes der DDR.
Der Kultur- und Sozialfonds in jedem Betrieb, das Bonifizierungssystem, war das, was hauptsächlich verhandelt wurde: wie man Feiern organisiert oder in welches Theater man geht. Nach dem Selbstverständnis des FDGB waren das Tarifverhandlungen. Meine Tarifverhandlungen sahen anders aus. Meine Tarifverhandlungen waren Kampf, und als ich 1990 nach Thüringen kam, musste ich den Menschen erst einmal sagen: Wenn wir den Kampf gewinnen wollen, müsst ihr in den Streik treten.
In den Streik treten heißt Arbeitsverweigerung, heißt, eine sehr persönliche, sehr individuelle Entscheidung treffen, heißt immer auch Angst überwinden. Hinterher, wenn die Streikfront steht und der Streik erfolgreich ist, heißt es, das war das Kollektiv. Aber erst einmal geht es um Entscheidungen von Individuen, und die sind immer mit Angst verbunden.
Als Streikleiter darf man nie den Respekt vor dem einzelnen Streikenden verlieren, der die Angst überwinden muss – die Angst vor dem Verlust von Einkommen, vor der Kündigung, vor einem schlechten Zeugnis. Das entsprechende Bewusstsein zur Übernahme persönlicher Verantwortung war in Ostdeutschland nicht ausgeprägt.