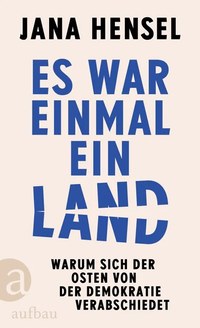Aus dem Kapitel Vor fünfhundert Jahren, in fünfhundert Jahren
Blicken wir einmal zum Ende des Mittelalters zurück: Amerika war gerade entdeckt worden. Luther hatte die Reformation in Gang gesetzt. Der Buchdruck war soeben erfunden, und noch gab es Hexenverbrennungen. Die Erfindung der Dampfmaschine lag noch zweihundert Jahre in der Zukunft, und mit ihr die Industrialisierung. Menschen lebten überwiegend in Dörfern. Die damaligen Städte waren im Vergleich zu den heutigen Metropolen winzig. Befestigte Straßen waren die Ausnahme. Von der heutigen Wissenschaft waren noch nicht einmal die Grundzüge bekannt. Newton, Pascal, Watt und Kant waren noch nicht geboren.
[…]
Gerade das zwanzigste Jahrhundert hat eine ständige Beschleunigung der technologischen Entwicklung mit sich gebracht. Selbst wenn wir uns entgegen allen Anzeichen nicht so progressiv weiterentwickeln sollten wie in den letzten einhundert Jahren, werden wir uns in fünfhundert Jahren sehr stark verändert haben. Wie wird die Welt dann aussehen?
Stellt man sich diese Frage, so bemerkt man, dass man meist kaum über die nächsten zehn Jahre hinaus denkt. Viele planen für noch kürzere Zeiträume, und das längste, was in der persönlichen Planung vorkommt, ist meist ein Zeitraum bis zur Rückzahlung eines Hausbaudarlehens oder das Ende des eigenen Lebens. Es erscheint uns ungewohnt, weiter zu denken. Das ist vollkommen natürlich. Im Leben im Urzustand hatte es keinen Sinn, sich Sorgen um die Zeit nach dem eigenen Tod zu machen. Erst die Entwicklung von Kultur, Besitz und Macht hat längerfristige Überlegungen sinnvoll gemacht. Was vererbe ich wem? Was kann ich an meine Kinder weitergeben? Kann ich der Nachwelt etwas Geistiges hinterlassen oder mein Andenken über meinen Tod hinaus erhalten? Kann das, was wir jetzt tun, später zu Katastrophen führen?
Aus dem Kapitel Menschliche Eigenschaften aus der Steinzeit und ihre heutige Wirkung
Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir alle gleich seien, hätte sie uns so geschaffen. Dann wäre ein Mensch dem anderen so ähnlich wie für uns eine Ameise der anderen. Wenn es in einer steinzeitlichen Gruppe Menschen gibt, die sich mehr für die Jagd interessieren, andere eher ruhig sind und mehr beobachten und nachdenken, wieder andere neugierig sind und vieles sammeln, dann führt das zu einer Arbeitsteilung, bei der sich jede und jeder auf das konzentriert, was sie oder er besonders gut kann. Es wird Tätigkeiten geben, die unerlässlich sind und von jedem ausgeführt werden, und solche, die nur von wenigen beherrscht werden. Wir sind so, wie wir sind, weil dies optimal für die Arterhaltung war. Und dazu gehört, dass die Evolution uns hat unterschiedlich werden lassen, damit wir einander ergänzen können. So gesehen, hat die Natur die Arbeitsteilung erfunden, nicht der Mensch.
Gäbe es nur ausgeprägt mutige Menschen, so hätten sie sich auf den nächsten Bären gestürzt und wären tot. Wären alle Menschen ausgeprägt ängstlich, so wären sie nicht auf die Jagd gegangen und anschließend verhungert. In einem modernen Team braucht man Pessimisten und Optimisten, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ein Optimist sieht zu wenig die Gefahren, ein Pessimist zu wenig die Chancen. Wären alle in gleichem Maße ausgeprägt neugierig, gierig, schnell, so hätte das einen steinzeitlichen Clan eher aussterben lassen.
Auch wenn man uns (was manche denken) in schöne, mutige Starke gegenüber den hässlichen, ängstlichen Schwachen einteilen könnte, gäbe es uns nicht mehr. Wären alle besonders Intelligenten auch gleichzeitig besonders mutig, wären vielleicht alle Intelligenten von einem Bären getötet worden. Daher ist es von Vorteil, wenn die Fähigkeiten eher zufällig und unregelmäßig verteilt sind. Wir stammen von den Vorfahren ab, die nicht ausgestorben sind, und das waren offensichtlich die, bei denen mehr Vielfalt herrschte.
Ebenso strebt die Evolution nicht grundsätzlich nach mehr von allem, sondern nach einem optimalen Maß. Jedes Mehr bedeutet auch mehr Energieaufwand, und dies ist in einer natürlichen Umgebung ein Nachteil bezüglich der Arterhaltung. Beim Menschen ist die körperliche Kraft ein solches Beispiel. Unsere Muskeln sind deutlich schwächer als die unserer nächsten Verwandten, der Menschenaffen. Unsere Vorfahren waren wesentlich stärker, sie hatten mehr Muskelkraft bei vergleichbar großen Muskeln, so wie es bei Affen heute noch der Fall ist. Es gibt auch heute noch einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die körperlich wesentlich leistungsfähiger sind als der Durchschnitt – manche sogar bis ins hohe Alter. Trotzdem setzt sich diese Eigenschaft nicht genetisch durch. Es scheint aus Sicht der Evolution ausreichend, wenn einige wenige mehr Kraft besitzen. Die Regel vom Schulhof, dass sich der Stärkste durchsetzt, scheint nicht optimal für unsere Arterhaltung zu sein.
- - -
Aus dem Kapitel Unsere Werte bestimmen unsere Welt
Adam Smiths Idee hat zwei Haken: Ziel unternehmerischen Handelns ist einzig der Gewinn. Gemessen wird ausschließlich in Geldwert. Andere Ziele und Werte wie Glück, Gerechtigkeit, Fairness, Barmherzigkeit, Solidarität und Nächstenliebe, Demokratie, Umweltschutz, Ressourcenschonung, Ruhe und Entspannung, ein langes Leben, Frieden und Freiheit zählen bei unternehmerischen Entscheidungen kaum oder gar nicht. Dass unser Wirtschaftssystem unter diesen Bedingungen sein postuliertes Ziel der optimalen Versorgung aller durch fairen Wettbewerb erreichen kann, halte ich für ausgeschlossen.
Manch einer wird jetzt erwidern wollen, man könnte die anderen Werte in Geld umrechnen. Das ist meiner Ansicht nach aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Eine lineare Betrachtung nur des Geldwertes wird vielen Situationen nicht gerecht. Eine solche Skala ist willkürlich gewählt und schafft Maßstäbe, die klarer aussehen, als sie sind. Man wird darauf konditioniert, in Geldwerten zu denken und diese zum einzigen Maßstab zu erklären. Es ist jedoch nicht alles handelbar, und „Güter“ bleiben nicht vom Markt unbeeinflusst, wenn sie gehandelt werden – würden Freundschaften, Nobelpreise und ähnliches vermarktet, so würden sie genau dadurch ihren Wert verlieren.
Jeder neue Handel eines Gutes oder einer Dienstleistung bewirkt darüber hinaus eine Festigung dieses Denkens in Geldwerten. Diese zunehmende Ausbreitung des Markt-Denkens lässt auch uns nicht unberührt. „Ökonomen gehen davon aus, dass Märkte die von ihnen gelenkten Güter unversehrt lassen. Doch das ist nicht wahr. Märkte beeinflussen die gesellschaftlichen Normen. Häufig zerfressen oder verdrängen Marktanreize andere, marktfremde Normen.“ Adam Smiths „unsichtbare Hand“ bewirkte also auch, dass sich das ständige Denken an Geld in der Gesellschaft etablierte. Selbst wenn Egoismus alles zum Guten wenden könnte, wäre es immer noch Egoismus. Dieses Denken erstreckt sich dann auch auf andere Bereiche: „Lohnt es sich, die Oma in ein teures Pflegeheim zu geben?“
Ein Beispiel dafür ist das Verhalten der Menschen vor und nach der Währungsreform von 1948. Während die Versorgung vor der Reform weitgehend über Nachbarschaftshilfe erfolgte, etablierte sich danach der Handel, wie wir ihn kennen, und alle schauten nur noch aufs Geld. Davor wurde Solidarität gefordert und gefördert, danach Egoismus. Wo es kein Geld gibt, sind die Menschen stärker zur Zusammenarbeit genötigt. Dass es bei uns alles gegen Geld gibt, trägt zur Entsolidarisierung bei. Die Marktwirtschaft durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens.
Ich denke, wir bekommen heute die Auswirkungen davon zu spüren, dass Adam Smiths Beobachtung zu sehr verallgemeinert wurde. Geld ist als Mittel zum Tauschen erfunden worden. Tauschgeschäfte wurden dadurch erleichtert, dass man nun nicht mehr in halben Hühnern rechnen musste, also der Tausch auch von kleineren Mengen erleichtert wurde und man Werte aufbewahren konnte. Ein halbes Huhn hält nicht sehr lange. Geld hat jedoch keinen inneren Wert. Mit Papiergeld könnte man im Notfall heizen, Geld auf der Bank hat jedoch gar keinen immanenten Nutzen. Dementsprechend sollten wir Geld behandeln, da es sonst unser Streben in eine falsche Richtung lenkt. Es ist ein Mittel zum Zweck – ein Werkzeug.
Wenn man das Streben nach Gewinn als den maßgeblichen Regelungsmechanismus mit Geld als Messgröße wählt und den Menschen erzählt, es sei eine gute Lösung für alle Probleme, schön gierig zu sein, braucht man sich hinterher nicht zu wundern, wenn moralische Krüppel das Geschehen bestimmen. Es ist absurd, auf dem Wühltisch immer nur nach dem Billigsten zu suchen und sich gleichzeitig darüber aufzuregen, dass es keine Moral mehr in der Welt gibt. Das eine ist das andere. Das beständige Vergleichen von Preisen und Leistungen auf der Suche nach dem billigsten Angebot stellt einen wesentlichen Teil unseres täglichen Handelns dar und befeuert den Wettbewerb. Ebenso ist die ewige Suche nach dem Schnäppchen die Ursache dafür, dass uns häufig Halbfertiges und Schrott verkauft wird. Und da die Arbeitgeber das genauso betreiben, bewegen sich auch Löhne immer an der Untergrenze des Möglichen.
Wird auffallend egoistisches Verhalten mit dem Spruch kommentiert: „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“, so lachen meist alle Anwesenden. Die Idee von Adam Smith drückt dasselbe aus – und viele Menschen glauben, dass diese Haltung in wirtschaftlichen Belangen funktionieren würde.
Aus dem Kapitel Unser Sozialverhalten verändert sich
Der neolithische Mensch musste sich anpassen, um zu überleben. Wer sich mit seiner Gruppe überwarf, konnte ausgeschlossen und in einer feindlichen Umgebung auf sich selbst gestellt sein. Mit den Stufen der Bewusstwerdung und Individualisierung ging die bedingungslose Anpassung zurück, und seit dem Ende der Monarchien und Diktaturen wird sie in Europa immer weniger stark eingefordert. Die Dominanz von Staat und Religion schwindet seit Jahrzehnten. In der Berufswelt verlieren Hierarchien an Bedeutung. Der Weg in die Freiheit bedingt sich wechselseitig mit der Differenzierung unseres Geistes und unserer Gesellschaft. Herauszufinden, wer man selber ist, und dies zu leben, ist der weitere Weg unserer Entwicklung.
Je mehr wir uns befreien, desto mehr Entscheidungen müssen wir treffen. Die Ehe des neunzehnten Jahrhunderts war ein klarer Fall, wollte man sich nicht außerhalb der Gesellschaft stellen: endgültig, ohne Ausnahmen und verpflichtend. Hatte man seinen Partner gewählt oder wurde man erwählt, gab es keine weiteren Entscheidungen zu treffen – alles Kommende musste man nur noch aushalten. Heute kann man seine Ehe oder Beziehung beenden, wenn man möchte. Dies wirft beständig die Frage auf, ob das, was man gerade lebt, richtig ist. Die gewonnene Freiheit befreit vom Leiden unter den Zuständen und erzeugt den Druck, sich zu entscheiden. Man braucht viel Reife und Kraft, um neu gewonnene Entscheidungsmöglichkeiten auszuhalten. Wir sind alle mehr oder weniger in Hierarchien aufgewachsen und daran gewöhnt. Jedes Mehr an Freiheit birgt die Gefahr, dass wir uns orientierungslos fühlen. Also müssen wir zuerst lernen, neue Freiheit zu ertragen, auszufüllen und damit umzugehen. Wir können uns als Menschheit nur weiterentwickeln, wenn wir unsere Kinder ermutigen, mit mehr Freiheit umzugehen, als wir selbst aushalten können.
Eine Möglichkeit, unerträglicher Freiheit zu entfliehen, besteht in der Unterordnung. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das Wir, gibt dem entfremdeten Menschen Identität und Halt. Es erfordert lediglich, dass man sich dem Diktat der Mehrheit unterwirft und sich bemüht, nicht aufzufallen. Ein Leben als Individuum dagegen ist nur möglich, wenn man „eine produktive Orientierung“ hat und „sich zur Welt in Beziehung“ setzen kann, „ohne in ihr unterzugehen“. Die Vereinfachung unseres Lebens durch Regeln und Verbote kommt also unserer beschränkten Fähigkeit zur Freiheit entgegen. Zu jedem Entwicklungsstand der Menschheit gehört auch ein Grad an (Un-)Freiheit. Während der eine sich in einem Job mit genau definierten Abfolgen von Tätigkeiten wohlfühlt und sich auch nach Feierabend gerne zu festen Zeiten mit seinen Freunden trifft, lässt ein anderer das Leben als Freiberufler auf sich zukommen und ist ständig in wechselnde Zusammenhänge eingebunden.
Ich glaube nicht, dass die Ausprägungen der Jugendkultur oder die Veränderungen der Mode rein zufällig oder ausschließlich Ausdruck unserer Kreativität sind. Betrachtet man die Entwicklung seit dem Jahr 1900, so hat jede Mode, jede Stilrichtung mit einem Tabu gebrochen – und wahrscheinlich war es auch in der Zeit davor nicht anders. Seit den Impressionisten wird Kunst nicht mehr an ihrer Präzision gemessen, seit den Expressionisten muss sie nicht mehr gegenständlich sein, und seit der modernen Kunst muss sie nicht mehr schön sein. Vor hundert Jahren trugen Männer auf der Straße grundsätzlich einen Hut. Ausschließlich Männer gingen zum Fußball oder in eine Kneipe. Frauen gingen nur zum Einkaufen vor die Türe. Eine Frau in einer Kneipe war per Definition eine Prostituierte. Das hat sich durch die Emanzipation grundlegend verändert. Die Freikörperkultur ist seit über hundert Jahren dabei, sich zu etablieren. Seit den Beatniks dürfen wir Jeans tragen. Heute dürfen wir Sex vor der Ehe haben und mit wem wir wollen. Wir müssen heute nicht mehr ein Leben lang einem Partner „treu“ sein. Die gefallenen Tabus und Regeln stellen unseren Weg in die Freiheit dar. Jeder derartige Zugewinn an Freiheit ermöglicht mehr Individualität.
In den Sechziger Jahren begannen Männer, lange Haare zu tragen, galten damit aber in weiten Teilen der Bevölkerung als „Gammler“. Lange Haare etablierten sich erst in den Neunziger Jahren in Form der Grunge-Mode. Dass Männer nicht mehr mit Hut auf die Straße gehen, hat sich nebenher eingeschlichen wie vieles andere. Seit vielleicht zwanzig Jahren müssen Menschen in kreativen Berufen unangepasst aussehen. Hier wurde zur Schau gestellte Befreiung zur neuen Konvention. Und ungefähr seit dieser Zeit darf man auch offiziell schwul oder lesbisch sein, und in manchen Berufen gilt das als cool. Sadomasochismus gilt nicht mehr durchgängig als schmutzig (siehe den Film Fifty Shades of Grey). Ein schlaksiger Junge, vor dreißig Jahren Prototyp des Versagers, kann heute erfolgreich sein. Viele Arten von Drogen sind salonfähig geworden – entgegen den Gesetzen und unabhängig davon, ob dies nun gut oder schlecht für die Konsumenten ist. Computernerds waren früher out und sind heute in, und derzeit beginnen die intersexuellen Menschen – wohl mehr als einhunderttausend in Deutschland –, sich ihren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Unser Verhalten höhergestellten Personen gegenüber hat sich dramatisch verändert. Während früher blindes Gehorchen gegenüber Polizisten oder Vorgesetzten erwartet wurde, darf man heute eine Erklärung fordern und seinen eigenen Standpunkt äußern. In Mode, Musik, Kunst, Kultur und Sexualität wird mit jedem Jahrzehnt ein weiteres Tabu gebrochen.
Ist eine Gesellschaft dogmatisch, so drückt sich dies in Tabus aus. Es muss sich zunächst ein hoher Veränderungsdruck aufbauen, der sich dann im Tabubruch entlädt. Ist die Gesellschaft offen für Neues, so kann eine Veränderung dann beginnen, wenn die Zeit reif ist. In dieser Hinsicht haben wir uns in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Wir sind heutzutage eher in der Lage, jeden tun zu lassen, was er möchte.
Aus dem Kapitel Bildung und Reife
Menschen vor Beginn der Zivilisation erhielten wie alle anderen Tiere auch heute noch eine angemessenes Rückmeldung für ihr Tun. Übermäßige Aggressivität wurde durch Widerstand der anderen begrenzt, zu viel Gier bei der Nahrungssuche endete mit Bauchschmerzen. Das Sozialverhalten wurde durch Aggressivität und Liebe, durch Angst und Neugier und im größeren Zusammenhang durch Mutation und Selektion geregelt. Durch unsere Sesshaftwerdung, Zivilisation und Gesellschaftsform hat sich das verändert.
Die technologische Entwicklung beschleunigt sich seit dem Zweiten Weltkrieg ständig. Dass Anpassungen an Veränderungen durch die Regierenden überwiegend im Nachgang erfolgen, bedeutet, dass die Regulierungslücke – der Abstand zwischen dem Auftreten eines Problems und der korrigierenden Reaktion des Staates – immer größer wird. Die dissoziierenden Effekte – unsere technologischen Fähigkeiten – übertreffen die regulierenden Zusammenhänge – unsere soziale Reife – derzeit bei weitem. Allein dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwann selbst vernichten. Vogl spricht von einem „weltweiten sozialen Großversuch.“ Falls wir unsere moralischen Fähigkeiten beispielsweise bei der Entwicklung von Atomwaffen überschätzt haben, wird die Evolution das ebenso regeln – zumindest wenn wir auf die Verbreitung von Erkenntnissen warten, bis diese von selbst geschieht. „Diesmal ist die Menschheit an einem Kreuzweg [sic], wo ein falscher Schritt der letzte Schritt sein kann.“ Wird es uns gelingen, die Dynamik umzukehren – dass unsere moralische und soziologische Reife unserer technologischen Reife nicht folgt, sondern ihr vorauseilt?
Die Diskrepanz zwischen unserer schnellen und unkoordinierten Entwicklung und unserer damals geringen geistig-sozialen Reife hätte uns schon mehrmals der Vernichtung nahe gebracht: In der Steinzeit sorgte eine hohe Aggressivität in Kombination mit der Erfindung von Waffen dafür, dass sich unsere Population lange Zeit nicht über einige Zehntausend hinausentwickelte. Auch die Entwurzelung, Vereinsamung und Entfremdung der Menschen infolge der Aufklärung und Industrialisierung hat zu einem hohen Aggressivitätsniveau geführt, das sich in zwei Weltkriegen entlud.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet, heißt das, die Evolution experimentiert auch heute mit uns. Man kann davon ausgehen, dass in unserer Gesellschaft derzeit durch Evolution geklärt wird, wie viel Egoismus oder Altruismus für eine optimale Arterhaltung notwendig sind und ob der Neoliberalismus das überlegene System ist oder nicht. Unsere Reife als Gesellschaft muss sich ebenso progressiv steigern, damit wir die neuesten Technologien auch mental beherrschen. Mein subjektiver Eindruck ist hingegen, dass wir uns unverändert langsam entwickeln. Mit dem oben beschriebenen Wertewandel, den der Neoliberalismus mit sich brachte, erleben wir in einigen Bereichen sogar Rückschritte.
Aus dem Kapitel Vor fünfhundert Jahren, in fünfhundert Jahren
Ebenso wie man jeden Euro nur einmal ausgeben kann, können wir unsere Arbeitskraft nur einmal einsetzen. Wir können uns entscheiden, für welche Entwicklung wir sie nutzen wollen. Ich finde es schade, sie fast ausschließlich für technologischen Fortschritt und Wachstum, also für kurzfristige Erfolge und Scheinerfolge zu verschleudern, statt sie für geistiges Wachstum und geistigen Fortschritt zu nutzen – vor allem, weil wir materiell genug besitzen und es uns leisten könnten, hier auf weiteres Wachstum zu verzichten. Dass wir nach immer mehr Geschwindigkeit, Leistung und Reichtum streben und dabei kurzfristig denken, ist eine der Schattenseiten unserer Evolution. Die Alternative dazu wäre die Suche nach einer besseren Welt.
Wir benötigen eine aktive Gestaltung unserer Zukunft, die sich nicht nur mit organisatorischen, finanziellen, biologischen, technischen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, sondern die auch unsere psychologische und soziologische Entwicklung bedenkt und strukturiert. Warum fangen wir nicht heute mit der Veränderung an?
[…]
Unsere Staatssysteme zielen auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für den technologisch-wirtschaftlichen Fortschritt. Es könnte eine neue Aufgabe für Regierungen sein, mit mindestens derselben Intensität die geistig-soziologische Weiterentwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft zu fördern. Jetzt wird der eine oder andere Leser einwenden, dass eine höhere Gewichtung geistigen Wachstums Geld kostet, das wir nicht für andere Dinge ausgeben können, und wir daher die Veränderung nicht angehen sollten, weil sie unser Wirtschaftswachstum gefährde. Ja, eine solche Entwicklung kostet Geld und damit einen Teil unseres jetzigen und teilweise vermeintlichen Wohlstandswachstums. Und es verhält sich wie mit jeder anderen Investition: Zuerst kostet sie Geld, und in der Zukunft wird sie sich auszahlen. Zu kurz gedacht klingt der Einwand: „Ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, weil ich Holz hacken muss.“