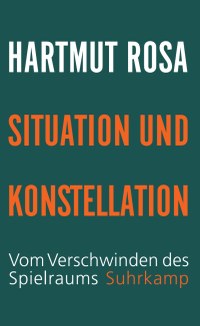Montag, 23. März 2020
»Leonce: ›Tanze, Rosetta, tanze, dass die Zeit mit dem Takt Deiner niedlichen Füße geht‹ – Rosetta: ›Meine Füße gingen lieber aus der Zeit‹.«
Georg Büchner, Leonce und Lena
Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Morgens beim Aufwachen schon, wenn die Luft, die durch das offene Fenster heranzieht, noch eiskalt ist und hilft, die Verwirrung über das Wachsein zu vertreiben. Was ist der Takt der Zeit? Was der richtige Rhythmus? Gehen meine Füße mit der rastlosen Zeit oder aus ihr heraus? Es wird unklarer jeden Tag, den wir in diesem Modus der Pandemie leben, denn sie hat ihre eigene Zeitlichkeit, Zeit, das ist die Währung, in der die Modelle der Virologen Hoffnung und Not quantifizieren, Zeit, die wir hier, in der Mitte Europas, nur haben, weil andere sie nicht hatten, Zeit, in der uns die Bilder aus China schon erreichten und die wir lange verstreichen ließen, als ginge uns das nichts an, ignorante Zeit, jetzt bedauerte Zeit, verlorene Zeit, Zeit, in der wir, die wir seit Jahren über die Globalisierung kritisch oder unkritisch nachdenken, so getan haben, als gäbe es sie nicht, als sei eine Krankheit in China eine Krankheit in China, als stürben sie dort anders als hier, als seien es andere Körper, andere Lungen (ist es das, was wir gedacht haben? Oder haben wir gar nicht gedacht?), als gäbe es das noch: geschlossene Räume, als gäbe es sie nicht: wechselseitige Verwundbarkeit, als wäre es nicht das, was uns human macht.
Was haben wir denn gedacht? Jetzt rückt sie vor, die Epidemie, Region für Region, und erteilt eine Lektion in Demut.
»Tanze, Rosetta, tanze, dass die Zeit mit dem Takt Deiner niedlichen Füße geht« – »Meine Füße gingen lieber aus der Zeit«, heute Morgen ist mir so, nach all den Tagen und Wochen der nervösen Dringlichkeit, mit der jede neue Nachricht, jede Statistik, jede Kurve, jede Grafik im allzu eiligen Rhythmus nachvollzogen wird, heute wollen die Füße aus der Zeit. Wann war das letzte Mal, dass ich morgens den ersten Tee vor den Neuinfektionsraten hatte? Wann habe ich das letzte Mal morgens erst Musik vor den Nachrichten gehört? Wann habe ich zuletzt das Langsame dem Schnellen vorgezogen? Wie wäre es, die Reihenfolge umzukehren: erst Bach zu hören, erst das Ewige in sich einziehen zu lassen, erst sich zu wappnen, und dann Krankheit und Not auf sich einprasseln zu lassen, erst dann sich diesem Tempo zu ergeben, das nicht einmal unrealistisch, nicht aufgeregt, sondern realistisch und angemessen ist.
Seit Abend gilt die veränderte Kontaktbeschränkung, Spazierengehen allein oder zu zweit ist noch erlaubt, das klingt weniger existentiell als es ist, anders gesagt: es ist noch erlaubt, raus zu gehen und sich zu beruhigen, sich zu besprechen, sich zu versorgen, sich zu loten, es ist noch erlaubt, auszubrechen aus der Wohnung, die schon zu eng ist, wenn die Kinder in der Schule und die Eltern bei der Arbeit sind und in der nun alle aufeinander hocken, es gibt noch ein Draußen, es ist noch erlaubt, sich zu retten vor der Melancholie, der Einsamkeit und den Ängsten, die viele in der Isolation befallen, es ist noch erlaubt zu fliehen, vor den Schlägen, der Misshandlung, der Gewalt, die vielen in der eigenen Beziehung drohen.
Heute also ein anderer Takt. Heute keine Todeszahlen vorm Frühstück. Erst Tee, dann Bach, dann beides. Und dann ein Spaziergang. Ich bin Landkarten-Fetischistin. In meiner Wohnung stapeln sich Landkarten, antiquarische, zeitgenössische, sie sind gefaltet, befleckt, markiert, beschriftet, es gibt sie in den verschiedensten Sprachen von den Reisen durch die versehrten Gegenden der Welt, ich bin so versessen auf Landkarten, dass ich mir im Ordnungsamt von Kreuzberg, vor einigen Jahren, bei irgendeiner Pass-Erneuerung, mal eine Bezirkskarte habe schenken lassen. Das »Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauaufsicht« hat Friedrichshain-Kreuzberg im Maßstab 1:12500 kartographiert. Das ist, salopp gesagt, ein echt großer Lappen und es braucht schon eine gewisse Nerdigkeit, um damit in Zeiten digitaler Routenplaner selbstbewusst auf die Straße zu gehen. Aber ich lieb’s. Gäbe es keine Kontaktbegrenzung, würde ich dem »Fachbereich Vermessung«, der die Karte anscheinend hergestellt hat, gleich einen Besuch abstatten und mich bedanken. Egal. Das ist das Programm für heute: einmal um Kreuzberg herum spazieren. Für eine Ausgangsbeschränkung ein recht umfangreicher Spaziergang, fällt mir auf, aber ich könnte es, trotz Spaziertempo auch einfach als Sport ausgeben.
*
Das war ein strahlender Tag. Durch die Straßen Kreuzbergs zu stromern, ohne Absicht, ohne Termin, nur zu spazieren, ohne einzukaufen, fühlt sich seltsam prekär an, als fehlte eine offiziell akzeptable Intention, nicht illegal, aber fast unanständig übermütig. Nur die Hundebesitzer wirken selbstbewusst, weil sie ihren Passier-Schein praktisch-sichtbar an der Leine führen. Es ist eiskalt und die Unterbrechung des Takts der Nachrichten ist wohltuend, auch wenn jeder Straßenzug schmerzt, jedes geschlossene Geschäft wie ein vorauseilender Abschied: wird dieser Laden, dieses Kino, diese Shisha-Bar jemals wieder öffnen können, wer wird diese Zeit überstehen, wessen Existenz wird vernichtet werden? Die Baklava liegen immer noch in den Schaufenstern, aber jetzt »nur to go«, die Leihhäuser sind geöffnet, als ich vor einem stehenbleibe, kommt sofort der Besitzer und will mich einlassen, ich frage mich, ob in den offiziellen Anordnungen Leihhäuser überhaupt gelistet wurden, aber ich hoffe, dass sie zur Kategorie »Bank« zählen. Vielleicht hätte sich früher geschämt, wer hier eintreten muss, vielleicht ist wenigstens das jetzt »normaler«.
Unheimlich wird es bei der Topographie des Terrors, alles still, am Checkpoint Charlie, an dem sonst das idiotische »Re-enactment« durch den Soldat-spielenden Schausteller statthat, an dieser Stelle, an der sonst hundertfach sinnentleerte Selfie-Sucht sich präsentiert – kein Mensch nirgends.
Die Grenze von Kreuzberg verläuft für eine Weile parallel zur früheren Berliner Mauer, im Boden ist eine Linie, der es sich folgen lässt ... und während ich an der unsichtbaren Mauer entlang laufe, frage ich mich, in welchen Bildern, welchen Formen einmal dieser Pandemie gedacht wird? Wie werden wir uns erinnern, woran werden wir uns erinnern wollen, was werden wir leugnen, das es gegeben haben wird, welche Bilder werden zu Ikonen, wessen Erfahrungen werden gewürdigt, wessen nicht, welche Geschichten werden wir erzählen als wären sie wahr?
Bevor auch meine Geschichte im Nachhinein sich verfälscht, möchte ich festhalten: ich habe abgekürzt. Die ganze Strecke um Kreuzberg herum war doch zu lang. Aber ich verspreche: wenn diese Krise vorbei ist, wenn ich heil daraus hervorgehe, werde ich es noch einmal versuchen.
*
Abends beim »Scrabble« versucht meine Freundin das Wort »Axtmord« zu bilden, nun ja, ein bisschen früh im Verlauf der häuslichen Rückzugs-Phase, wie mir scheint, aber wer weiß, was noch kommt – und so winke ich allerlei nicht ganz Duden-sichere Begriffe großzügig durch.
Dienstag, 24. März 2020
»La tierra vive ahora / tranquilizando su interrogatorio, / extendida la piel de su silencio« –
Die Erde lebt leiser nun, / gelinder ist ihr Verhör, / ausgebreitet das Fell ihres Schweigens«
Pablo Neruda
Das schrieb Neruda über den »Garten im Winter«. Es fällt mir ein, in dieser Stille, die sich ausgebreitet hat in Berlin. Die Stille ist unwirklich, nicht, weil sie ungewohnt wäre, sondern weil sie den Lärm, der folgen wird, in sich trägt. Es ist wie bei einem Tsunami: man steht noch mit festem Boden unter den Füßen am Strand und sieht wie sich das Meer zurückzieht – und weiß: das Wasser wird in einer sehr sehr langen Welle heranrauschen. Welche Kraft sie hat, was sie verwüsten kann, was uns (womöglich) erwartet, sehen wir in Bergamo, in Madrid, diese Zeit-Verzögerung, in der wir vorausschauen können, was in ähnlicher Weise auch hier geschehen wird, oder was, wenn es nicht geschehen sollte, dann auch deshalb nicht, weil wir weniger unwissend, weniger ahnungslos gewesen sein werden. Die Gnade der späten Ausbreitung, so widerwärtig und zynisch das klingt, ist leider wahr: je später eine Region getroffen wird, je mehr Erfahrungswissen mit der Krankheit woanders schon gesammelt und weitergegeben wurde, je mehr sich aus gelungenen oder misslungenen Versuchen der Eindämmung der Infektionen an anderen Orten lernen lässt, desto besser (die USA werden vermutlich das selbstverschuldete Gegenbeispiel sein). Das gleicht nicht die sonstigen sozialen, ökonomischen, topographischen Unterschiede aus. Das hilft nicht in »späten Gegenden«, wenn sie strukturell arm und vernachlässigt oder dicht besiedelt sind. Für Megastädte wie Lagos oder Dhakka, Karatchi oder Mexiko-Stadt wird auch der zeitliche Vorsprung kaum ausreichen.
Wir alle haben unterschiedliche Orte, mit denen wir besonders uns verbunden fühlen, der Wald, in dem wir als Kind verschwunden sind, der Fluss, an dem wir uns mit jedem vorbeifahrenden Frachter weggeträumt haben, aber es gibt auch jene Gegenden, die uns als Erwachsene besonders geprägt haben, an denen wir hängen, in denen sich etwas der eigenen Lebensgeschichte besonders verdichtet, die wir mit Glück oder mit Begehren assoziieren oder mit besonderen Menschen. Und so denken viele von uns, in dieser globalen Krise, auch an diese nahen-fernen Orte, an die Angehörigen dort, die eigene Community, die Freund*innen. Die erste Stadt, in der ich gelebt habe, nachdem ich zuhause ausgezogen bin, die Stadt, mit der ich Freiheit verbinde, Aufbruch, die erste Stadt, in der ich eine Ahnung entwickeln konnte, wie mein Leben aussehen könnte, war Madrid. Vielleicht ist das der Grund, warum ich die Bilder aus Madrid nicht ertrage. Vielleicht auch, weil ich nicht verstehe, warum Hilfe für italienische und französische Patienten möglich ist, aber nicht für spanische? Nicht für griechische? Nicht für rumänische?
Wo ist Europa? Fällt uns im ersten Moment wirklich nichts Besseres ein als die nationalstaatliche Regression? Meine Körper, Deine Körper? Meine Toten, Deine Toten? Ist das die neue Formel? Wie in der Finanzkrise 2008–2009, meine Schulden, deine Schulden? Die Schulden, die wir jetzt auf uns laden, werden aus anderem Material sein. In den letzten Tagen werden französische und italienische Patienten in unterschiedliche Bundesländer geflogen und hier intensivmedizinisch gepflegt – das ist richtig, das ist genau das, was es braucht. Aber das ist zu wenig. Da sterben Menschen, da können Kliniken in der Lombardei und im Elsass und in Katalonien die Not nicht mehr lindern, da werden die Leichen nur noch abtransportiert und zu Gräbern verbracht, ohne Angehörige, ohne Freund*innen, ohne Abschied. Wo ist Europa? Da harren in Griechenland auf den Inseln Geflüchtete aus, unter beschämenden Bedingungen, da wird das Wasser im Lager von Moria knapp, und während Tausende gestrandete Urlauber in einer beispiellosen Aktion vom Auswärtigen Amt zurück geflogen werden (dank an alle, die das leisten in den Krisenzentren da im AA), da soll es nicht möglich sein, mindestens die unbegleiteten Kinder herauszuholen? Der Fokus auf Kinder hat sich etabliert, als ob es das brauchte, um Mitgefühl zu aktivieren. Als ob nicht nur Masken eine knappe Ressource wären, als wäre das Reservoir für Empathie erschöpft und nur noch für unterernährte, frierende Kindern anzapfbar. Mir sind in allen Lagern, in denen ich je war, vor allem die Männer aufgefallen, die apathisch, niedergeschlagen dort hockten und mit der eigenen Ohnmacht am wenigstens zurecht zu kommen schienen. Aber das spricht schon gar niemand mehr aus: dass es alle Menschen dort herauszuholen gilt. Es traut sich schon niemand mehr, das Selbstverständliche zu fordern, wir haben die Erwartungen an das Asylrecht so heruntergeschraubt, die Erwartungen an europäische und internationale Garantien, an das, was früher einmal ein Rechtsanspruch war und seit langem nur noch als Simulation von Asylrecht besteht, wir haben die Erwartungen an uns selbst, wer wir sein wollen und können, so heruntergeschraubt, dass wir nicht einmal mehr spüren, wie wir versagen.
Es sollte gar niemand unter solchen Bedingungen leben. Niemand in Europa wird sagen können: dies sei unbemerkt geschehen, man habe es nicht gewusst, man habe es sich nicht vorstellen können.
*
Abends gibt es eine Skype-Schaltung nach Jerusalem, damit mir beim Kochen von »Mujadara« meine palästinensische Freundin Salwa über die Schulter schauen kann. Erst hatte ich eine Einkaufsliste diktiert bekommen, nun wurde via Skype strengstens jede Handbewegung kontrolliert, korrigiert, gemaßregelt ... ab und an auch gelobt. Spärlich. »Mujadara«, hatte Salwa mir vorab erklärt, sei ein sehr sehr sehr einfaches Gericht, das würde niemand wirklich »für Gäste« kochen, Gäste, so hieß das implizit, bräuchten Fleisch, aber uns zu liebe gab es nun also ein Linsen-Reis-Gericht mit Joghurt und Salat ... am Ende dann doch noch ein glücklicher Tag.