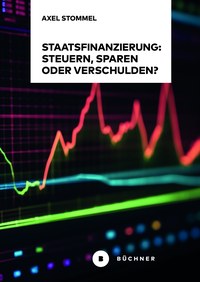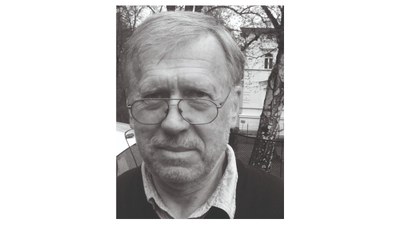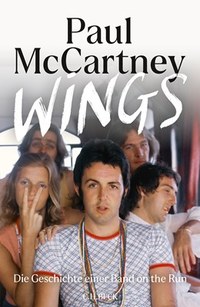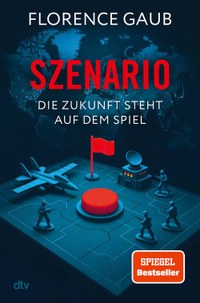Am 18. März 2025 hat der bereits abgewählte Deutsche Bundestag einer noch nicht gewählten Bundesregierung tausend Milliarden Euro aus neuer Verschuldung zur Verfügung gestellt; das Grundgesetz musste dafür von dem bereits abgewählten Parlament geändert werden. Tausend Milliarden sind eine Billion. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen: 1.000.000.000.000.
Tatsächlich ging und geht es jedoch um noch viel mehr. Obwohl noch gar nicht zum Kanzler gewählt, hat Friedrich Merz der Bundeswehr unverzüglich hoch und heilig versprochen, sie werde von seiner Regierung bekommen, »whatever it takes« (auf Deutsch: koste es, was es wolle). Das konnte er versprechen, weil alle Ausgaben für äußere Sicherheit, die ein Prozent des nominalen Bruttoinlandsproduktes überschreiten, im Rahmen der besagten Grundgesetzänderung von der Schuldenbremse ausgenommen worden sind.
Damit hat sich das Parlament zwar eine Untergrenze für kreditfinanzierte Rüstungsausgaben in die Verfassung geschrieben, aber keine Obergrenze. Das ist brandgefährlich, und zwar nicht nur sicherheitspolitisch und international, sondern auch rein ökonomisch und national. Denn finanziell unbegrenzte Rüstungsausgaben können nur allzu leicht die heimischen Produktionskapazitäten überlasten und die Inflation, die Geißel des sogenannten »gemeinen Volkes«, schüren.
Zu allem Überfluss hat jemand etwa vier Wochen nach dem Parlaments¬beschluss bemerkt, dass eine Neuverschuldung des gebilligten Ausmaßes gegen die Schuldenregeln der EU verstößt. Die waren übrigens ein Jahr zuvor eigens verschärft worden – pikanterweise auf deutsche Anregung hin. Mit Datum 24. April musste der noch amtierende deutsche Wirtschaftsminister aus der abgewählten Regierung bei der EU um eine Ausnahmeregel für die gesamte, künftige Wahlperiode nachsuchen: Das forsche Whatever-it-takes des Fried¬rich Merz braucht den Segen der EU. Falls die EU ihrem größten, wirtschaftsstärksten Mitglied den Segen nicht verweigern sollte: Was bedeutet das für den Rest der Gemeinschaft? Was für die Haushaltsdisziplin der anderen und die gemeinsame Währung?
Was auch immer noch kommen und wie es auch immer ausgehen mag: Der Vorgang gibt Anlass, Fragen der Staatsfinanzierung von Grund auf zu untersuchen. Zwar hat der in Aussicht genommene Mega-Kredit mit all seinem ungewöhnlichen Drum und Dran umfängliche, engagierte Erörterungen in den Medien ausgelöst. Für eine gründliche, systematische Untersuchung zumal in wirtschafts- und finanzpolitischen Alternativen ist dort jedoch naturgemäß kein Platz. Erstaunlicherweise fehlt eine derartige Untersuchung jedoch auch auf wissenschaftlicher bzw. populärwissenschaftlicher Ebene, wie sich nachfolgend noch zeigen wird. Damit ist das Thema dieser Schrift benannt: Basics der Staatsfinanzierung und der Streit der Interessen und Lehrmeinungen um Steuern, Sparhaushalte und öffentliche Verschuldung.
Die Schrift greift auf verschiedene Veröffentlichungen zurück, in denen ich mich im Laufe der Jahre mit Fragen der Staatsfinanzierung auseinandergesetzt habe, und vereinigt sie systematisch. An erster Stelle sind dabei die
»Basics der Ökonomie« aus dem Jahr 2019 zu nennen; die ersten vier ihrer 20 Kapitel sind im vorliegenden Zusammenhang von grundlegender Bedeutung, ohne dass dies ihrem Titel, »Basics der Ökonomie – Herrschende Lehren auf dem Prüfstand«, anzumerken ist. Das Werk hat es übrigens bis in die Shortlist des Hans-Matthöfer-Preises für Wirtschaftspublizistik 2020 geschafft, obwohl es den Lehrmeinungen der Jury-Mitglieder in vielen Punkten dezidiert widerspricht – sicherlich ein bemerkenswerter Vorgang. Die besagten ersten vier Kapitel dieses Werkes sind in der vorliegenden Schrift über weite Strecken unverändert wiederzufinden.
Des Weiteren ist meine Monografie aus dem Jahr 2020 in diesem Zusammenhang zu erwähnen; sie trägt den Titel »Die unerträgliche Leichtigkeit der Schulden – Corona, das Klima und die Schwarze Null«. Außerdem sind zwei Aufsätze in den »Blättern für deutsche und internationale Politik« zu nennen, in denen ich mich mit Easy Financing, also den unablässigen Versuchungen eines vermeintlichen Gebens ohne zu nehmen für Menschen auseinandersetze, die als Politiker:innen ständig dem Wählervotum unterworfen sind (Hefte Nr. 8/2021 und 11/2021); schließlich meine zum Teil bereits im vorigen Jahrhundert in verschiedenen Fachzeitschriften, namentlich in »Wirtschaft und Erziehung« erschienenen Beiträge zum vorliegenden Thema sowie meine Monografie aus dem Jahre 2012 mit dem Titel »Die Reichen, die Banken, die Schulden und wir«. Die verstreuten Abhandlungen also befinden sich auf den folgenden Seiten systematisch zusammengeführt und aktualisiert.
In Wirtschaft und Gesellschaft hängt vieles mit vielem zusammen. Fragen des Staatshaushalts berühren beispielweise auch Fragen der Außenwirtschaft, der Beschäftigungssicherung und des sozialen Ausgleichs, der Umwelt und des Klimas. Es ist unumgänglich, solche Themen zunächst auszuschließen, um den Gang der Untersuchung konzentriert und zielgerichtet durchs schwierige, streckenweise ideologisch wild und stachlig, gleichsam macchiaartig überwucherte Gelände zum Ziel zu führen, hier also zur konzentrierten, allgemein verständlichen und leicht fassbaren Antwort auf die Leitfrage der Untersuchung, die da lautet: Steuern, sparen oder verschulden?
Wer an den beispielhaft genannten, weiteren Fragen interessiert ist, sei auf die erwähnten »Basics der Ökonomie – Herrschende Lehren auf dem Prüfstand« hingewiesen. Gelegentliche Hinweise nach folgender Art (→Basic 17) verweisen auf diesen Text.
13 Aktuelle Theorien zur Staatsverschuldung
Die Ausnahme erscheint als Regel
Speziell die USA sind in ihre aktuelle Lage geraten,
»weil der neoliberale, minimalistische Staat nicht genügend Steuern von multinationalen Unternehmen und den Reichen eingesammelt hat.«
Liew Chin Tong an der Rajaratnam School of International Studies in Singapur [178]
Manche Zusammenhänge erkennt man mit dem Abstand des (örtlich und/oder sachlich) Außenstehenden besser. Wenn man nicht Fachfremde, etwa Soziologen wie Wolfgang Streeck oder Philosophen wie Jürgen Habermas und Richard Rorty aufsucht, dann muss man sich schon an ferne Orte wie Singapur begeben, um zu erleben, dass ein offenkundiger Zusammenhang wie der zwischen Steuern und steuern in fachwissenschaftlichem Rahmen klar und deutlich, fast schon wie ein Gemeinplatz ausgesprochen wird.
Was die Spatzen dort vom Dach pfeifen, stellt an unseren Schulen, Hochschulen und wissenschaftlichen Kongressen sowie in unseren Lehrbüchern dagegen etwas Unerhörtes, mehr noch: etwas ganz und gar Ungesagtes/Ungeschriebenes, etwas kaum Vorstellbares dar: ein, wie gesagt, zumal unbekanntes Tabu. Sowohl die progressiven als auch die herkömmlichen Ökonomen pflegen die Zusammenhänge zwischen staatlicher Verschuldung, staatlicher Abhängigkeit und wachsender sozialer Spaltung schlicht und einfach zu umgehen, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wolfgang Streeck hat, wie erwähnt, die stille Leere der herrschenden Lehre und ihres Widerparts zur Sprache gebracht: »Der, soweit ich sehen kann, einzige Ökonom, der auf diesen Zusammenhang [zwischen staatlicher Verschuldung und sozialer Spaltung – AS] aufmerksam gemacht hat, ist Carl Christian von Weizäcker, auch wenn und vielleicht gerade weil er ihn affirmativ [heißt: befürwortend – AS] wendet.«[179]
Übrigens war es wieder ein von Weizsäcker, der, offensichtlich auf gleicher Wellenlänge segelnd wie sein Anverwandter, im Februar 2025 jene Megaverschuldung auf den Weg gebracht hat, die den aktuellen, äußeren Anlass für die vorliegende Schrift bildet. Jacob von Weizsäcker nämlich, saarländischer Finanzminister und in Fachkreisen bestens vernetzt, war es, der sofort nach der Bundestagswahl am 24.2.2025 mit Jens Südekum, Wirtschaftsprofessor an der Universität Düsseldorf, in der SPD beheimatet und ebenfalls bestens vernetzt, telefoniert und dafür hatte gewinnen können, eine »lagerübergreifende« Runde aus führenden Ökonomen mit dem Ziel zusammenzustellen, der neuen Regierung eine gigantische Neuverschuldung dringend anzuraten.
Als Leuten vom Fach ist den beiden hinreichend bekannt, welch ungeheurer öffentlicher Finanzierungsbedarf sich im Laufe der Kohl- und Merkel-Jahre zuzüglich der vorzeitig beendeten drei Ampelkoalitionsjahre angesammelt hat. Wenn die neue Regierung nicht sogleich daran scheitern soll, woran ihre Vorgängerin letztlich gescheitert ist, nämlich an Geldmangel, so musste jetzt sofort neues Geld her – anders geht‘s nicht mehr. Das aus Kapitel 1 bekannte Wagner‘sche Gesetz hat die Ausweitung der öffentlichen Haushalte auf Platz 1 der Tagesordnung gesetzt.
Aus diesem Grund und zum besagten Zweck also holten sich Jacob von Weizsäcker und Jens Südekum drei Kollegen ins lagermäßig austarierte Boot: Moritz Schularick vom IfW in Kiel als Rüstungsexperten sowie Clemens Fuest vom ifo-Institut in München und Michael Hüther vom arbeitgeberfinanzierten IW in Köln, die beiden Letztgenannten als CDU-nahe Experten für Wirtschafts- und Finanzpolitik. The Pioneer berichtet: »Am Ende stand ein einseitiges Papier. Mit ›breitem Konsens‹, so heißt es dort, empfiehlt die Runde zwei gigantische Schuldentöpfe: 400 Milliarden Euro für Verteidigung, 400 bis 500 Milliarden Euro für Straßen, Schienen und Gebäude.« [180]
Wenige Tage später, am Dienstag, dem 4. März, verkünden Friedrich Merz, Markus Söder für CDU und CSU sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken für die SPD eine Einigung, welche die Empfehlungen der Ökonomen sogar noch übertrifft: die eingangs erwähnte Neuverschuldung in Höhe von
1.000 Milliarden Euro (plus X für Whatever-it-takes). »Ihr Papier hätte offenbar eine entscheidende Rolle gespielt, freute sich Südekum wenige Tage nach der Verkündung des Finanzpakets.«[181]Als Vorlage dürfte der Runde Joe Bidens Inflation Reduction Act gedient haben.
Die EU dagegen mit ihren gerade erst vor Jahresfrist pikanterweise auf deutschen Wunsch hin neu erhärteten Schuldenregeln hatten sie allesamt, die fünf Ökonomen und die vier Politiker (darunter eine Frau) allerdings offensichtlich nicht bedacht. Sie hätten die EU auch unmöglich bedenken können, denn es blieb ihnen faktisch keine andere Wahl: Die jahrzehntelange Sparpolitik war am Ende, Steuererhöhungen waren weiter absolut tabu für CDU und CSU – also blieb einzig und alleine unverzügliche, großvolumige Neuverschuldung übrig – Neuverschuldung war gewissermaßen »alternativlos«, um jenes Wort zu benutzen, mit dem die Kanzlerin in den ersten Jahren ihrer langen Regierungszeit viele ihrer Entscheidungen zu begründen pflegte – bis dann eine neu gegründete Partei ihr dieses Wort gründlich verleidet hatte.
Sein Wortbruch fiel Friedrich Merz, dem designierten Kanzler der neuen SchuKo[182], offensichtlich nicht schwer, obwohl dieser Wortbruch das Zeug hat, als eins der waghalsigsten Wendemanöver in die Geschichte der bundesrepublikanischen Politik einzugehen. Eigentlich eine erstaunlich kleine Schar von Ökonomen und gewählten Politikern (mitsamt der Frau), die sich da berufen fühlten, die Weichen für Deutschland kurz entschlossen von Sparen auf Verschulden umzustellen!
Der große Keynes hatte schon recht, als er gegen Ende seines Opus magnum die einzigartige Bedeutung von Ökonomen wie folgt beschrieben hatte: »(D)ie Gedanken der Ökonomen und Philosophen, sowohl wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, [sind] einflussreicher, als gemeinhin angenommen wird. Die Welt wird in der Tat durch nicht viel anderes beherrscht. Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen.« [183]
Anmerkungen zu Kapitel 13
178 Liew Chin Tong, Von wegen China, in: IPG-Journal vom 6.1.2020.
179 Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit…, S. 157. Weiter heißt es bei Streeck: Carl Christian von Weizsäcker »begründet dies mit einem säkularen Kapitalüberschuss in reichen Gesellschaften wie Deutschland, den er auf ein gestiegenes ›Vorsorgebedürfnis‹ einer älter werdenden Gesellschaft zurückführt. Damit diese nicht in ›Anlagenotstand‹ gerät, müsse der Staat bereit sein, ihre Ersparnisse als Kredit aufzunehmen, zumal der Zweck der Vorsorge riskantere Anlagen ausschließe und die Anlagemöglichkeiten in einer sich zur Wissensökonomie entwickelnden Realwirtschaft wegen deren veränderten Kapitalbedarfs nicht ausreichten. Weizsäcker geht nicht darauf ein, dass dem Anlagenotstand auch abgeholfen werden könnte, indem die überschüssigen Ersparnisse durch höhere Besteuerung (›Konfiskation‹) in reguläre Staatseinnahmen verwandelt würden – ebenso wie das Fürsorgebedürfnis statt individuell durch Ansparen privater Vermögen ja auch kollektiv auf dem Wege über eine Umlagefinanzierung abgedeckt werden könnte, beides mit tendenziell egalitären Konsequenzen.« (Ebd.)
180 Die Schuldenmacher, in: The Pioneer vom 20.3.2025, https://www.thepioneer.de/ originals/others/articles/die-schuldenmacher
181 Ebd.
182 Die Abkürzung steht für »Schuldenkoalition«; von einer neuerlichen, fünften GroKo, also einer Große Koalition, kann ja keine Rede mehr sein, wenn die Koalitionäre nur noch 45 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen.
183 John Maynard Keynes, Allgemeine Theorie…, S. 323 f.