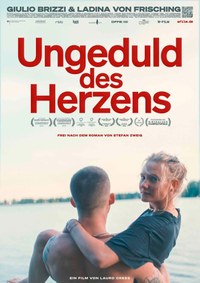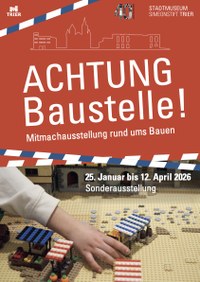Das Deir Yassin Massaker ereignete sich am 9. April 1948, als paramilitärische zionistische Gruppen, die bereits seit den frühen dreißiger Jahren aktiv waren, ein arabisches Dorf in der Nähe von Jerusalem angriffen und mehr als hundert Palästinenser töteten. Es war Hind Husseini, Tochter einer angesehenen palästinensischen Familie, die sich einer Opfergruppe dieses Überfalls im Kontext der gewaltsamen israelischen Staatswerdung annahm: Mit ihrem Erbe gründete sie ein Waisenhaus. Aus dem Haus von Hind Husseinis Großvater wurde ein stets ausgelastetes Kinderheim, die Tochter selbst fungierte als Leiterin und entwickelte es zu einer veritablen Bildungseinrichtung, dem Dar-Al-Tifl-Institut.
In Julian Schnabels Film Miral ist Hind Husseini weniger Hauptfigur als graue Eminenz im Hintergrund, eine Ermöglicherin, die die Biografien junger arabischer Frauen aus dem Flüchtlingsnarrativ befreit, indem sie diese formt und selbstbewusst in die Welt entlässt. Wie Miral, die einen israelischen Pass hat, aber aufgrund ihrer arabischen Herkunft als Bürgerin zweiter Klasse gilt. Als ihre Mutter Nadia stirbt, schickt sie der Vater in das Dar-Al-Tifl-Institut. Der herbeigesehnte Bildungserfolg setzt zwar ein, hat jedoch zur Konsequenz, dass Miral anlässlich der ersten Intifada einen Politisierungsschub erfährt, der durch die Liebe zu dem kämpferischen Aktivisten Hani wenn nicht determiniert, so doch ausgelöst wird
Es ist nur ein Detail in einem an Merkwürdigkeiten reichen Film, dass die Bildungserfolgsgeschichte einen emanzipatorischen Vektor produzieren soll, die Hauptfigur aber in den entscheidenden Momenten vor allem als dekorativ hergerichtete Liebhaberin inszeniert wird, die ihren Hani mit großen dunklen Augen anschaut, wenn er ihr die politischen Koordinaten des palästinensischen Widerstands aufzeigt.
Nur als Camp rezipierbar
Auch die unzähligen Kostümwechsel gehören zum Girlie-Prinzip, das Schnabel um die Schauspielerin Freida Pinto (Slumdog Millionaire) herum errichtet und grobschlächtigst über die jüngere Geschichte des Nahostkonflikts legt. Trauriger Höhepunkt ist ein romantisches Picknick, das in eine illustrierende Montage von Luftaufnahmen jüdischer Siedlungen übergeht. Die flauschige Stoffdecke trifft auf das monumentale Beton der Siedlungsarchitektur (eine Deflorationsmetapher?).
Zur perspektivischen Monotonie des Films passt seine phasenweise eigentlich nur als Camp rezipierbare ästhetische Form. Ein wirre Handkamera trifft hier auf Orchesterkitsch aus der Dose und wahllos eingestreutes Archivmaterial. Dass die konzeptbefreite Kamera von Eric Gautier, dem begnadeten Bildgestalter von Regisseuren wie Sean Penn (Into the Wild), geführt wurde, ist auch keine Information, die man in den Credits gerne liest, während man sich noch über Schnabels Entscheidung wundert, die finale Beerdigungsszene von einem Tom-Waits-Song eskortieren zu lassen.
Nach der Premiere auf dem Filmfestival von Venedig wurde Schnabels Film, der auf einem autobiografischen Roman seiner aktuellen Lebensgefährtin Rula Jebreal beruht, etwas hysterisch der pro-palästinensischen Propaganda bezichtigt, worauf der Kunstregisseur im Presseheft mit einem Klassiker aus der Naivitätskiste reagiert: „Ich bin ein Künstler, kein politischer Experte.“ Das Resultat in solchen Fällen ist dann eben die Politschmonzette.